Adrian Daub | Rezension | 19.04.2023
Die Vorgeschichte unseres historischen Moments
Rezension zu „Mitte/Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus“ von Thomas Biebricher
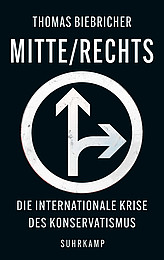
Die politische Landschaft Europas ist gekennzeichnet von zerstörten oder zumindest lädierten Brandmauern. So ließ sich Thomas Kemmerich (FDP) im Frühjahr 2020 mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens wählen und riss damit eine solche Brandmauer ein, während er gleichzeitig behauptete, sie „bleibe bestehen“. Dies ist die Urszene in Thomas Biebrichers Mitte/Rechts, das dieser Tage im Suhrkamp-Verlag erschien. Darin geht es um die roten Linien nach rechts und den doppelzüngigen Konservatismus, der daraus seine Berechtigung zieht. FDP-Vize Wolfgang Kubicki deutete den Tabubruch von Erfurt 2020 so: „Ein Kandidat der demokratischen Mitte“ habe gesiegt. Das schien damals vielen absurd und ein Grund, von der Rhetorik der Mitte abzurücken, die nur ein selbstlegitimierendes Phantasma sich radikalisierender Konservativer sei.[1]
Brandmauern sind überall in Europa gefallen, aber nie auf die gleiche Weise und nie zum gleichen Zeitpunkt. Darin besteht „Die internationale Krise des Konservatismus“, so Biebrichers Untertitel. Er beschreibt sie vor allem als Krise konservativer Parteien, dabei betont er deren Fähigkeit, die Gefühlswelten konservativer Wählerschichten wiederzugeben, ihnen ein Ventil zu bieten. In der Lösung der von ihm ausgemachten Krise sieht Biebricher eine der politischen Hauptaufgaben unserer Zeit, gestellt insbesondere an Menschen, die nicht zum konservativen Lager gehören. Dies ist insofern schwierig, als die Kräfte, die von rechts auf die Mitte einwirken, sich häufig als die Mitte des Volkes bezeichnen.
Die Mitte fühlt sich mittig, insofern sie ein bisschen rechts ist.
Biebricher nimmt das Gefühl der Mitte als Gefühl ernst. Die „Mitte“ ist ein „politischer Sehnsuchtsort“, und als solcher ist sie wohl in der Tat „für Konservative dem Selbstverständnis nach ihr von jeher angestammtes Terrain“ (S. 20). Wenn Biebricher von der „rechten Mitte“ schreibt, meint er das, zumindest was die Selbstdarstellung angeht, als Pleonasmus: Die Mitte fühlt sich mittig, insofern sie ein bisschen rechts ist. Ebendiese Mitte bricht nun in vielen Demokratien weg. Die Christdemokratie, einst in fast allen europäischen Ländern mehr oder minder dominant, befindet sich im Niedergang. Gemäßigt konservative Parteien wie die Partido Popular, die Österreichische Volkspartei oder die Nea Demokratia werden zwischen radikalliberalen und illiberalen Parteien aufgerieben. Biebricher will zeigen, dass sich hier – an der Trennlinie zwischen den Bewahrern des Status Quo und denen, die den Status Quo erst zerschmettern wollen, um ihn dann verteidigen zu können – „das Schicksal der liberalen Demokratie entscheidet“ (S. 17).
Ihm zufolge besteht Konservatismus in substanzieller Hinsicht aus „normative[r] Natürlichkeit“ (S. 29) und in prozessualer Hinsicht auf „erfahrungsbasierte[m] Inkrementalismus“ (S. 38). Will meinen: Konservatismus basiert auf dem Gefühl, dass eine bestimmte Ordnung der Gesellschaft wünschenswert ist und es sie daher zu verteidigen gilt. Dazu kommt der Verdacht, dass gesellschaftliche Transformationsprozesse zu schnell vonstatten gehen. Wie Biebricher nun einleuchtend zeigt, geraten der substanzielle und der prozessuale Pol notwendigerweise in Konflikt. Denn gemäß der Erfahrung der letzten 200 Jahre (nicht zufälligerweise in etwa seit es den modernen Konservatismus gibt) ist die Welt, die die Konservativen bewahren wollen, im Moment ihrer Bewahrung schon im Untergang begriffen.
Der Autor sieht für den Konservativen drei Möglichkeiten, mit dieser Urszene der Enttäuschung „als wiederkehrendes Kränkungserlebnis“ (S. 48) fertigzuwerden. Erstens: Der Konservative zieht sich in eine kulturpessimistische Schmollecke zurück, findet seine Befriedigung am beobachteten Niedergang und begegnet der Welt prinzipiell als einer gefallenen. Zweitens: Er verdrängt den Widerspruch, nimmt die Veränderungen gönnerhaft hin, oder geht gar zur Verteidigung des neuen Status Quo über. Drittens: Man versucht, den Status Quo dahin zurückzudrehen, wo er noch verteidigungswürdig war – nur verlässt dieser Impuls gemeinhin den Grund des Konservativen, und auf jeden Fall den der Mitte. Der Glauben an eine rote Linie des ‚traditionellen‘ Konservatismus nach rechts ist – und war immer schon – eine Illusion, ebenso wie die Resistenz konservativer Wählerschichten gegenüber ‚dem Populismus‘.
„Der Grat zwischen dem schlechtgelaunten Kulturpessimisten, der vor der Eiche-natur-Schrankwand das (An-)Klagelied der Moderne intoniert und über den Untergang des Abendlandes trauert, und dem Pegidisten, der gegen diesen Untergang auf die Straße zu gehen müssen glaubt, ist ein schmaler.“ (S. 53 f.)
Italien und das Modell einer personalisierten Flash-Partei
Biebrichers erste Fallstudie ist Italien, das zwischen 1990 und 2022 eine beispiellose Aushöhlung des gemäßigten Konservatismus erlebte, beginnend mit der „Umstellung eines tripolaren auf ein bipolares Parteiensystem, wodurch der Raum der rechten Mitte überhaupt erst entstand“ (S. 98). Das Machtmonopol der etablierten Parteien (pentapartito) weichte auf, gerade auch durch die Entstehung der regionalistischen Lega Nord, die die Schwächen des alten Parteiensystems ausnutzen konnte Gleichzeitig etablierte sich „das Modell einer personalisierten Flash-Partei“ (ebd.), gruppiert um charismatische Führungsfiguren statt um ideologisch konsistente Programme, die einflussreichsten sind die Berlusconi-Parteien Forza Italia (FI) und Il Popolo della Libertà (vgl. ebd.).
Zum Aufstieg Berlusconis führte die politische Gemengelage in den frühen 1990er-Jahren: Das Parteiensystem lag in Scherben und die Situation war perfekt für einen Newcomer. Nur war Berlusconi bereits mit dem pentapartito aufs Korrupteste verflochten, was ihm eine mediale Monopolstellung sicherte; ebendiese Verfilzung trieb ihn in die Politik – sozusagen als Flucht nach vorn. Die Forza Italia trat zwar als Partei der rechten Mitte an, aber sie war keine christdemokratische mehr. Sie orientierte sich an der Kirche, ohne dass die Figur Berlusconis je wirklich als Traditionshüter taugte. Jener Sittenverfall, den die Forza anprangerte, war Berlusconis Geschäftsprinzip im Fernsehen und sein persönliches Hobby. Die FI war im Kern eine neoliberale Partei:
„Ein überinterventionistischer Staat, der seine Bürger mit Regularien gängele und zudem mit horrenden Steuern überziehe, müsse zurückgestutzt und am besten selbst einem Unternehmen ähnlicher werden.“ (S. 92)
Der Wahlsieg der postfaschistischen Fratelli d’Italia 2022 stellt für Biebricher nicht den notwendigen Schlusspunkt der nachgezeichneten Entwicklung dar. Es geht ihm vielmehr um die langfristigen Veränderungen und Verschiebungen, die hinter den Parteigründungen, Allianzen und Affären stattfinden. Was Biebricher immer wieder betont, ist die Tatsache, dass die Kannibalisierungseffekte der verschiedenen rechten Parteien dazu führten, dass ein „Kontinuum zwischen rechter Mitte und rechtem Rand“ (S. 161) entstand und ständig neu vollzogen wurde. Die postfaschistische Alleanza Nationale zum Beispiel bewegte sich in ihrer Fusion mit der Forza Italia gen Mitte – das „verwaiste“ (S. 164) Territorium auf ihrer rechten Flanke beanspruchten daraufhin die Fratelli d’Italia unter Giorgia Meloni für sich. Des Weiteren zeigt Biebricher, dass „autoritäre Kräfte eindeutig die Hegemonie über das Spektrum rechts der Mitte erlangt haben“ (S. 218). Die Impulse gehen nicht mehr von der Mitte aus, sie muss vielmehr die Impulse nachäffen, um bei breiteren Wählergruppen punkten zu können.
Frankreich und die drei Rassemblements
Im Falle Frankreichs ist die Erzählung übersichtlicher: Hier rückt Biebricher den Niedergang des Gaullismus als gemäßigtem, breit positioniertem Konservatismus und den Aufstieg des Front/Rassemblement National in den Vordergrund. Die Geschichte dessen, was Biebricher hier zeigt, besteht im Grunde aus drei Bewegungen beziehungsweise Parteien: das von de Gaulle gegründete Rassemblement du Peuple Francais, Jacques Chiracs neoliberales Update, das Rassemblement pour la République (RPR) und das Rassemblement National Marine Le Pens. Hierbei handelt es sich, anders als in Italien, nicht um eine Geschichte von Wahlerfolgen der autoritären Rechten; zumindest nicht im Sinne von Regierungsbeteiligungen. Denn im französischen Wahlsystem produzierte „selbst eine zunehmend fragmentierte Parteienlandschaft […] nach wie vor vergleichsweise klare Mehrheiten” (S. 271). Nur fehlt diesen Mehrheiten zunehmend die symbolische Legitimität und die Einigkeit für klare Richtungsentscheidungen (vgl. ebd.). Stattdessen dominiert die extreme Rechte mehr und mehr die öffentliche Themensetzung, treibt gemäßigtere rechte (und sogar linke) Kräfte vor sich her.
Bei allen offensichtlichen Unterschieden zeigt Biebricher analoge Entwicklungen und Problemstellungen in den Fällen Italien und Frankreich auf. In beiden Ländern stellte der Versuch, den Verpflichtungen in den Maastrichter Verträgen (und später denen der Währungsunion) nachzukommen, die etablierten Parteien vor Schwierigkeiten. Die Dualität Technokrat/Volkstribun fand hier vor allem innerhalb der etablierten Lager statt, manchmal sogar innerhalb der einzelnen Politikerbiografien: Jacques Chirac präsentierte den französischen Wählern 1995 im ersten Wahlgang einen volksnahen „mitfühlenden Neo-Gaullismus“ (S. 260), seinen Widersacher Édouard Balladur stellte er als herzlosen neoliberalen Bürokraten dar. Nachdem Balladur besiegt war und er sich plötzlich im zweiten Wahlgang mit Lionel Jospin messen musste, wich die Warnung vor der „‚sozialen Spaltung‘ (fracture sociale)“ (ebd.) schnell eindeutig neoliberalen mitte-rechts Positionierungen.
Solche Weder-rechts-noch-links-Finten haben natürlich vor allem dem Front, später Rassemblement National Vorschub geleistet, der explizit neoliberal, ja Thatcheristisch antrat: ein
„nationalistisch imprägnierter Neoliberalismus, der nichts gegen Wettbewerb und Eigenverantwortung per se hatte und schon gar nichts gegen Steuersenkungen, der allerdings die Notwendigkeit apostrophierte, die Franzosen gegenüber dem Wettbewerbsdruck von außen abzuschotten oder diesen zumindest abzufedern“ (S. 247).
Die Figur, die Chirac gegen Jospin nur ein paar Wochen lang mimte, machte der FN/RN zu seinem Markenzeichen. Da er nie wirklich an der Macht beteiligt war, musste er deren Widerspruch auch nicht auflösen.
Aufgrund ihrer Außenseiterposition konnte die Partei immer den „hochprofitablen Status des ausgeschlossenen Opfers eines Kartells der Mainstream-Parteien“ für sich beanspruchen, „das aber eigentlich die richtigen und wichtigen Themen und Fragen aufwirft“ (S. 384). Dadurch wurde die Agenda des FN/RN die der französischen Konservativen tout court: In kulturellen/identitären Themen folgen die anderen französischen Parteien mittlerweile den Rechtspopulisten, und imaginieren ähnliche Bedrohungen französischer Identität, unter anderem dieselben bêtes noires, die mittlerweile die britischen Tories umtreiben: Genderideologie, islamogauchisme, wokisme.
Das Vereinigte Königreich und sein vergiftetes Erbe
Die Situation im Vereinigten Königreich (Biebrichers drittem Beispiel) stellt sich noch einmal ganz anders dar: Der dortige Niedergang der Konservativen ereignete sich in vier Jahrzehnten, in denen sie, mit Ausnahmen der Regierungen Blair und Brown, ständig die Politik des Landes in der Hand hatten. Auch hier hat Biebricher mit seiner Diagnose wahrscheinlich recht: Das Spektakel der Jahre 2016 bis 2022, in denen fast jährlich ein nominell gesetzter konservativer Premierminister (oder in zwei Fällen Premierministerin) unkalkulierbare Risiken einging, die ihm/ihr dann prompt um die Ohren flogen, zeigt, dass die angebliche Mitte mittlerweile wie eine rechtspopulistische Partei agiert. Allerdings kommt die Herausforderung nicht primär von außen (etwa von der UK Independence Party), sondern sie besteht in dem verzweifelten Versuch der Tories, die populistischen Elemente in ihrer eigenen Koalition einerseits an sich zu binden, und sie andererseits unter Kontrolle zu halten.
In Biebrichers Darstellung handelt es sich dabei nicht um eine rezente Verirrung, sondern eher um ein vergiftetes Erbe. 1990 wehrten sich die Tories gegen ihre Premierministerin Margaret Thatcher, unter anderem weil sie sich eine engere Einbindung in die EG/EU wünschten. Auch in Großbritannien setzten die Maastrichter Verträge vormalig unter den Teppich gekehrte konservative Inkompatibilitäten unter Hochspannung. Als Thatcher daraufhin abtrat, lag jene Identitätskrise, die die französischen und italienischen Konservativen in den folgenden Jahrzehnten noch umtreiben sollte, schon hinter den Tories. Sie blickten „auf eine außergewöhnliche Dekade der Dominanz zurück“, die aber „den Konservatismus freilich fast bis zur Unkenntlichkeit verwandelt hatte“ (S. 393). Der Konservatismus der Tories war ein „Grenzfall“ zwischen gemäßigtem Konservatismus und autoritärem Populismus, denn es ging nicht um den Erhalt normativ verstandener tradierter Ordnungen, sondern um die „bewusste[] Destabilisierung des Status Quo“ (S. 397).
Für Biebricher laborierten Thatchers direkter Nachfolger John Major, die konservativen Oppositionsführer William Hague, Iain Duncan Smith und Michael Howard sowie die zunehmend glücklosen Tory-Premierminister ab David Cameron im „langen Schatten der eisernen Lady“, so eine Kapitelüberschrift. Sie alle mussten einen Umgang finden mit der Euroskepsis, die mit dem neoliberalen Erbe Thatchers auf vielfältige und widersprüchliche Art verflochten war.
Auch im britischen Fall zeigen sich dieselben Verwerfungslinien wie in den EU-Ländern, von denen sich die Briten unbedingt lossagen wollten. Selbst indem man „die Kontrolle zurückgewann“, so das Versprechen der Brexiteers, manövrierte man den Nationalstaat in eine Situation, in der ihn regionale Autonomiebestrebungen und die Regularien der EU zerreiben – auch nachdem er die EU verlassen hat.
Obwohl der Autor (manchmal fast zu) nah an den parteipolitischen Entwicklungen bleibt und große Generalisierungen tendenziell eher vermeidet, ergeben sich gerade durch seine genauen Beobachtungen spannende Muster und Echos.
Thomas Biebrichers lesenswertes Buch schärft den Blick für solche zeitgenössische Paradoxien, und für die Politiker, die sich ihnen nicht zu stellen vermögen – ob sie sich zur rechten Mitte rechnen oder nicht. Obwohl der Autor (manchmal fast zu) nah an den parteipolitischen Entwicklungen bleibt und große Generalisierungen tendenziell eher vermeidet, ergeben sich gerade durch seine genauen Beobachtungen spannende Muster und Echos. Erst mit der Aushöhlung der Christdemokratie konnte der Dualismus Technokrat/Volkstribun wirkmächtig werden (paradigmatisch im Falle Italiens); seit den Maastrichter Verträgen ließen sich unangenehme politische Entscheidungen aufgrund der exekutiven Macht der EU „über die europäische Bande“ (S. 78) spielen; der Versuch der Nationalstaaten, ihre Wirtschaft den sich etablierenden EU-Standards anzupassen, trocknete einerseits traditionelle Pfründe aus, während er andererseits neue Möglichkeiten eröffnete; die Schwächung des Zentralstaats passierte nicht nur im Namen Brüssels, sondern wurde auch vom populistischen Regionalismus forciert – in Beobachtungen wie diesen erzählt Mitte/Rechts die Vorgeschichte unseres historischen Moments, gerade in ihren Reimen und Assonanzen.
Fußnoten
- Corey Robin etwa weist darauf hin, dass das Gefühl der Mitte von den Tatsachen nicht gedeckt ist, dass also die Selbstwahrnehmung der Konservativen als Bewahrer und behutsame Neuerer Selbsttäuschung ist. Ders., The Reactionary Mind. Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin, Oxford 2011.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Demokratie Europa Internationale Politik Staat / Nation
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Demokraten, aufgepasst!
Archie Brown denkt über politische Führung in schwierigen Zeiten nach
