Claus Leggewie | Rezension | 11.03.2025
Es gibt ein richtiges Leben im falschen
Rezension zu „Widerstehen. Versuche eines richtigen Lebens im falschen“ von Ferdinand Sutterlüty
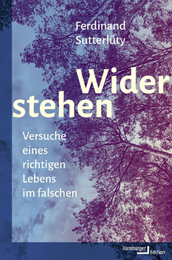
Auch wenn Theodor W. Adorno 1944 im Exil den vielzitierten Aphorismus 18 der Minima Moralia[1] mit dem apodiktischen Satz abschloss, es gebe „kein richtiges Leben im falschen“, setzt das nach Ansicht eines Interpreten „sowohl die Erfahrung als auch einen Begriff der Möglichkeit eines guten Lebens voraus. Andernfalls nämlich könnte niemand von der Falschheit des falschen Lebens wissen. Darum bildet das Tasten nach Bruchstücken des ‚Richtigen‘ im ‚Falschen‘ den entscheidenden Antrieb der Gesellschaftskritik Adornos.“[2]
In diese Richtung wendet der Frankfurter Soziologe Ferdinand Sutterlüty Adornos Motto in seinem ethnografischen Reisebericht Widerstehen Erfahrung und Begriff der Möglichkeit auf neun Personen an, die ihm in längeren Gesprächen von ihren alltäglichen Widerstandspraktiken erzählt haben.
„Gemeinsam ist ihnen, dass sie die gesellschaftlichen Zustände, in denen sie leben, zutiefst ablehnen. Sie kritisieren nicht nur, sondern stehen auch existenziell für ihre Positionen ein. Manche tun dies im beruflichen Kontext, bei anderen lässt sich ihre Lebensweise insgesamt als Gegenentwurf zur herrschenden Ordnung und zu ihren Destruktivkräften begreifen.“ (S. 7)
Dem Autor demonstrieren sie
„auf exemplarische Weise, dass es Alternativen zu den eingelebten Denkmustern und Gewohnheiten der kapitalistischen Kultur gibt. Sie haben Wege gefunden, sich den weithin akzeptierten Ungerechtigkeiten zu widersetzen, die unsere Gesellschaft strukturieren; einige haben sich eine Lebensweise angeeignet, die ohne die Vernutzung unserer natürlichen Existenzgrundlagen auskommt“ (ebd.).
Als Zeitungsleser und Nutzer sozialer Netzwerke bekommen wir viele Personen vorgeführt, die angeblich „gegen den Strom“ schwimmen: Nonkonformisten, Idealisten, schräge Typen, Einzelgänger, oft auch Querulanten, Querdenker, Psychopathen, Systemsprenger. Sutterlüty hat ein Casting gegen das Widerstehen als bloße Pose vorgenommen; die von ihm vorgestellten Personen klagen nicht nur oder meckern herum, sie agieren in ihrem Lebensalltag gegen „die herrschende Ordnung“ und ihre „Destruktivkräfte“. Nur wenige sind in organisierte Protestaktivitäten eingebunden, ihr Terrain sind Mikro-Praktiken „verdeckten Widerstands“, die unter dem Radar der Öffentlichkeit bleiben. Bei ihnen kommt eine widerständige und abweichende Haltung mit einer (in diesem Sinne dann doch) politischen Handlung zur Deckung. Wer derart nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten überzeugt, überwindet den Hiatus, den die meisten Leser dieses Buches mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen bei sich einräumen werden: Dass sie selbst nicht so handeln, wie es der proklamierten Überzeugung nach geboten wäre. Sutterlütys Fälle wirken der daraus meist resultierenden Lähmung entgegen, insofern die Akteure demonstrieren, dass es unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen „auch ganz anders geht“. Denn es kommt (auch) auf jeden Einzelnen an.
Für eine soziologische Ethnografie des Widerstehens stellen sich einige typische Probleme. Sie beginnen mit der Konzipierung eines Vorhabens, das hier in den Jahren von 2019 bis 2021 aus „fruchtbaren Debatten“ mit Kolleginnen und Kollegen am Institut für Sozialforschung über „verdeckten Widerstand“ Gestalt angenommen hat.[3] Als qualitativer Sozialforscher hat sich Sutterlüty sieben Einzelpersonen (und ein Paar) ausgewählt, die ihm selbst aufgefallen waren oder nahegelegt wurden. Die Interviews und Protokolle wurden in einem abgeschieden in den Bergen verbrachten Forschungsfreisemester (einer verdienstvollen Einrichtung, die Sparfüchse der Wissenschaftsbürokratie gerne beseitigt sähen) transkribiert; sie stehen in der gekürzten, verdichteten Fassung im Buch, die den „Sound“ der Originaltöne bewahrt. In einer kurzen Einleitung und einem etwas längeren Nachwort, zum Teil auch in Einschüben macht er die jeweiligen Biografien bekannt und kommt auf Umstände des Interviews zu sprechen. Meist beschränkte er sich auf kurze Rück- und Klärungsfragen und streute Beobachtungen ein über eine Reaktion der Gesprächspartner („Kämpft mit den Tränen. Längeres Schweigen“, S. 107). Das erfordert Selbstdisziplin:
„Als Soziologe, der es gewohnt ist, sein Material zu interpretieren und zu theoretisieren, musste ich lernen, mich aus den entstehenden Texten herauszuhalten. Jeder Kommentar, den ich zu geben versucht war, kam mir bald störend vor. Dennoch ist mir natürlich bewusst, dass ich als Interviewer, Beobachter und Erzähler in den Texten präsent bin.“ (S. 201).
Vorgestellt werden in 20- bis 26-seitigen Porträts unter fingierten Namen und Ortsangaben (1) ein Seenotretter, (2) eine ausländische Reinigungskraft, (3) eine mit Transfrauen und Sexarbeiterinnen arbeitende Künstlerin, (4) ein Berufsschullehrer, (5) eine Forstbeamtin, (6) eine politische Aktivistin, (7) ein Künstler und (8) ein Bergbauernpaar. Sie leben in einer „Vorstadtsiedlung“, in der „Großstadt“, „in einer entlegenen Gegend“, „in einem verlorenen Landstrich“, im Bergdorf. Sutterlüty nennt das die „Hinterbühnen“ des Widerstands, die als Rückzugs- und Sammlungsorte benötigt, wer Einspruch erheben will. Gesprächsweise werden Lebenslagen, Herkünfte, persönliche und berufliche Netzwerke, Handlungsmotive und Zeitbudgets klar, also die subjektiven Dispositionen verdeckten (und offenen) Widerstands genau wie die objektive, als ungerecht und unhaltbar bewerteten Umstände in der europäischen Flüchtlingspolitik, in prekären und demütigenden Arbeitsverhältnissen, in der Diskriminierung sexueller Orientierungen, in falschen Standards und Settings des Bildungssystems, in patriarchalen Berufshierarchien, in lebensfeindlichen und nicht-nachhaltigen Strukturen der Erzeugung und des Konsums wirtschaftlicher Güter. In der Summe ergibt das eine Kritik am realexistierenden Kapitalismus, namentlich an seinem rigiden Zeitregime und der ungleichen Ressourcenverteilung.
Die Einzelfälle sind divers, oft interessant erzählt und bisweilen spannend zu lesen. Den Auftakt bildet ein Fluchthelfer, der seine bisweilen „alegale“ Arbeit der Rettung Gekenterter im Mittelmeer und der Betreuung von Geflüchteten in Deutschland, wo er dort mit der Bergung ertrunkener Kleinkinder und hier mit der aussichtslos Traumatisierten zu tun bekommt, in einer „strukturellen Distanz zu den Ordnungsbehörden unseres Landes, unseres Staates“ (S. 28) sieht. Er sieht sich aus der Verpflichtung gelöst, an dieser Ordnung teilzuhaben, zum Beispiel in dem bizarren Fall eines im „System“ der behördlichen Datenverarbeitung verschwundenen Flüchtlings, der sich vermutlich in der Haft das Leben genommen hat. Durch die tätige Solidarisierung mit der „Illegalität des Daseins dieser Menschen“ (S. 33) entsteht im Helfer „ein großer Raum der politischen Freiheit, der völlig anational funktioniert“ (S. 34), weil Hilfe für Menschen in Not für ihn selbstverständlich nicht an Staatsgrenzen enden darf.
Ebenso beeindruckend ist der Fall einer aus Polen gebürtigen Reinigungsfrau, die über ihre Odyssee durch unterbezahlte und entwürdigende Arbeitsverhältnisse in betrügerischen Hotelbetrieben berichtet und sich zu einer arbeitsrechtlich informierten und mutigen Interessenvertreterin vor allem von People of Color entwickelt hat. Verdeckt ist ihr Widerstand, weil sie im klandestinen Kontakt zu Gewerkschaften tätig ist und mit ihnen gemeinsam im Kampf gegen ausbeuterische Arbeitgeber Überraschungseffekte vorbereiten kann. Von der Veröffentlichung erhofft sich die Frau, dass mehr Menschen erkennen, wie man sich zu Wehr setzen kann.
Ähnlich gelagerte Fälle eines zunächst donquijotisch wirkenden Kampfes ist der oft frustrierende Versuch eines menschlich und fachlich engagierten Mathematiklehrers, auf informelle Weise das Bildungsniveau und damit die Berufschancen seiner weitgehend desinteressierten Schüler zu heben, und der oft scheiternde Kampf der Forstbeamtin gegen die fortgesetzte Bevorzugung weniger qualifizierter männlicher Kollegen. Das Interview nutzt sie als ein Selbstexperiment. Das Buch enthält ferner die Geschichten dreier politisch engagierter Künstler*innen. Die beiden Frauen sind politische Aktivistinnen, die der Gesellschaft kritisch gegenüberstehen und Protest organisieren, also extrovertierten Widerstand üben. Der dritte ist ein eher introvertiertes „Faktotum“, dessen Gelegenheitskunst in der unprätentiösen Ausstellung der eigenen Bedürfnislosigkeit besteht, die er gelegentlich öffentlich macht. Den Abschluss bildet ein bewegendes Gespräch mit den „Vergaldas“ über ihren dornigen Versuch, eine konviviale Genossenschaft von Subsistenzlandwirten am Laufen zu halten, der sich dem Produktionsdruck und der Bürokratie der modernen Landwirtschaft entzieht, das Tierwohl berücksichtigt und die Naturumgebung schont.
Sutterlüty lässt die Leserschaft mit den Kurzgeschichten der Protagonisten allein und bietet im Nachwort keine aufwändige Metaanalyse. Die „Minima Moralia“ zeigten eine Welt des Unheils, wie der irritierte Leser Thomas Mann fand, „aus der kein Entkommen“ sei. In den 1950er-Jahren schwächte Adorno das selbst ab: „Das einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass das richtige Leben heute in der Gestalt des Widerstands gegen die von dem fortgeschrittensten Bewusstsein durchschauten, kritisch aufgelösten Formen eines falschen Lebens bestünde.“[4]
Dies praktizieren die neun Personen auf je spezielle Weise. Sie nehmen gewichtige Gründe für ihr rebellisches Handeln in Anspruch, kritisieren verfestigte Strukturen falschen Lebens, die als jeder Kritik überlegene Normalität ausgegeben werden, und rütteln daran an marginalen Orten mit scheinbar geringem systemischen Effekt. Ganz untheoretisch hantieren sie mit Bruchstücken des Richtigen im Falschen und können dabei als Vorbilder dienen. Für breitenwirksame Resistenz kommt es auf die konvivialen Zusammenhänge an, in denen sich die Protagonisten bewegen. Sutterlüty arrangiert die Pionierinnen so, als würden sie nicht nur für sich sprechen, sondern auch zueinander. „Oft habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn sie sich zu einer ‚Konferenz der richtigen Lebensführung‘ träfen. Bei ihren Diskussionen wäre ich gerne dabei. Gemeinsame Themen hätten sie genug.“ (S. 201 f.)
Die noch nicht beantwortete Frage lautet, ob und wie sich individuelle Formen der Gegenwehr in kollektiven Widerstand extrapolieren ließen beziehungsweise ohne solchen zu verkümmern drohen. Das Adorno-Archiv gibt dazu die ursprüngliche Version des Aphorismus preis: „Es läßt sich privat nicht mehr richtig leben.“[5] Was vor dem überwältigenden Hintergrund des NS-Terrors und der „vollendeten Sinnlosigkeit“ totalitärer Herrschaft gegolten hat, gilt auch in Anbetracht des schleichenden, nun schon galoppierenden Regimewechsels von freiheitlichen Demokratien in Auto- und Plutokratien. Man kann ihnen widerstehen.
Fußnoten
- Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, in: ders., Gesammelte Schriften, Band 4, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main 1997, S. 42.
- Martin Seel, Adorno und das falsche Leben, in: Philosophie Magazin, 18.9.2014, https://www.philomag.de/artikel/adorno-und-das-falsche-leben, [meine Hervorhebungen CL]
- Ferdinand Sutterlüty / Almut Poppinga (Hg.), Verdeckter Widerstand in demokratischen Gesellschaften. Frankfurt am Main / New York 2022. Interessanterweise fällt die Inkubationszeit des Projekts in die Zeitspanne der Covid19-Pandemie, die zahlreiche Akte individuellen und kollektiven Widerstands hervorbrachte, dazu Sven Reichardt (Hg.), Die Misstrauensgemeinschaft der „Querdenker“. Die Corona-Proteste aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive, Frankfurt am Main 2021 und Carolin Amlinger/ Oliver Nachtwey, Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus, Berlin 2022; auch Ferdinand Sutterlüty / Vera King / Katarina Busch / Mardeni Simoni, Triumph des Misstrauens. Normalisierte Spaltungen in der Coronakrise, in: Psyche 77 (2023), 12, S. 1049‒1073.
- Theodor W. Adorno, Probleme der Moralphilosophie [1963], hrsg. von Thomas Schröder, Frankfurt am Main 2010, S. 248
- Theodor W. Adorno-Archiv, Ts 2208, zit. nach Recherche, in: Zeitung für Wissenschaft (2009), 4, S. 3.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Jens Bisky.
Kategorien: Affekte / Emotionen Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Kritische Theorie Zivilgesellschaft / Soziale Bewegungen
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Universelle und strukturelle Vulnerabilität
Rezension zu „Universalismus von unten. Eine Theorie radikaler Gleichheit“ von Jule Govrin
Die Klimaanlage des bürgerlichen Selbst
Rezension zu „Bürgerliche Kälte. Affekt und koloniale Subjektivität“ von Henrike Kohpeiß
