Conrad Lluis | Rezension | 15.10.2025
Universelle und strukturelle Vulnerabilität
Rezension zu „Universalismus von unten. Eine Theorie radikaler Gleichheit“ von Jule Govrin
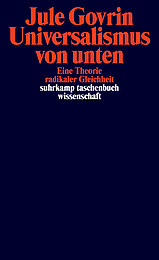
Agua! (Wasser!) – der omnipräsente Ruf auf den Straßen und an den Stränden Barcelonas wurde zum Slogan des ersten antirassistischen Laufs am 1. Juni 2025, den der Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, so der Name der Bottom-up-Gewerkschaft der Straßenverkäufer:innen, veranstaltete.[1] Die als Manteros oder Top Manta bekannten Afrikaner:innen,[2] die in der Regel ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Spanien leben, organisieren sich seit zehn Jahren, um Aufenthaltsrechte einzufordern, polizeiliche Gewalt anzukreiden und ihre Arbeit in Wert zu setzen. „Es dreht sich nicht nur ums Rennen. Wir möchten zeigen, dass es uns gibt – und dabei das Wachstum der extremen Rechten und die repressiven Gesetze an den Pranger stellen“, so Lamine Bathily, der Sprecher der Gewerkschaft, in einem Radiointerview.[3]
Das Engagement der Manteros wäre ein Paradebeispiel für das Anliegen, das Jule Govrin, Autorin, politische Philosophin und derzeit Gastprofessorin an der Uni Hildesheim, in ihrer jüngsten Monografie Universalismus von unten. Eine Theorie radikaler Gleichheit verfolgt. Aus marginalisierten oder unterdrückten Lebensformen können Prozesse der kollektiven Ermächtigung entstehen, mehr noch: Es kann sich ein normativer Horizont eröffnen, der über die konkreten Anliegen einzelner Gruppen hinausweist. Ganz in Kontinuität zu früheren Veröffentlichungen Govrins wie Behrenswert (2023) und vor allem Politische Körper (2022) ist Universalismus von unten also ein politisches Buch.
Das Phänomen der Mantero-Gewerkschaft illustriert die zentrale These von Universalismus von unten: „Sie besagt, dass solidarische Praktiken zu egalitären Körperpolitiken werden, sobald sie sich gegen strukturelle Verwundbarmachung wenden und ein Wissen universeller Verwundbarkeit hervorbringen, so dass Gleichheit gelebte, prekäre Praxis sichtbar wird. Solche Formen der solidarischen Sorge und gelebten Gleichheit lassen sich als Anzeichen eines Universalismus von unten auffassen.“ (S. 14) Auf das Beispiel angewendet: Die Manteros problematisieren ihren vulnerablen Zustand hinsichtlich ihrer Aufenthaltstitel, Unterkunft oder Arbeitspraxis und fordern ihre Gleichstellung gegenüber dem Rest der Gesellschaft sowie die Eindämmung rechtsextremer und autoritärer Tendenzen. Damit erheben die Straßenverkäufer:innen, so lässt sich mit Govrin unterstreichen, ihre Stimme nicht nur für ihre eigenen Anliegen, sondern artikulieren eine potenziell universelle Forderung nach Gleichheit. Dass diese Anliegen während des Top Manta Race auch noch in und durch das Zusammentreffen von gemeinsam rennenden, schwitzenden und später jubelnden Körpern transportiert werden, sähe Govrin als Beleg dafür, dass sich eine derartige Dynamik nicht als nur mediales Narrativ entfalten kann, sondern auf gelebten Körperpolitiken basieren muss.
In Universalismus von unten verbinden sich in überzeugender Weise drei Theoriestränge, die in der bisherigen Debatte weitgehend isoliert nebeneinander herliefen, wenn nicht sogar auseinanderliefen. Da steht an erster Stelle das, was seit der Jahrtausendwende in der Tradition von Spinoza und Deleuze als Affekttheorien verhandelt wird. Hier ist die somatische Dimension zentral, die affektgeladene Bindung der (nicht nur) menschlichen Körper gilt als eine gleichsam vordiskursive Intensität, die neue Assoziationen, ja Assemblagen herstellt. Diese Vorstellung von Körper(n) verbindet Govrin, zweitens, mit historisch-materialistischer Kapitalismuskritik. Dafür fungiert freilich weniger Karl Marx als Gewährsmann, vielmehr referiert die Autorin auf Michel Foucaults Konzept der Biopolitik sowie auf die feministische politische Ökonomie mit ihrem Fokus auf eine differenzielle Ausbeutung, die rassifizierte und vergeschlechtlichte Körper in kapitalistische Verwertungsprozesse einbindet. Der dritte Theoriestrang ist schließlich die radikale Demokratietheorie. Im Rückgriff auf Jacques Rancière macht sich Govrin daran, entlang verschiedenster Phänomene „das Aufbrechen der Gleichheit“ (Rancière) als eine gelebte Praxis zu rekonstruieren. Hier räsoniert Govrin auffallend ähnlich wie Ernesto Laclau: Politische Logiken bewegen sich von der Partikularität zur Universalität.[4] Wie bei Laclau, so bleibt auch bei Govrin diese Bewegung insofern unvollkommen, als jede Vulnerabilität in letzter Instanz partikulare Spuren behält, weil sich die spezifische Verwundbarkeit und konkrete Verletzung dieser Körper niemals ganz überwinden lassen.
Die drei Stränge – Affekttheorie, Kapitalismuskritik und radikale Demokratietheorie – erweisen sich in ebendieser Reihenfolge als Subtext der drei großen Kapitel des Buches: „I. Körper“ (S. 33–121), „II. Ökonomie“ (S. 125–275) und „III. Gleichheit“ (S. 279–458). Die analytische Stärke von Universalismus von unten liegt darin, diese drei Theorietraditionen nicht nur additiv aufzuzählen. Besonders eindrücklich glückt die angestrebte Verbindung dort, wo Govrin über Schuldenbeziehungen spricht. In einer finanzialisierten Wirtschaft würden, so ihre Argumentation, Schulden zu einem zusehends subjektivierenden Phänomen, sie bringen Schuldner:innen als abhängige und – im Sinne Govrins – verwundete Subjekte hervor (S. 196–280). Der (drohende) Verlust von Wohnraum und die Isolierung im Privaten bedrohen ihre physische Existenz, wodurch gerade Frauen „unter die patriarchale Verfügungsgewalt“ ihrer oft „gewalttätigen Partner“ gerieten (S. 250). Eine Schuldenökonomie verletzt folglich Körper, sie schafft Lebensformen, die sich vor allem durch Deprivation auszeichnen. Zugleich zeigt Govrin entlang von Phänomenen wie der in Argentinien gegründeten Frauenbewegung Ni una menos (Nicht eine weniger) oder der spanischen Plataforma de Afectados por la Hypoteca (PAH, Plattform der Hypothekbetroffenen) auf, wie Schuldenbeziehungen politisiert werden können. Die Aktivist:innen von Ni una menos wenden sich gegen Feminizide genauso wie gegen ein Leben in der Verschuldung (S. 395–405), die über 200 PAH-Versammlungen in Spanien mobilisieren seit 2008 gegen Zwangsräumungen, Energiearmut und für ein Recht auf Wohnen (S. 405–409).
So originell Universalismus von unten ist, Govrin bleibt doch im Windschatten einer Autorin, deren Einfluss in der – und auf die – Monografie noch etwas transparenter hätte gemacht werden können: Judith Butler. Unschwer lässt sich erkennen, wo und wie oft Govrins Gedankengänge denen von Butler folgen. Letztere fokussiert seit den 2000er-Jahren – in verschiedenen Schattierungen – jene Spannung zwischen Prekarität und Politisierung,[5] um die sich auch Universalismus von unten dreht. Besonders deutlich wird dies bei Govrins zentralem Begriffspaar: „universelle Verwundbarkeit“ und „strukturelle Verwundbarmachung“. Ersteres bezeichnet eine „allgemeine Grundbedingung“ der menschlichen Existenz, nämlich gegenüber einer Um- und Mitwelt „verwundbar“ und zugleich von dieser „abhängig zu sein“ (S. 326). Demgegenüber zielt die strukturelle Verwundbarmachung darauf, „analytisch die Prekarisierungsprozesse [zu erfassen], die in ökonomischen Ungleichheitsstrukturen entstehen“, etwa durch unzureichende Löhne, verletzte Arbeitsrechte oder durch die Kategorisierung als eine zugleich marginale und handlungsunfähige „vulnerable Gruppe“. Vulnerable Gruppen seien wohlgemerkt auf den Schutz jener äußeren Entitäten (etwa des Sozialstaates) angewiesen, die zugleich ihre Vulnerabilität (mit-)produzierten (S. 326 f.). Anders gesagt: Wir sind alle vulnerabel (= universelle Verwundbarkeit), aber manche werden vulnerabler als andere gemacht (= strukturelle Verwundbarmachung).
Butler begreift Vulnerabilität als basale Abhängigkeit und damit als anthropologische Grundkonstante sowie sozialontologisches Faktum. Prekarität hingegen gilt ihr als besonders zugespitzte, dysfunktionale Abhängigkeit – sie bleibt ein reversibler Zustand.[6] Govrin macht durchaus kenntlich, dass Butler das Konzept der Vulnerabilität bereits ausgearbeitet hat. In der Folge hätte sie den analytischen Mehrwert ihrer Begriffe gegenüber denen Butlers deutlich klarer herausstreichen müssen.
Ihrem Vorbild Butler auch in dieser Hinsicht folgend, versteht sich Govrin als politische Denkerin – ihr geht es um die explizit politische Transformation von Prekarität/struktureller Verwundbarmachung zu einer performativen Praxis, die auf die Überwindung von Verletzlichkeiten und auf gelebte Gleichheit zielt. Durch die Auseinandersetzung mit Bewegungen wie Ni una menos und PAH will Govrin die Politisierung dieser Vulnerabilität ins Zentrum ihres Buches rücken. Dabei buchstabiert sie ihre Gedanken zu den politischen Implikationen und Konsequenzen viel präziser als Butler aus. Normative Gegenentwürfe seien nicht allein in ihrer „Präsenz, Performanz und Ereignishaftigkeit“ (S. 345) zu erfassen, man müsse sie vor allem als langsame Praxisabläufe begreifen und darstellen. Govrins Begriff der affektiven Gegenhabitualisierung (S. 390–409) zeigt eine Möglichkeit auf, wie Butlers Performativitätsbegriff praxeologisch weitergedacht werden kann.
Es bleibt die Frage: Besteht bei Govrin nicht derselbe aktivistische Bias wie bereits bei Butler? Die empirischen Beispiele, die Govrin zur Veranschaulichung ihrer Argumentation anführt, arbeiten vorwiegend Protestphänomene aus Lateinamerika und Spanien auf, hier finden sich für Teile des deutschsprachigen Publikums sicherlich neue Aspekte und Ansätze. Gleichzeitig besteht die Gefahr, diese Bewegungen zu idealisieren, denn auch deren Erfolge blieben (leider) überschaubar: Trotz des beharrlichen Aktivismus der PAH sind Zwangsräumungen in Spanien bis heute ein Massenphänomen, trotz des Engagements von Ni una menos schaffte es Ende 2023 mit Javier Milei in Argentinien ein rechtsradikaler Libertärer an die Spitze der Regierung. Govrin konzentriert sich auf Bewegungen, die auf eine andere, nämlich radikaldemokratische Ordnung zielen. Und doch wäre zu monieren: So suggestiv diese dezidiert normative Leseart auch sein mag, sie läuft Gefahr, eine soziale Realität zu verkennen, die derzeit mehrheitlich nicht im Zeichen emanzipatorischer Veränderungen steht. So zeigt Govrins Buch zu wenig Aufmerksamkeit für die Beharrlichkeit einer (vertieften) Vulnerabilität: Wer in der Prekarität lebt oder eben, mit Govrin, unter einer strukturellen Verwundbarmachung leidet, kommt aus diesem Zustand oft nicht mehr heraus. „Wir müssen jeden Tag laufen, und zwar weg von der Polizei. Wir rufen dann Agua! [Wasser!], um uns zu warnen.“[7] Dieses Zitat eines Manteros macht implizit auch kenntlich: Vor der Prekarität lässt sich nur schwer dauerhaft weglaufen.
Am Ende lässt sich festhalten, dass Universalismus von unten ein wohl aus der Zeit gefallenes und doch gerade deshalb lesenswertes Buch ist. Es geht darin weniger um die „dunkle Seite“ der Vulnerabilität,[8] vielmehr lässt sich das utopische Potenzial, das in unserer geteilten Vulnerabilität steckt, gemeinsam mit der Autorin instruktiv, anschaulich, gar beschwingt ausloten.
Fußnoten
- Primera Cursa Antiracista de Barcelona [17.9.2025].
- Zu Deutsch: „Deckenverkäufer“, weil sie – ohne Genehmigung – Sportartikel, Modeaccessoires oder Lebensmittel auf Tüchern im öffentlichen Raum verkaufen. So können sie ihre Ware schnell zusammenraffen, sobald die Polizei kommt.
- Cursa Antiracista de Barcelona [17.9.2025], Interview in RNE 4, 27.5.2025.
- Ernesto Laclau, Emanzipation und Differenz, übers. von Oliver Marchart, Wien 2002.
- Butler konzentrierte sich vor allem in den Nullerjahren auf verletzte Lebensformen: dies., Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence, London 2004. Zuletzt beschäftigte sie sich eher mit der Politisierung von Vulnerabilität: dies., Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung, übers. von Frank Born, Berlin 2016; dies., In welcher Welt leben wir, hrsg. von Peter Engelmann, übers. von Kianush Ruf, Wien 2022.
- Conrad Lluis, Ein verletzliches Leben. Vulnerable Existenzweisen, performative Praktiken und ihre politische Beziehung [17.9.2025], in: Zeitschrift für Soziologie 54 (2025), 1, S. 132–147, hier S. 134 ff.
- Meine Übers., C.L.; online unter: https://vimeo.com/1071852483?share=copy [17.9.2025].
- Dazu Stephan Lessenich, Abwertung, Alterisierung, Ausbeutung. Die dunkle Seite der Vulnerabilitätspolitik, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 22 (2025), 1, S. 127–138.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Affekte / Emotionen Demokratie Feminismus Kapitalismus / Postkapitalismus Körper Politische Ökonomie Zivilgesellschaft / Soziale Bewegungen
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Es gibt ein richtiges Leben im falschen
Rezension zu „Widerstehen. Versuche eines richtigen Lebens im falschen“ von Ferdinand Sutterlüty
