Andreas Arndt | Rezension | 07.10.2025
Etwas Besseres als den Optimismus finden wir überall
Rezension zu „Etwas Besseres als der Optimismus“ von Guillaume Paoli
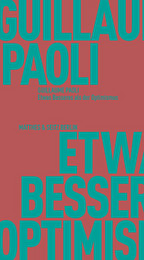
„Optimismus ist Pflicht!“, so verkündete es Sir Karl Popper, und so wird es bis heute in unzähligen Varianten wiederholt. Das klingt verständlich und respektabel, scheint es doch nur zu meinen, man solle Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen und nicht frühzeitig aufgeben. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine höchst widersprüchliche Forderung, denn unbedingt, wie es die Formulierung suggeriert, kann die Pflicht nicht sein, wenn sie nicht zur schalen Durchhalteparole in aussichtslosen Situationen verkommen soll. Solche Widersprüchlichkeit, so die Grundthese des vorliegenden Essays, ist aber bereits dem Begriff des Optimismus eingeschrieben – auch ohne Poppers Ermahnung zur Pflicht, die, so Paoli, gerade in Deutschland, wo „das Pflichtbewusstsein ganz schnell in Fanatismus ausarten kann, [...] wie eine kaum verborgene Drohung“ klinge (S. 8).
Gewöhnlich wird der Optimismus dem Pessimismus entgegengesetzt, und so ist wohl auch der Aufruf zum Optimismus in erster Linie gemeint: Man solle sich nicht durch Schwarzmalerei lähmen lassen. Paoli bestreitet diese Entgegensetzung jedoch grundlegend: „Wenn ich mich [...] gegen den Optimismus aussprechen werde, dann nicht um pessimistisch zu argumentieren. Es geht darum, dieser Alternative ihre Relevanz in Bezug auf ein Urteil über die Welt abzuerkennen.“ (S. 9) Ein Blick auf die Begriffsgeschichte (S. 10–18) soll dies deutlich machen. Der Begriff „Optimismus“ wurde 1737 von dem Jesuiten und Mathematiker Lois-Bertrand Castel (1688–1757) in einer Kritik der Leibniz’schen Theodizee geprägt; er richtete sich demnach gegen Leibniz’ Auffassung, wonach die bestehende Welt als die bestmögliche, also als das Optimum anzusehen sei. In diesem Sinne, so Paoli, sei der Gegner des Optimisten „nicht so sehr der Pessimist [...], als vielmehr der Maximalist oder Utopist, zumindest jemand, der eine bessere Welt als die bestehende für möglich hält.“ (S. 11) Dies erklärt, nebenbei gesagt, auch den Titel des Büchleins: Besser als das vom Optimismus verklärte Bestehende könnte eine mögliche andere Welt sein. Castel wandte sich gegen diese als Theodizee vollzogene Verklärung, weil er Gott nicht auch das Böse in der Welt zuschreiben und die Menschen mit ihrem freien Willen nicht von der Entscheidung zwischen Gut und Böse entlasten wollte. Wäre die bestehende Welt das Optimum, dann hätten die Menschen keine Freiheit, sondern alles würde naturgesetzlich-kausal ablaufen, kurz: Der Optimismus ist eigentlich eine fatalistische Sicht auf Mensch und Welt (S. 13.). Beides – und damit die Alternative von Optimismus und Pessimismus – schließt Castel aus: „Ihm ist die Idee eines zwangsläufigen Fortschritts ebenso fremd wie die eines zwangsläufigen Untergangs. Wäre das Ergebnis nicht offen, wäre die Ausübung des Willens nicht frei.“ (S. 16)
Paoli eruiert die heutige Bedeutung dieser Konstellation, indem er ausdrücklich die Debatten des 18. Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellt, denn die Konzepte des 19. Jahrhunderts („Sozialismus, Liberalismus, Kolonialismus, Rassismus, Individualismus“) hätten „ein Trümmerfeld des Begehrens“ hinterlassen und „ausgedient“: „Darum mag es vielleicht hilfreich sein, sich auf das achtzehnte zurückzubeziehen“, also das Projekt der Aufklärung jenseits der Ismen des 19. und ihres Scheiterns im 20. Jahrhundert neu zu denken (S. 18). Die Theodizee wird hier zur „Oikodizee“, wie Joseph Vogl den Glauben an die unsichtbare Hand genannt hat, die im Wirtschaftsleben alles zum Guten wendet; an ihr zeige sich eindringlich der Zusammenhang von Optimismus und Fatalismus, der zur Unterwerfung unter das Gegebene führe (S. 19 f.). Hier identifiziert Paoli den „dialektischen Knackpunkt der ganzen Problematik: In Wahrheit fußt der Gedanke der Optimierung auf anthropologischem Pessimismus.“ (S. 20) Dieser Pessimismus bestimme auch die Auffassung des Optimums: Da, vor allem auf Grundlage der Erfahrungen der Religionskriege, die conditio humana für eine ideale Gesellschafts- und Staatsordnung nicht tauglich zu sein schien, wurde das Optimum im Vergleich mit dem absolut Bösen bestimmt (S. 21) – getreu den Versen aus Wilhelm Buschs Die fromme Helene: „Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Böse, das man lässt.“ Das Optimum ist das kleinere Übel. Das heißt aber auch: Etwas Besseres als den Optimismus können wir überall finden – wenn wir denn den Blick auf die Möglichkeit einer Veränderung zum Guten richten.
Das zweite Kapitel analysiert vor diesem Hintergrund exemplarisch Bernard Mandevilles Bienenfabel (zuerst 1714). Mandeville behauptet, dass private Laster und nicht Tugenden die allgemeine Wohlfahrt förderten, was letztlich zu der Konsequenz führe, dass Übel nicht nur hingenommen, sondern im Interesse der Optimierung sogar gefördert werden müssten (S. 24). Jeder Versuch hingegen, die egoistischen Triebe im Interesse einer gerechten Ordnung gesellschaftlich einzuhegen, könne nur in Diktatur und Unrecht enden (S. 26). Mandeville nehme damit das Credo des marktradikalen Liberalismus vorweg und es sei kein Zufall, dass Friedrich August von Hayek sich auf ihn berufe: „Die ganze neoliberale Ideologie ist nichts anderes als ein pseudowissenschaftlicher Abklatsch der Bienenfabel.“ (S. 29) Die Entwertung der Moral – Laster statt Tugend als Motor der Gesellschaft – gilt freilich nicht allgemein: „Für die Arbeiterbienen bleibt das moralische Imperativ unverändert: Schufte hart, wähle gut und halt die Klappe.“ (S. 30) Als Kritiker des in der Bienenfabel zugrunde gelegten anthropologischen Pessimismus führt Paoli Jean-Jacques Rousseau an, der infrage gestellt habe, dass die Menschen von Natur aus egoistisch seien. Rousseau sei weder Optimist noch Pessimist, aber er gehe von der „Vervollkommnungsfähigkeit der Individuen und der Gattung“ aus (S. 31).
Das dritte Kapitel stellt dann einen weiteren Provokateur der Aufklärung in den Mittelunkt: Julien Offray de La Mettrie und sein skandalträchtiges Werk Der Mensch als Maschine (1748), das insbesondere aufgrund seiner atheistischen Konsequenzen angegriffen wurde. Paoli weist überzeugend darauf hin, dass La Mettrie in diesem Werk weniger mechanistisch argumentiert, als es vom Titel her erscheinen mag (S. 51). Tatsächlich sah ja auch Leibniz in der menschlichen Seele eine Art geistigen Automaten, ohne deshalb skandalisiert zu werden. Galten Automaten ursprünglich als Nachahmungen des Menschen, so gelte eben jetzt der Mensch als „Verkörperung des Automaten“ (S. 50). Paoli nimmt dies zum Anlass, sich ausführlicher mit den Problemen der Künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen. Die Auffassung, Supercomputer könnten das menschliche Denken ersetzen, sei bereits aus La Mettries Sicht falsch, da für ihn das Denken „tief in der sinnlichen Erfahrung verwurzelt und mithin von unserer organischen Verfassung bestimmt“ sei (S. 53). Die Befürchtung, die KI könnte sich verselbständigen und eigene Ziele auch gegen die Menschheit verfolgen, zeuge „nicht von einer überlegenen Intelligenz der Maschine, sondern von einer erhöhten Manipulierbarkeit ihrer Nutzer“ (S. 56). Die KI, so Paoli, sei im Grunde „ein System der freiwilligen Selbsttäuschung“ (S. 59) und diene der scheinbar objektiven Bestätigung eigener Positionen. Prognostisch eingesetzt könne sie immer nur Wahrscheinlichkeiten aufzeigen, jedoch gelte dabei: „Wichtig ist nicht die statistische Wahrscheinlichkeit, sondern wie man sich zu ihr verhält.“ (S. 61) Hier kommt wieder die Freiheitsproblematik ins Spiel, welche die Alternative Optimismus vs. Pessimismus als Schein erweist.
Das vierte Kapitel bezieht sich von dorther auf das Freiheitsverständnis Rousseaus, der „die Idee der Freiheit säkularisiert“ habe (S. 67). Seine Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (1755) beschäftige sich nicht mit einer überzeitlichen condition humana, sondern mit der bestehenden Gesellschaft, die darum auch als veränderbar erscheint (S. 72). Optimismus und Pessimismus leugneten – letztlich nur mit unterschiedlichen Vorzeichen – dieses Veränderungspotenzial, für welches es darauf ankomme, sich (wenn auch ohne Garantie des Erfolgs) frei zu den objektiven Möglichkeiten verhalten zu können. Nicht das vermeintliche Wissen um den notwendigen Verlauf der Geschichte ist leitend, sondern das Träumen (S. 77 f.). Fast möchte man hier Ernst Blochs Parole des „Träumens nach vorn“ wiedererkennen. Wie bei Bloch entspringt auch Paolis Träumen keiner bodenlosen Phantasie, sondern Erfahrungen der Realität. Paoli zitiert zum Schluss des Kapitels Ignaz Paul Vitalis Troxler: „Freilich gibt es eine andere Welt, aber sie ist in dieser“ (S. 79).
Den Abschluss bildet, als „Anhang“ deklariert, ein Traktat über „Die Optimierung des Tötens“, der in Bezug auf das Töten das absolut Böse mit dem kleineren Übel konfrontiert, also die Konstellation der Bestimmung des Optimums durch das kleinere Übel an einem Fall von höchster moralischer Brisanz durchspielt. Hierfür steht einerseits Auschwitz – der ohne moralische Skrupel organisierte Massenmord – und andererseits Hiroshima, denn die „Väter“ der Bombe waren so voll Skrupel, dass sie in der Bombe nur ein notwendiges Übel sahen. Allerdings zeigt Paoli im Blick auf die Entwicklung der modernen Kriege bis in die Gegenwart: Die „Idee des kleineren Übels gekoppelt mit dem Streben nach Optimierung“ führe „zur Akzeptanz eines sich steigernden Grades der Entmenschlichung“ (S. 90). Auch hier käme es demnach darauf an, nicht das kleinere Übel, sondern das vielleicht mögliche, eventuell erträumte Gute zum Ziel des Handelns zu machen.
Paolis Buch ist ein glänzender Essay über die Widersprüchlichkeit und Abgründigkeit des Optimismus, der das hintertreibt, was er verspricht: Eine bestmögliche Welt. Es ist damit zugleich eine Abhandlung über die Widersprüchlichkeit und Abgründigkeit der Moderne, die von diesem Versprechen lebt, ohne es einlösen zu können, den Optimismus aber gleichwohl zur Pflicht macht, um das Bestehende zu verklären. Die Rede von der Alternativlosigkeit zu dem, was ist, soll mit den gegenwärtigen Übeln versöhnen, statt es an dem zu messen, was objektiv möglich wäre. Paoli treibt solche Auffassungen – um mit dem Hegel der Phänomenologie zu sprechen – auf den Weg der Verzweiflung und leistet damit das, woran es den Diskursen der Gegenwart zumeist fehlt: Aufklärung zu gewinnen über die Voraussetzungen des eigenen Redens und Tuns.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Digitalisierung Gesellschaft Militär Moderne / Postmoderne Philosophie Politik Politische Theorie und Ideengeschichte
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Die unterschwellige Tradition der philosophischen Anthropologie
Fünf Fragen zur Rezeption Helmuth Plessners in Frankreich
Anna-Maria Kemper, Hannah Riede
Formwandel der Demokratie
Tagung der DVPW-Sektion "Politische Theorie und Ideengeschichte", Universität Trier, 29.-31. März 2017
Welthistoriker und Staatssoziologe – Otto Hintze neu entdeckt
Rezension zu „Otto Hintze. Werk und Wirkung in den historischen Sozialwissenschaften“ von Hans Joas und Wolfgang Neugebauer (Hg.) sowie zu „Otto Hintzes Staatssoziologie. Historische Prozesse, theoretische Perspektiven“ von Andreas Anter und Hinnerk Bruhns (Hg.)
