Georgia Stefanopoulou | Rezension | 05.11.2025
Recht auf Knopfdruck?
Rezension zu „Können Maschinen Rechtsfälle entscheiden?“ von Diogo Sasdelli
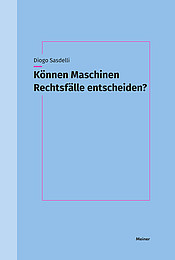
„Menschen machen Fehler, Maschinen nicht“, so lautet eine verbreitete Sichtweise, deren Ursprünge sich bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen lassen.[1] Die Technikhistorikerin Martina Heßler spricht in ihrem jüngst erschienenen Buch Sisyphos im Maschinenraum mit Blick auf die Vorstellung von dem Menschen überlegenen Maschinen sogar von einer regelrechten Obsession der mechanischen Moderne.[2] Diese Obsession ist für Heßler Ausdruck eines „tiefsitzenden Technikchauvinismus“:[3] Maschinen arbeiteten zuverlässiger, berechenbarer und rationaler als Menschen, sie seien eine Garantie für weniger Fehler und Irrtümer in der Welt.[4] Diese sich hartnäckig haltende Vorstellung von der unfehlbaren Maschine, die den technischen Fortschritt ebenso wie die gesellschaftliche Entwicklung bis heute begleitet, ist nicht ohne Einfluss auf die Rechtswissenschaft geblieben. So wird in juristischen wie nicht juristischen Foren immer wieder die Frage diskutiert, ob Richter:innen durch rechtsprechende Maschinen abgelöst werden können. Würde man denken, dass der perfekte Rechtsautomat eine Illusion, eine Fantasievorstellung ist, die ins Reich der Science Fiction gehört, wäre die Häufigkeit, mit der das Thema seit einigen Jahren vor allem unter Jurist:innen diskutiert wird, nicht zu erklären. Viele hielten den selbstlernenden Rechtsautomaten bereits für Realität und den Einsatz von Subsumtionsautomaten nur noch für eine Frage der Zeit (S. 20). Und ganz abwegig scheint die Vorstellung nicht: Allein welche „rechtsberatenden“ Leistungen ChatGPT mittlerweile erbringen kann, ist in der Tat erstaunlich.
Die genannten Entwicklungen und die sie begleitenden Diskussionen scheinen Fachleute im Hinblick auf die Zukunft des eigenen Berufsstandes zu verunsichern. „Kann die KI einen Anwalt ersetzen?“[5] oder „Richter-Roboter: Ersetzt KI bald unsere Juristen?“[6] sind typische Titel von jüngeren Beiträgen in verschiedenen Diskussionsforen. Kritiker:innen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rechtswesen haben lange argumentiert, der KI fehle es an der für die Aufgabe der Rechtsfindung notwendigen Kreativität und Empathie. Mittlerweile gerät das Argument allerdings unter Druck, heißt es doch, KI könne trainiert werden, empathische Entscheidungen zu treffen. ChatGPT selbst scheint jedenfalls dieser Meinung zu sein. Darauf deutet zumindest die Antwort hin, die das Programm den Autor:innen eines LTO-Beitrags[7] zum Thema Empathie gegeben hat:
„Als künstliche Intelligenz habe ich keine Emotionen oder Empfindungen wie ein menschliches Wesen. Ich wurde jedoch entwickelt, um auf bestimmte Weise zu reagieren, um menschenähnliche Antworten zu geben, die auf den Eingaben basieren, die ich erhalte. […] Während ich nicht wirklich empathisch bin, kann ich eine gewisse emotionale Intelligenz aufweisen, um eine angemessene und empathische Antwort zu geben.“[8]
Auch was das Merkmal der Kreativität betrifft, kommen bei einigen Beobachter:innen mittlerweile Zweifel auf, ob KI nicht doch rechtsschöpferisch tätig werden könne. „Nicht einmal Rechtsfortbildung muss notwendigerweise jenseits dessen liegen, was ein Computer leisten kann. Der Einwand von Technologiekritikern, Computer könnten wahrhaft Neues nie erschaffen, wiegt allenfalls in der Kunst schwer, nicht aber im Recht. Keine gute Rechtsfortbildung verkörpert wahrhaft Neues; sie besteht so gut wie immer darin, aus Prämissen, die sonst in der Rechtsordnung bereits Anerkennung gefunden haben, Folgen für einen anderen Sachbereich abzuleiten“, schreibt etwa der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrende Strafrechtler Luís Greco.[9] Greco zweifelt nicht an den fachlichen Kapazitäten des Roboterrichters, sondern an seiner Legitimation.[10] KI könne Wertungen, Intuitionen und Judiz erlernen, sie sei in dieser Hinsicht einer menschlichen Person nicht zwingend unterlegen.[11] Im Unterschied zu dieser trage eine KI allerdings keine Verantwortung für ihre Entscheidungen, weshalb der Einsatz von Roboterrichtern in rechts- und moralphilosophischer Hinsicht nicht zu rechtfertigen sei.[12]
Genau gegen diese Sichtweise argumentiert Diogo Sasdellis ausgesprochen lesenswerte und die Diskussion um KI und Rechtsanwendung bereichernde Untersuchung. Sasdelli, der in der Einleitung seines Buches unter anderem auch auf Grecos Auffassung hinweist (S. 20), stellt gleich zu Beginn seiner Ausführungen klar, dass ihn die praktisch-moralphilosophische Dimension nicht interessiert (S. 21). Der Grund: Er bezweifelt bereits die Grundprämisse der von Greco und anderen aufgeworfenen Legitimationsfrage, nämlich die Realisierbarkeit eines perfekt funktionierenden Rechtsautomaten (ebd.). Der an der Donau-Universität Krems lehrende Autor will zeigen, dass Maschinen Rechtsfälle nicht entscheiden können. Seine Argumentation bezieht sich auf Probleme der Normenlogik und Rechtslogik. Um es vorweg zu nehmen: Indem er Paradoxa der Normenlogik und Besonderheiten in Schlussmustern der etablierten juristischen Methodenlehre aufzeigt, liefert er Jurist:innen gute Gründe, sich vom Gespenst der rechtsentscheidenden Maschine nicht verunsichern zu lassen. Für „Technikchauvinismus“ (Heßler), zumindest im Bereich der Rechtsfindung- und -entscheidung, lässt seine Argumentation nicht viel Raum.
Zwei Leitfragen stehen im Zentrum von Sasdellis Untersuchung: die Herleitungsfrage und die Verkündungsfrage, wie er sie nennt (S. 25, 207). Diese beiden Fragen sollen dem Umstand Rechnung tragen, dass die Entscheidung eines Rechtsfalles aus zwei Akten bestehe, der Rechtsfindung und dem Urteilsspruch (S. 24). Die Rechtsfindung ist Sasdelli zufolge mit der Herleitungsmethode gleichzusetzen, mit der ein Rechtsurteil aus den Normen der geltenden Rechtsordnung abgeleitet wird (S. 25). Für die Frage, ob Maschinen Rechtsfälle entscheiden können, müsse zunächst geklärt werden, ob die Herleitungsmethode der Rechtsfindung auf einen rekursiven Vorgang reduziert werden kann, das heißt auf einen Algorithmus (Herleitungsfrage). Was den Akt des Urteilsspruchs betrifft, gehe es um die Verkündung des Ergebnisses der Rechtsfindung, die, wie Sasdelli erklärt, durch eine rechtsprechende Autorität erfolgen müsse. Daraus ergebe sich die zweite Frage (Verkündungsfrage): Lässt sich auch die Verkündung des Ergebnisses der Rechtsfindung auf einen Algorithmus reduzieren?
Der Beantwortung der Herleitungsfrage ist der erste Teil der Untersuchung gewidmet. Da „terminierende“ Maschinen (Turing-Maschinen mit endlich vielen Schritten) zu logischen Kalkülen als rekursiven Vorgängen äquivalent seien und die Entscheidung eines Rechtsfalles mit der Herleitung von Normen aus anderen Normen zusammenhänge, sei die Möglichkeit einer rechtsprechenden KI äquivalent zur Möglichkeit eines Kalküls der Normenlogik (S. 21). Die Herleitungsfrage sei daher erst dann positiv zu beantworten, das heißt die Herleitungsmethode lasse sich erst dann auf einen Algorithmus reduzieren, wenn eine sinnvolle Normenlogik aufgebaut werden kann. Diese Prämisse ist Sasdellis Ausgangspunkt (ebd.) und zugleich der Ansatzpunkt seiner Kritik. Denn ein sinnvoller Kalkül der Normenlogik ist ihm zufolge nicht möglich. Als Hauptproblem nennt Sasdelli hier das sogenannte Jørgensen-Dilemma: Demnach ist die Natur der Logik mit der Natur des Normativen unvereinbar, weil das Normative nicht wahr oder unwahr sein kann (S. 39 f.). Versuche, das Problem zu umgehen und eine Logik des Normativen durch Verzicht oder Modifizierung von Grundeigenschaften der Aussagenlogik zu begründen, führten, wie Sasdelli im ersten Teil seiner Untersuchung detailliert ausführt, zu normenlogischen Paradoxa (S. 21 f., 207). Sasdelli kommt zu dem Ergebnis, dass es keine sinnvolle Möglichkeit gebe, die normative Intuition auf einen Kalkül zu reduzieren. Dies sei ein starkes Indiz dafür, dass die Antwort auf die Herleitungsfrage negativ ausfallen muss (S. 210). Lasse sich die Rechtsfindung nicht auf einen Kalkül reduzieren, dann sei sie auch nicht auf einen Algorithmus zurückzuführen.
Gleichwohl, so Sasdelli, argumentierten Jurist:innen mit Normen, zögen aus ihnen Schlüsse und begründeten ihre Argumente. Wäre dem nicht so, stellte die Urteilsfindung einen bloßen Willkürakt dar (S. 210). Die Praxis des Rechts zeige daher, dass Jurist:innen sich doch „einer gewissen Logik“ bedienen (ebd.). Diese „gewisse Logik“ des Normativen untersucht Sasdelli im zweiten, mit „Rechtslogik“ überschriebenen Teil seiner Untersuchung. Im Fokus steht hier die Anwendung des Rechts. Sasdelli argumentiert, dass die Rechtsfindungsmethode im juristischen Alltag unter zwei Voraussetzungen auf einen logischen Kalkül beziehungsweise einen Algorithmus reduziert werden könne: wenn die Normen semiotisch aufgefasst würden, das heißt als sprachliche Gebilde, wie es die klassische Aussagenlogik verlangt, oder wenn das Recht überhaupt kalkülisierbar wäre (S. 216 f.). Beide Voraussetzungen sind dem Autor zufolge nicht erfüllt. Die Rechtsnormen würden nicht semiologisch erfasst, sondern ontologisch: „[D]ie Geltung von positiven Rechtsnormen [ist] nicht der Wahrheit von Aussagen, sondern vielmehr der Wirklichkeit von Tatsachen analog“ (S. 235). Das Recht sei außerdem nicht kalkülisierbar. Vielmehr gebe es Rechtslücken, Rechtsantinomien und eine „potentiell unendliche Anzahl von Rechtsnormen in einer Rechtsordnung“ (S. 275).
Besondere Aufmerksamkeit schenkt Sasdelli den juristischen Argumentationsmustern, deren logische Qualität er untersucht. Er will zeigen, dass alle Schlussmuster der juristischen Methodenlehre – also der Analogieschluss, der Umkehrschluss, der Erst-recht-Schluss und der juristische Widerspruchsschluss – keine logischen, allgemeingültigen Schlüsse im strengen Sinne sind. Alle beinhalteten ein normativ-wertendes Element (S. 274). Exemplarisch seien hier die Ausführungen zum Analogieschluss betrachtet (S. 242 ff.), der in folgender Weise funktioniert: x ist verboten, y ähnelt x, also ist y auch verboten. Dass dieser Schluss nur scheinbar allgemeingültig ist, macht Sasdelli anhand von zwei Beispielen deutlich. Sein erstes Beispiel: Es ist verboten, einen Haushund in Krankenhäuser mitzunehmen. Als Rechtsfall kommt vor, dass A ein Hausschwein hat und es mit ins Krankenhaus bringt. Wendete man bei der Frage, ob A etwas Verbotenes getan hat, den Analogieschluss an, lautete das Ergebnis: Die Mitnahme des Haushunds ist verboten, die Mitnahme des Hauschweins ähnelt die Mitnahme des Haushunds, also ist auch die Mitnahme des Hausschweines verboten. So weit, so gut. Jetzt aber nennt Sasdelli ein anderes Beispiel. Die bestehende Norm lautet nun: Das Verspeisen von Haushunden ist verboten. A verspeist ein Hausschwein. Ist das Verhalten von A rechtswidrig? Die Ähnlichkeit zwischen Haushunden und Hausschweinen, die im Fall des Krankenhausbesuches für relevant erachtet wird, ist hier offenbar nicht mehr von Bedeutung. Man könne daher, so Sasdelli, von der Norm „Iß nicht den Haushund“ nicht die Norm „Iß nicht das Hausschwein“ ableiten: „Man greift nicht die Ähnlichkeit selbst, die zwischen den Tieren festgestellt wurde, sondern die Relevanz dieser Ähnlichkeit an.“ (S. 246) Die Ähnlichkeitsrelevanz, die das Wesen des Analogieschlusses ausmacht, verlange eine normative, wertende Betrachtungsweise, die mithilfe der symbolischen Logik nicht erfasst werden könne (S. 246 ff.).
In entsprechender Weise zeigt Sasdelli die normativen Momente auch der übrigen Schlussmuster auf. So will er deutlich machen, „dass sich die etablierte juristische Methodenlehre trotz zahlreicher entsprechender Bestrebungen nicht in die Richtung der symbolischen Logik, sondern in die der philosophischen Rhetorik bzw. Topik weiterentwickelt hat“ (S. 35). Auch die Entscheidung, welches Schlussmuster bei einem konkreten Rechtsfall angewandt wird, sei eine normative Entscheidung und damit ein Willensakt der richtenden Person (S. 275). Sasdelli spricht in diesem Zusammenhang von der „volitiven Dimension der Rechtsprechung“ (S. 275). Diese sei der Grund, warum auch die zweite oben genannte Leitfrage, die Verkündungsfrage, negativ beantwortet werden müsse: Maschinen hätten keinen Willen und könnten folglich auch keine Normen setzen und keine Urteile verkünden (S. 284).[13]
Zusammengefasst: Für Sasdelli sind Recht und Rechtsprechung nicht hinreichend logisch, kalkülisierbar und berechenbar, um die Aufgabe der rechtlichen Entscheidungsfindung zuverlässig in einen Algorithmus überführen und an KI delegieren zu können. Hat Sasdelli Recht, wofür seine stringente Argumentation gute Gründe liefert, ist KI schlicht zu logisch, um mit der spezifischen Logik des Rechts zurecht zu kommen. Gute Nachrichten also für alle Jurist:innen: Sie dürfen sich sicher fühlen, sie sind unersetzlich.
Fußnoten
- Martina Heßler, Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie, München 2025, S. 10 ff., 59 ff., 79 ff., 101 ff.
- Ebd., S. 59.
- Ebd., S. 110.
- Vgl. ebd., S. 9.
- Emma Möllenbrock, AnwaltGTP. Kann die KI einen Anwalt ersetzen?, in: Wirtschaftswoche, 05.08.2025.
- Marcus Schwarzbach, Richter-Roboter: Ersetzt KI bald unsere Juristen?, in: Telepolis, 09.10.2025.
- Nadine Lilienthal / Stephan Bücker / Christian Herles, Einfluss von ChatGPT & Co. auf Rechtsberatung und Justiz. Schafft Künstliche Intelligenz die Anwaltschaft ab?, in: Legal Tribune Online, 28.04.2023.
- Ebd.
- Luís Greco, Richterliche Macht ohne richterliche Verantwortung. Warum es den Roboter-Richter nicht geben darf, in: Rechtswissenschaft 11 (2020), 1, S. 29–62, hier S. 37 f.
- Ebd., S. 46 ff.
- Ebd., S. 38.
- Ebd., S. 48 ff.
- Die Verkündungsfrage ist lediglich in Bezug auf die richterliche Tätigkeit zu stellen, die Herleitungsfrage betrifft allerdings auch die Anwaltschaft, da Anwält:innen die richterliche Entscheidung antizipieren müssen.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Digitalisierung Gesellschaft Methoden / Forschung Philosophie Recht Technik Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Empfehlungsschreiben für eine Subdisziplin
Rezension zu „Technikanthropologie. Handbuch für Wissenschaft und Studium“ von Martina Heßler und Kevin Liggieri (Hg.)
Nachgefragt bei der Günther-Anders-Forschungsstelle
Fünf Fragen zur Einweihung, beantwortet von Christian Dries
Ein Werk radikaler Gegenwärtigkeit
Nachruf auf Bruno Latour (1947–2022)
