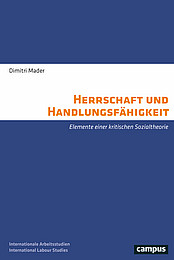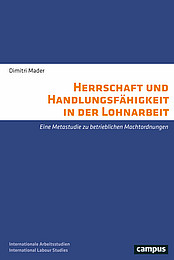Jorin vom Bruch | Rezension | 19.10.2022
Sozialtheorie trifft empirische Arbeitsforschung
Doppelrezension zu „Herrschaft und Handlungsfähigkeit. Elemente einer kritischen Sozialtheorie“ und „Herrschaft und Handlungsfähigkeit in der Lohnarbeit. Eine Metastudie zu betrieblichen Machtordnungen“ von Dimitri Mader
Freiheit ist ein grundlegendes Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft, dessen Verwirklichung sich an den real bestehenden Herrschaftsverhältnissen bemisst. Um eine Kritik an der Einschränkung von Freiheit formulieren zu können, bedarf es der begrifflichen Gegenüberstellung mit Herrschaft, was jedoch in Anbetracht der spätkapitalistischen Subjektivierung von Herrschaft problematisch wird: Der schon etwas in die Jahre gekommene neue Geist des Kapitalismus[1] zielt auf die strategische Einbindung von subjektiven Potenzialen in Arbeitsprozesse[2] und hat – so postuliert es eine Vielzahl arbeitssoziologischer Zeitdiagnosen – das „tayloristische Kommandosystem“[3] der Fabriken abgelöst.
Dimitri Mader unterzieht den paradoxen Befund der „Selbstbeherrschung“[4] von lohnabhängig Beschäftigten einer kritischen Rekonstruktion, um sowohl theoretisch wie empirisch die Persistenz von Herrschaft in der Lohnarbeit zu untersuchen. In zwei Bänden von insgesamt mehr als 800 Seiten legt Mader eine Sozialtheorie von Herrschaft und ihre empirische Erprobung anhand arbeitssoziologischer Fallstudien vor. Seine grundlegende Begriffsarbeit und empirische Kenntnis stellen eine instruktive Synthese von Sozialtheorie und Arbeitsforschung dar und verbinden Perspektiven, die in der Arbeitssoziologie meist getrennt voneinander verhandelt werden.
Übergeordnete Fragen nach zeitgenössischen Formen betrieblicher Herrschaft und den Selbstbestimmungsmöglichkeiten von lohnabhängig Beschäftigten halten die beiden Bände zusammen. Mader verhandelt seine Fragestellung mitunter auf einem hohen Abstraktionsniveau, die Darstellung bleibt jedoch stets dem Interesse an einem operationalisierten Herrschaftsbegriff verpflichtet. Der erste Band legt die begrifflich-theoretische Grundlage der Studie und konzentriert sich auf die Frage, was unter Herrschaft zu verstehen und wie sie empirisch zu untersuchen ist. Mader formuliert aus der Theorieperspektive des Critical Realism eine Sozialontologie von Herrschaft und entwirft mit Bezug auf die Prämissen der kritischen Psychologie von Klaus Holzkamp einen Analyserahmen, welcher im zweiten Band in einer „Metastudie betrieblicher Machtordnungen“ zur Anwendung kommt.
Die Studie ermöglicht einen nach sozialen Klassen und Arbeitsfeldern differenzierten Überblick betrieblicher Sozialbeziehungen, der sowohl durch seine Tiefe als auch durch seinen Umfang besticht.
Im Fokus der gegenstandsbezogenen Metastudie steht die Sekundäranalyse von zwanzig bereits publizierten Betriebsfallstudien aus den späten 1990er-Jahren bis Mitte der 2010er-Jahre, die der Autor systematisch nach Herrschaftsbeziehungen und Handlungsmöglichkeiten in der Lohnarbeit auswertet. Die Studie ermöglicht einen nach sozialen Klassen und Arbeitsfeldern differenzierten Überblick betrieblicher Sozialbeziehungen, der sowohl durch seine Tiefe als auch durch seinen Umfang besticht. Die von Mader gewählte Methode der Sekundäranalyse entfaltet beachtliches Potenzial für eine Arbeitssoziologie, die nach Möglichkeiten der Verallgemeinerung von empirisch gewonnenen Erkenntnissen sucht.[5]
Band I: Die Rehabilitierung des Struktur-Handlung-Dualismus
Mader konstatiert, dass die in der Arbeits- und Industriesoziologie geläufigen Herrschaftskonzepte die Subjektivierung von Arbeit weder präzise erfassen noch adäquat kritisieren können (S. 16). Die Vorstellung von Herrschaft als betriebliche Kontrolle, wie sie in der an Marx orientierten labour process debate vertreten wird, ist ebenso wenig wie eine an Weber orientierte Perspektive, die Herrschaft als ein legitimationsbedürftiges Autoritätsverhältnis versteht, in der Lage, internalisierte Unternehmensanforderungen und scheinbar freiwillige Selbstausbeutung hinreichend zu erklären. Mader erarbeitet sich sein Herrschaftsverständnis im Verlauf des ersten Bandes: Er formuliert in der Auseinandersetzung mit dem klassischen Dualismus von Struktur und Handlung ein sehr grundlegendes sozialtheoretisches Modell von Herrschaft.
Der Autor kritisiert praxeologische Ansätze für ihre vorschnelle Auflösung des Gegensatzpaars Struktur/Handlung und klagt den Wahrheitsgehalt der soziologischen Grundbegriffe ein, der einerseits in der kausalen Erklärungskraft sozialer Strukturen und andererseits in der irreduziblen Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit der Subjekte liege (S. 44). Im Folgenden bezieht sich Mader auf ein Vermittlungsmodell der kritischen Realistin Margret Archer,[6] welches das Verhältnis der beiden Pole als eine transformative oder reproduktive „Wechselbeziehung“ (ebd.) konzipiert. Die analytische Unterscheidung von Struktur und Handlungsfähigkeit ist für die Gesamtargumentation von Maders Studie entscheidend, da sie darauf abzielt, den paradoxen Charakter des Befunds von „Herrschaft durch Autonomie“ zu entwirren und seinen realen Kern – den Wandel von Erwerbsarbeit – empirisch zu prüfen (S. 403–407).
Mader definiert Herrschaft als eine soziale Beziehung, in „der die Freiheit der einen durch die Macht der anderen eingeschränkt ist“ (S. 393). Sie sei nur dann als gesellschaftliche Herrschaft zu verstehen, wenn sie auf einer grundlegend asymmetrischen Machtverteilung beruhe, mit Zwang für die Beherrschten einhergehe beziehungsweise aus Mangel an Alternativen bestünde und auf Dauer gestellt sei (S. 141). Der Autor macht drei sozialstrukturelle Quellen von Herrschaftsverhältnissen aus: Erstens kann Herrschaft auf der Basis von „Interessenskonstellationen“ (S. 390) ausgeübt werden und somit auf der Kontrolle und Verteilung von Ressourcen basieren. Zweitens können normative Erwartungen und Pflichten eine „Herrschaft kraft Autoritätsverhältnis“ begründen und drittens kann „Herrschaft qua Identifizierung“ wirkmächtig und in Sozialcharakteren verankert sein (ebd.). Die Unterscheidung der verschiedenen Machtquellen überführt Mader in ein empirisch überprüfbares Konzept, ohne dass das wesentliche Problem von Herrschaft aus dem Blick gerät: „Herrschaft verletzt per defintionem ein moralisches Prinzip.“ (ebd.)
Damit expliziert der Autor – durchaus unüblich in den Sozialwissenschaften – den normativen Anspruch seiner Untersuchung. Neben der grundlegenden Setzung, dass Herrschaft im Namen einer gleichen Freiheit für alle abzulehnen sei (S. 387), geht Mader davon aus, dass die Beherrschten unter „spezifischen sozialen und subjektiven Bedingungen“ (S. 233) an der Beschränkung ihrer Handlungsfähigkeit leiden (S. 400). Dabei stützt er sich auf abgeschwächte anthropologische Grundananahmen, die er in kritischer Auseinandersetzung mit der Tradition des humanistischen Marxismus der Budapester Schule um Georg Lukás und Ágnes Heller herausarbeitet, sowie auf einen der kritischen Psychologie entliehenen Subjektbegriff. Mader plädiert für eine immanente Kritik von konkreten Widerspruchskonstellationen, die er im zweiten Band der Studie anhand des erarbeiteten Analyseschemas empirisch ausformuliert (S. 265).
Die Arbeit gewinnt vor allem da an Erklärungskraft, wo sie die kapitalistische Lohnarbeit als den Zeit- und Ortskern ihrer Thesen reflektiert und expliziert.
Die gründliche Begriffsarbeit ist detail- und kenntnisreich und besticht durch eine mithilfe von Schaubildern und Formeln strukturierte Darstellungsweise. Dadurch entsteht eine luzide Theoriearbeit, die an manchen Stellen von einer historisch-konkreten Anreicherung profitiert hätte. Stattdessen legt der Autor die Konkretion – wie üblich in Qualifikationsarbeiten – säuberlich getrennt im empirischen zweiten Teil dar. Dabei gewinnt die Arbeit vor allem da an Erklärungskraft, wo sie die kapitalistische Lohnarbeit als den Zeit- und Ortskern ihrer Thesen reflektiert und expliziert (S. 387).
Etwas bedauerlich sind die spärlichen Bezüge zur frühen Kritischen Theorie, gerade wegen des Umfangs der Abhandlung und der thematischen Nähe. Zwar gibt es vereinzelte Referenzen auf Autoren wie Horkheimer und Adorno sowie eine ausführlichere Beschäftigung mit Erich Fromm – eine systematische Positionierung zu den Frankfurter Theoretikern fehlt jedoch. Hätte Mader die kritische Psychologie stärker von der Psychoanalyse abgegrenzt, wären vermutlich Überschneidungen und Differenzen deutlicher hervorgetreten; gleiches gilt für den Critical Realism und seine Unterscheidung vom dialektischen Denken. Die genannten Auslassungen schmälern den Erkenntniswert des ersten Bandes jedoch nicht. Er endet mit dem Cliffhänger, ob der widersprüchliche Befund einer „Herrschaft durch Autonomie“ lediglich einer ungenauen Begriffsarbeit geschuldet ist oder ob die Diagnose womöglich einen wahren Kern enthält, weil die Ununterscheidbarkeit von Herrschaft und Autonomie Ausweis einer „Realparadoxie“ ist (S. 403–407). Die Stärke des ersten Bandes liegt in dieser sezierenden Analyse des (dialektischen) Verhältnisses von Herrschaft und Freiheit.
Band II: Klassenverhältnisse in betrieblichen Sozialbeziehungen
Die Studie Herrschaft und Handlungsfähigkeit in der Lohnarbeit kann man als eigenständigen Beitrag zur arbeitssoziologischen Debatte um den Wandel von Arbeitsregimen lesen, sie enthält instruktive Analysen zu sechs verschiedenen Berufsfeldern. Kapitalistische Lohnarbeit versteht Dimitri Mader ausgehend von Marx als ein Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis, was durch die Trennung der Lohnabhängigen von den Produktionsmitteln – ein grundlegend asymmetrisches Machtverhältnis – begründet ist (S. 25). Mader setzt Ausbeutung als zentralen Kausalmechanismus zur Reproduktion des Klassenverhältnisses zwar theoretisch voraus (ebd.),[7] klammert sie für die empirische Analyse von Arbeitsregimen als Herrschaftsordnungen jedoch weitgehend aus, um betriebliche Sozialordnungen primär hinsichtlich seines Erkenntnisinteresses an Herrschaft und Handlungsfähigkeit zu untersuchen. Lohnarbeit bietet sich als empirischer Untersuchungsgegenstand an, da sie ein gesellschaftlich anerkanntes Maß an Herrschaft beinhaltet (S. 33), das allerdings je nach Klassenlage beträchtlich variiert.
Der Autor formuliert ein konzeptionell anspruchsvolles „integriertes Klassenschema“ (S. 45), um die empirische Vielfalt der lohnabhängigen Klasse ordnen zu können. Inspiriert von Erik Olin Wright[8] unterscheidet er Klassen zum einen vertikal nach Kontrollmacht im Betrieb und Qualifikation, zum anderen horizontal nach Arbeitslogiken, angelehnt an Daniel Oesch.[9] Die nach Klassenlagen differenzierte Betrachtung der Handlungsbedingungen von Lohnabhängigen gewinnt in Anbetracht der immensen Verschärfung sozialer Ungleichheit in den Nullerjahren an Erklärungskraft.
Mader attestiert eine dreifache sozialstrukturelle Polarisierung, die sowohl die Unterschiede innerhalb der arbeitenden Klasse als auch das Machtgefälle zwischen Kapital und Arbeit verstärkt (S. 80 ff). Innerhalb der lohnabhängigen Klasse besteht erstens zwischen den Berufsgruppen ein Einkommensgefälle und unterschiedliche Chancen auf soziale Mobilität (S. 81 ff). Zweitens konstatiert Mader eine wachsende „Kern-Rand-Disparität“ (S. 83), nach der – je nachdem wie wertschöpfungsintensiv ein Wirtschaftszweig ist – gravierende Differenzen bei Arbeitsbedingungen und Einkommen bestehen. Drittens verschiebt sich das „Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit“ (S. 85) zu Ungunsten der Lohnabhängigen, was Mader mit grotesk anmutenden Zahlen zur Vermögens- und Einkommensverteilung in der Bundesrepublik belegt. Im Anschluss setzt er die konstatierte soziale Spaltung ins Verhältnis zur Prekarisierung von Beschäftigungsformen und zum Abbau von sozialen Anrechten der Beschäftigten (bspw. institutionalisierte Mitbestimmung) und argumentiert, dass sich die Veränderung der Klassenbeziehungen negativ auf die Gestaltung von Arbeitsregimen auswirke (S. 73).
Der zentrale Befund der Studie lautet, dass die Selbsttätigkeit der Arbeitenden zwar in vielen Berufsfeldern zunimmt. Mader will dies jedoch nicht als Freiheitsgewinn missverstanden wissen. In ausgewählten, vor allem höher qualifizierten, Klassenpositionen wachsen mitunter die Dispositionsspielräume in den Arbeitsprozessen, allerdings sind – und das gilt für alle untersuchten Berufsfelder – die Mitbestimmungsrechte über die Rahmenbedingungen, die Menge der Arbeit und die dafür notwendige Zeit zunehmend eingeschränkt (S. 380).
Mader beschreibt einen Formwandel von Herrschaft in der Lohnarbeit, der mehr auf sachlich vermittelten Zwängen beruht denn auf autoritätsgebundenen Weisungsverhältnissen.
Mader beschreibt einen Formwandel von Herrschaft in der Lohnarbeit, der mehr auf sachlich vermittelten Zwängen beruht denn auf autoritätsgebundenen Weisungsverhältnissen (S. 372). Die Studienergebnisse liegen quer zu dem von Subjektivierungsdebatten skizzierten Bild der sich in einer hierarchiearmen Organisation freiwillig selbstausbeutenden Kreativarbeiterin. Dieser Typus von Lohnarbeit ist laut Mader einer spezifischen Klassenlage zuzuordnen, weshalb es begründete Vorbehalte gegen seine Verallgemeinerung gibt (ebd.). Vielmehr sei zu konstatieren, dass die Arbeitsrealität von Paketbotinnen und Bandarbeitern, von Pflegekräften und Call-Center-Agents bis heute von despotischen Kontrollsystemen geprägt sei und somit dem Freiheitsversprechen der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft spotte.
Die Studie ist ein großer Gewinn für die soziologische Disziplin im Allgemeinen und die Arbeitssoziologie im Besonderen. Eine solch grundlegende Verbindung von sozialtheoretischer Begriffsarbeit und empirischer Detailkenntnis findet sich mittlerweile selten in einer Sozialwissenschaft, die von Drittmitteln abhängig ist und in der Forschungsaufträge häufig anwendungsorientiert vergeben werden. Maders Herangehensweise wirkt beinahe aus der Zeit gefallen und ist gerade deshalb zu würdigen. Besonders hervorheben möchte ich das innovative sekundäranalytische Vorgehen, mit dem der Autor die andernorts mühselig erarbeitete Empirie systematisiert. Da eine Sekundäranalyse grundsätzlich auf die Perspektiven und Ergebnisse anderer Studien angewiesen ist, ließe sich bei der besprochenen Arbeit die Frage stellen, ob sich eigensinniges Handeln von Beschäftigten, welches Herrschaft unterwandert, womöglich unterhalb des Radars der ausgewählten arbeitssoziologischen Studien vollzieht.[10] Maders Erkenntnisse regen dazu an, Betriebsfallstudien und Sekundäranalysen in weiteren Studien zu kombinieren. Beispielsweise könnten arbeitssoziologische Folgeuntersuchungen mit dem von Mader entworfenen Analyserahmen die Praxis der Herrschenden in den Blick nehmen und so die Studienergebnisse komplementieren.
Fußnoten
- Luc Boltanski / Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, übers. von Michael Tillmann, mit einem Vorw. von Franz Schultheis, Konstanz 2003.
- Lutz Eichler, System und Selbst. Arbeit und Subjektivität im Zeitalter ihrer strategischen Anerkennung, Bielefeld 2014.
- Dieter Sauer, Indirekte Steuerung. Zum Formwandel betrieblicher Herrschaft, in: Wolfgang Bonß / Christoph Lau (Hg.), Macht und Herrschaft in der reflexiven Moderne, Weilerswist 2011, S. 358–378, hier S. 366.
- Gerd-Günther Voß / Hans J. Pongratz, Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft?, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50 (1998), 1, S. 131–158; Ulrich, Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt am Main 2007.
- Stephan Voswinkel, Arbeitssoziologie und Gesellschaftstheorie [17.8.2022], IFS Working Paper #14, Frankfurt am Main 2021.
- Margret Archer, Realist Social Theory. The Morphogenetic Approach, Cambridge 1995.
- Mader teilt die Prämisse der an Marx orientierten Klassentheorien, nach der soziale Ungleichheit in Ausbeutung begründet liegt. Der Klassenbegriff impliziert so verstanden eine kausale Erklärung für die von Ungleichheit geprägte Sozialstruktur.
- Erik Olin Wright, Understanding Class. Towards an Integrated Analytical Approach, in: New Left Review 60 (2009), S. 101–116.
- Daniel Oesch, Redrawing the Class Map. Stratification and Institutions in Britain, Germany, Sweden and Switzerland, Basingstoke 2006.
- Simon Schaupp, Methodisches Vorgehen. Eine technopolitische Fallstudie, in: ders., Technopolitik von unten. Algorithmische Arbeitssteuerung und kybernetische Proletarisierung, Berlin 2021, S. 294–304.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Arbeit / Industrie Gesellschaftstheorie Kapitalismus / Postkapitalismus Macht
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Wird doch noch alles gut?
Rezension zu „Exponentialgesellschaft. Vom Ende des Wachstums zur Stabilisierung der Welt“ von Emanuel Deutschmann
Mit Marx gegen den Cultural Turn?
Rezension zu „The Class Matrix. Social Theory after the Cultural Turn“ von Vivek Chibber