Claus Leggewie | Rezension | 30.09.2025
Wird doch noch alles gut?
Rezension zu „Exponentialgesellschaft. Vom Ende des Wachstums zur Stabilisierung der Welt“ von Emanuel Deutschmann
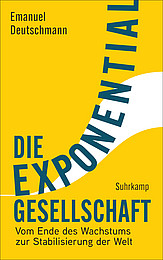
Was kommt eigentlich nach Klimawandel und Artensterben? Nichts, meinen rechtsautoritäre Ignoranten weltweit, weil es ja beides gar nicht gibt. Der Kollaps, sagen informierte Apokalyptiker und frivole Postmoderne voraus. Die Anpassung an vier Grad plus und eine Welt ohne Vogelgesang, meinen nüchterne Gesellschaftsforscher und Umwelttechnokraten. Stabilisierung, konstatiert der an der Universität Flensburg tätige Soziologe Emanuel Deutschmann, und ruft das Ende der „Exponentialgesellschaft“ aus. Wenn nach der Risiko- und vielen weiteren Bindestrichgesellschaften eine neue verkündet wird, ist durchaus Skepsis angebracht: Zu wenige Faktoren stehen bei derlei Zeitdiagnosen meist für zu viel Generalisierung. Und wenn dann, wie in der vorliegenden Studie, auch noch der ursprünglich mathematische Begriff „exponentiell“ herangezogen wird, drohen Missverständnisse.
Exponentiell nennt man eine Entwicklung, wenn eine bestimmte Größe über eine längere Zeit um eine bestimmte Rate wächst. Sie ist zu unterscheiden von linearem Wachstum, das dem Common Sense zugänglicher ist als die galoppierende und konvergierende Entwicklung verschiedener Segmente, die sich zudem gegenseitig verstärken: Weltbevölkerung, globale Wirtschaftskraft, Primärenergieverbrauch, anthropogene Masse, CO₂-Emissionen, Meeresspiegel, Mikroprozessor-Leistung, globaler Tourismus, pandemische Krisen, die akademischen Papers, die sich unter anderem mit dieser großflächigen Akzeleration befassen – und die PowerPoint-Präsentationen von Klima- und Umweltforschern, welche mit Exponentialkurven eröffnen, die sich dem geschockten oder gelangweilten Publikum wie eine Ansammlung in die Höhe ragender Hockeyschläger darstellen. Deutschmanns Buch versammelt sie in großer Fülle.
Der aufkommenden Verzweiflung angesichts scheinbar unaufhaltsam (exponentiell!) steigender CO₂-Emissionen, Durchschnittstemperaturen und Meeresspiegel sagt Deutschmann den Kampf an. Er ist nicht auf Resignation, Anpassung oder Resilienz aus, sondern auf aktive und gestalterische Stabilisierung. Die Anleitung, „wie wir die Kurve(n) kriegen“ (laut Klappentext), führt auf gut 300 Seiten über neun Kapitel vom Aufstieg der Exponentialgesellschaft im 21. Jahrhundert zu den Möglichkeitsbedingungen von „Stabilisierung als neuem Ordnungsproblem“ (Kapitel 4, 5) und über die Psychologie, Politik und Soziologie der Exponentialgesellschaft (Kapitel 6–8) in eine „Post-Exponentialgesellschaft“. Den wohl von ihm geprägten Kofferbegriff macht Deutschmann (in Abgrenzung von Ulrich Becks Risiko- und Hartmut Rosas Beschleunigungsgesellschaft) am „Syndrom der Exponentialität“ plausibel: Einzelne exponentielle Trends – oft verkannt, unterschätzt oder im Blick auf das sakrosankte Wirtschaftswachstum auch begrüßt – verbinden sich, erreichen gemeinsam eine „vertikale Phase“ und verdichten sich spätestens seit den 1970er-Jahren zur planetaren Gefahr. Warnungen wie die des Club of Rome vor den Limits to Growth sind bekanntlich verhallt.
Deutschmann rekurriert auf die formale Soziologie Georg Simmels und dessen geometrische Figur der „Kreuzung sozialer Kreise“. Ihrer Universalisierungskraft entspricht die selbst-verstärkende Kombination exponentieller Entwicklungen in „verdichteten Interdependenzketten“ von Wirtschaft und Ökologie, Information und Technik, Mobilität und Kommunikation, Demografie und pandemischen Krisen. Auch wenn vieles davon bekannt ist und die Zusammenhänge, einmal überzeugend dargelegt, evident scheinen, leistet Deutschmann soziologische Aufklärung im besten Sinne und zeigt, was dieses Fach kann: Für „normal“ oder „irreversibel“ gehaltene Entwicklungen denaturalisieren und politische Kurz- und Schnellschlüsse unterlaufen. Als Leser nimmt man die empirisch reichhaltig fundierte und in guter Dosierung theoriegeleitete, dabei spannende und kaum einmal redundante Darlegung mit zunehmender Ungeduld zur Kenntnis, weil man endlich zur Konklusion vordringen möchte: Man will wissen „Warum Stabilisierung möglich ist“ und wie der „Weg in die Post-Exponentialgesellschaft“ verlaufen soll. Stabilisierung ist definiert als „nachhaltige Beendigung exponentiellen Wachstums und das anschließende Einpendeln der Bestandsgrößen auf einem relativ gleichbleibenden Niveau“ (S. 141). Dem stehen weder soziokulturelle noch biologisch-genetische Evolutionsgesetze entgegen, vielmehr herrschte historisch über Hunderttausende von Jahren eine „Hegemonie der Stabilität“.
Deutschmann hält deren Re-Etablierung auf drei unterschiedlichen – jedoch stets höheren – Niveaus für möglich und führt beispielhaft jüngere Entwicklungen an. Hoch blieb das Stabilitätsniveau etwa bei der Sättigung der Mobiltelefonversorgung und beim „Maske tragen“; niedrig unter anderem bei Ebola-Fällen in Westafrika und der FCKW-Produktion; mittelhoch beispielsweise bei der Dotcom-Blase und EU-Asylanträgen. Der Variante einer Stabilisierung auf mittlerem Niveau, auch als „Hype-Zyklus-Modell“ bezeichnet, widmet Deutschmann die meiste Aufmerksamkeit, weil sie am deutlichsten zeigt, dass Stabilisierung in der Regel ein vorläufiges, relatives und nicht-automatisches Phänomen darstellt. Hier greift er auf den US-amerikanischen Geophysiker M. King Hubbert zurück, der für die Firma Shell Prognosen für die Ölförderung anstellte und sich zur Peak-Oil-Theorie verstieg. Denn anders als der angekündigte Rückgang der Erdölförderung auf ein praktisches Nullniveau erfolgte nach deren Absacken in zwei „Ölkrisen“ der 1970er-Jahre noch einmal eine explosionsartige Steigerung von Produktion und Handel mit Öl. Das zeigt, wie stark eine plausible und erwünschte Stabilisierung (für die Hubbert die Nutzung von Sonnenenergie voraussah) von psychologischen Dispositionen, machtpolitischen Setzungen und sozialen Ungleichheitsstrukturen abhängt.
Wusste man das nicht bereits und ist „nun so klug als wie zuvor“? Mag sein, aber auf deutlich höherem Niveau, weil Deutschmann achtzig empirische Trends zu einer isomorphen, asynchronen Funktion bündelt, die bisher allerdings lediglich partiell stabilisierend wirkt. In jungprofessoraler Keckheit begründet er seine Diagnose Exponentialgesellschaft mit einem Schaubild (S. 301 ff.), das so gut wie alle bekannten „Spezialgesellschaften“ (mit Ausnahme von „Risiko“!) zusammenführt. Da sich alle tatsächlichen und möglichen Entwicklungen Deutschmann zufolge auf den Mechanismus der Exponentialität zurückführen ließen, sei dieser auch sozioökonomischen und ökologischen Kompaktbegriffen wie Kapitalismus und Anthropozän überlegen. „Die Exponentialgesellschaft ist letztlich alles zusammen: eine alternde, haltlose, globalisierte und metrifizierte Wohlstands-, Überfluss-, Wegwerf-, Konsum-, Corona-, Informations-, Wissens-, Netzwerk- und Kommunikationsgesellschaft. Sie hat all diese Eigenschaften, ohne dass sie sich auf eines dieser Charakteristika reduzieren ließe. Das macht die gelisteten Spezialgesellschaften akkurat und dennoch reduktiv. Der Begriff der Exponentialgesellschaft hingegen erlaubt eine Synthese.“ (S. 303) Eine Synthese, oder, wie Deutschmann es nennt und in einem Schaubild komprimiert, ein Syndrom der Exponentialität. Das klingt nach einer gravitätischen Weltformel oder einem funktionalen Äquivalent für jenen verlorenen gesellschaftlichen Zusammenhalt, nach dem allenthalben gesucht wird. Diesen Fehdehandschuh werden Spezialistinnen und Spezialisten der „Spezialgesellschaften“ aufnehmen und sich auf die Suche nach Inkonsistenzen, inneren Widersprüchen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten machen, die in und zwischen den Abteilungen gewiss zu finden sind.
Vor einem generalistischen Hintergrund lesen sich Deutschmanns pädagogische Hinweise, wie man der Post-Exponentialgesellschaft näherkommen kann, wie Vorschläge, welche den fatalistischen Doomer- und techno-optimistischen Boomer-Fantasien überlegen sind und sich nicht in Anpassung[1] und Resilienz erschöpfen. Deutschmann lädt zum nichtlinearen Denken ein, will die ungewohnte und ungemütliche Exponentialität besser im öffentlichen Diskurs erklärt wissen, möchte bereits erreichte oder drohende Kipppunkte sichtbar und vor allem Stabilisierung attraktiv machen, sie also vom Odium der Stagnation und Einengung befreien. Warum das schwer wird? Als „Exponentialität hinter der Exponentialität“ identifiziert Deutschmann vor allem soziale Ungleichheiten; eine „quasi-exponentielle Verursachungsstruktur“ (S. 297), die durch politische Maßnahmen zu korrigieren wäre. Auch solche stehen unter dem Druck asymmetrischer Kräfteverhältnisse zwischen expansionistischen und stabilisierenden Kräften, die Deutschmann, Scherz muss sein, in Elon Musk und Greta Thunberg personifiziert. Letztere habe mit dem Slogan „There is no planet B!“ eine weltweite Bewegung initiiert, die fürs Erste an vier Trümpfen des Musk-Lagers („We’re going to Mars!“) gescheitert sei: Ressourcenvorsprung, Heimvorteil, Beweislastvorteil und „Brandolini-Vorteil“, mit dem der italienische Informatiker ein Gesetz benannte, wonach „das Widerlegen von Unsinn zehnmal mehr Energie erfordert als die Produktion von Unsinn“.
Deutschmann gibt jedoch die Hoffnung nicht auf, dass das stabilisierende Lager wieder in die Offensive kommt, wenn das „Vetorecht der Empirie“ in Kraft tritt und sich sämtliche Techno-Utopien als Luftschlösser erweisen. Drei „Tuwas“-Strategien empfiehlt er: Die Eigenstabilisierung durch die Generalisierung individueller Verhaltensänderungen, die Exponentialitätsadaption im (ebenso exponentiellen!) Vorantreiben alternativer Technologien, Produkte, Verfahren und Erhebungsmethoden sowie die „Alteri-Stabilisierung“ durch Ermunterung zur politischen Aktion und Kooperation in diversen Spielarten. Deutschmann weiß, dass „entsprechende Mehrheiten“ derzeit fehlen, aber sein Programm stabilisierender Maßnahmen ist in sich kohärent, wenn er die stärkere Besteuerung großer Vermögen und Einkommen, Finanztransaktionen, Privatjets, Yachten, SUVs, Fleischkonsums und CO2-Ausstoßes vorschlägt. Auch rät er zur Abschaffung oder zur Erschwerung von Leer- und Inlandsflügen, von Subventionen fossiler Brennstoffe und von Werbung für energieintensive und klimabelastende Produkte sowie zur Einführung von Tempolimits und besseren Ausstattung mit Solaranlagen und Wärmepumpen, zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur und zur Forschung zu Recycling, zu abbaubaren PFAS-Alternativen, nachhaltigen Baustoffen und Impfungen. Daraus fügt sich das bekannte Stabilitätsdreieck aus individuellen Lebensstiländerungen, technisch-wissenschaftlichen Investitionen und kollektiver Steuerung.
Dass sich vieles davon in den Programmen ökologischer Parteien findet, die mit knapp über zehn Prozent Wählerzustimmung in Deutschland im internationalen Vergleich noch gut dastehen, weiß man aus der Zeitung, die das Scheitern entsprechender Koalitionen meldet. Auch weiß man, welche geopolitischen und geowirtschaftlichen Hindernisse sich aufgetürmt haben, von denen in diesen – trotz der Spannweite exponentieller Trends am meisten auf deutsche Verhältnisse abzielenden – Empfehlungen wenig die Rede ist. Aber wer das Festhalten an ökologischen Programmen für politisch naiv erklärt oder sie als normativen „Aktivismus“ anklagt, hat Unrecht. Naivität ist ein Vorteil, da sich die angezeigten Mittel durchaus als geeignet erwiesen haben, den exponentiellen Ritt an den Abgrund zu verlangsamen. Und Zeitdiagnosen, die es bei apokalyptischen Panoramen oder relaxierenden Seelenmassage belassen, gibt es genug. An Deutschmanns politischer Skizze ist besonders das von ihm so genannte „Progressivitätsparadox“ von Interesse. Es besagt, dass die politischen Spaltungs- und Konfliktlinien, die sich an der Rechts-Links-Polarität von Tradition/Fortschritt oder Kapital/Arbeit oder Staat/Markt organisiert hatten, hoffnungslos veraltet sind. Nach meinem Eindruck konkurrieren derzeit drei politische „Lager“ um die Hegemonie: Eine liberal-konservative Formation, die melancholisch-stur auf Rehabilitation und Kontinuität des Allheilmittels Wirtschaftswachstum abzielt; ein rechtsradikal-autokratisches Projekt, das aggressiv die komplette Negation der ökologischen Aufklärung betreibt und auf Disruption setzt, und eine links-konservative Allianz, die sich mit unterschiedlichen Begründungen für die „Bewahrung der Schöpfung“ einsetzt. Das sind konservative Kräfte, die sich von Rechtsaußen nicht kannibalisieren lassen wollen, und Kräfte, die sich nicht länger auf bloße linkskeynesianische Umverteilung kaprizieren, sondern die ökologische Wende mit dem großen Thema soziale Gerechtigkeit verbinden.
Ob sich der Begriff „Exponentialgesellschaft“ durchsetzt, der viele an ihren Mathematikunterricht erinnern dürfte, ist fraglich. Ein holistisches Konzept ist angesichts der verzweigten Spezialisierung und Quantifizierung der Sozialwissenschaften jedenfalls zu begrüßen, wobei auch Deutschmann die Öffnung vom terrestrischen Gesellschafts- zum planetaren Naturvertrag nur andeutet. Dennoch ist sein Buch ein gelungenes Stück soziologischer Aufklärung, das sich nicht scheut, politische Konsequenzen zu ziehen. Es sollte zu vielen Diskussionen eines Faches Anlass geben, das sich allzu oft in politischem Quietismus und besserwisserischer Utopiekritik erschöpft.
Fußnoten
- Siehe dazu Philipp Staab, Anpassung. Leitmotiv der nächsten Gesellschaft Berlin 2022 und meine Besprechung des Buches in https://www.soziopolis.de/technocracy-revisited.html (10.09.2025)
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Arbeit / Industrie Daten / Datenverarbeitung Gesellschaft Gesellschaftstheorie Globalisierung / Weltgesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Ökologie / Nachhaltigkeit Zeit / Zukunft
Empfehlungen
Die diffuse Angst, zu kurz zu kommen
Sechs Fragen an Eva von Redecker
Nach dem Holozän
Rezension zu „Anthropozän zur Einführung“ von Eva Horn und Hannes Bergthaller
Kritische Theorie oder empirieferne Deduktion?
Rezension zu „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ von Nancy Fraser
