Christian Grüny | Rezension | 05.04.2023
Spekulationen über anonyme Klangereignisse
Rezension zu „Earworm and Event. Music, Daydreams, and Other Imaginary Refrains“ von Eldritch Priest
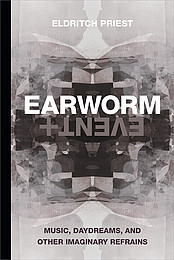
Dieses Buch macht keinerlei Hehl daraus, dass es sich nicht um eine konventionelle philosophische oder kulturwissenschaftliche Untersuchung handelt: Wie auch immer man es hält, man hat eine Vorderseite vor sich. Earworm + Event lautet der Titel auf der einen, Event + Earworm der auf der anderen Seite, und es ist schlechthin nicht entscheidbar, welche Seite den eigentlichen Anfang darstellt. Beide Teile enden in der Mitte, und um weiterzulesen, muss man das Buch umdrehen und einen neuen Anfang machen. Die Suggestion ist dabei offensichtlich, dass wir es mit zwei Seiten derselben Medaille zu tun haben, dass die Sache von jeweils entgegengesetzten Enden und/oder verschiedenen Formen der Reflexion aus angegangen wird. Die eine Seite, die mit dem Ohrwurm einsetzt, wird vom Autor als philosophisch-spekulativ, die andere, die das Ereignis als Ausgangspunkt nimmt, als experimentell beschrieben, und „together the two sides perform a schizo-analytical act that honors the earworm, and thinking more generally, as a process characterized by flows and breaks“ (EW, S. 3).[1]
Die Form des Buches und die Art, wie sie hier beschrieben wird, machen deutlich, dass der Autor sich damit eine gewaltige Last auflädt: Der Text soll nicht nur auf theoretischer Ebene überzeugend sein, wo er die kühne Verallgemeinerung vom lästigen Alltagsphänomen des Ohrwurms zum Denken allgemein einlösen muss, sondern auch formal den selbst formulierten Ansprüchen genügen. Die leichte Lektüre einer konventionellen Darstellung verspricht das nicht. Tatsächlich ist es immer eine Gratwanderung, über einen durch „flows and breaks“ geprägten Gegenstand zu schreiben. Legt man seinen Text zu stringent und argumentativ kohärent an, läuft man Gefahr, die behaupteten Brüche zuzudecken und zu harmonisieren, agiert man sie im Text ungefiltert aus, droht dieser zu einem wirren, vielleicht auch selbstgefälligen Konglomerat zu werden. Für beides finden sich zahlreiche Beispiele. Um es vorwegzunehmen: Priests Buch ist weder das eine noch das andere, schafft es aber trotzdem nicht immer, das selbst vorgegebene formale Niveau zu halten.
Offensichtlich macht es einen Unterschied, mit welcher Seite man beginnt. Der Rezensent, selbst Philosoph, hat sich an die als philosophisch ausgewiesene Seite, Earworm, gehalten. Sie beginnt mit einer bewundernswert klaren und konzisen Exposition des primären philosophischen Bezugspunkts, Susanne K. Langers Theorie der Kunst und des Geistes, mit einem starken Einfluss von Brian Massumis Lektüre dieser Theorie. Sie kann anhand einer wiederkehrenden Formulierung vorgestellt werden, die für Priest einen „refrain“ bildet (ein „Ritornell“ mit Bezug auf Deleuze’ und Guattaris Tausend Plateaus, also einen Modus der Territorialisierung durch Wiederholung): „felt as thought“. Fühlen steht für Langer für einen elementaren Modus des Gewahrseins der eigenen inneren Prozesse, der letztlich das gesamte innere Leben abdeckt; einige dieser Prozesse werden als Gedanken gefühlt. Kunst und insbesondere Musik sind ihr zufolge symbolische Darstellungen von Prozessen des Fühlens, die auf der perzeptuellen Abstraktion von Formen beruhen.
Priest betont an dieser Stelle das Moment der Abstraktion: Insofern es spezifische dynamische Verlaufsformen sind, um die es in der Musik geht, ist die klangliche Materialität nur ein Träger, auf den es letztlich nicht ankommt. Entscheidend wird aus dieser Perspektive das Moment der Form selbst, und dieses wird in der Auffassung wie ein Gedanke gefühlt, eben „felt as thought“. Da es um formale Ähnlichkeit geht und die Formen der Musik gerade nicht distanziert zur Kenntnis genommen, sondern nachvollzogen werden, kann es zu einer Verwechslung der Symbolisierung mit dem Symbolisierten kommen – man meint, man würde sein inneres Leben selbst hören. Wenn man dies nun auch noch innerlich vollzieht, statt es zu hören, potenziert sich diese Gefahr. Der Ohrwurm wird so zu einer Form des sich mit sich selbst beschäftigenden Denkens, das sich tendenziell von seinem äußeren Anlass abkoppelt.
Der so verstandene Ohrwurm wird zu einem Sprungbrett zur Auseinandersetzung mit den in kulturelle, ökonomische und politische Strukturen eingelassenen Formen des menschlichen Geistes, etwa mit Fragen der Kolonisierung und Ökonomisierung der Innenwelt. Es ist, wie Priest betont, nichts Neues, dass unsere geistige Innenwelt mit kulturellen Formen bevölkert ist – womit auch sonst? Ein nicht unbedingt kohärentes Geflecht symbolischer Formen, Zeichen und Formen, durchzogen von kulturellen Bewertungskategorien, macht diese Innenwelt aus; persönliche Erinnerungen geben diesem Geflecht eine individuelle Prägung. Musik war immer ein Teil davon, neu ist aber, dass unser Geist „saturated with industrial memories“ (EW, 36) ist: Die Ohrwürmer, die jeder kennt, entstammen der omnipräsenten industriellen Produktion von Musik. An dieser Stelle passt der von Enzensberger bereits 1970 geprägte Begriff der Bewusstseinsindustrie besonders gut, einer Industrie, die das Leben der im Spätkapitalismus Lebenden mit organisierter Klanglichkeit flutet, bis diese nicht mehr verstanden oder verarbeitet wird, sondern den Geist sozusagen blindlings in Bewegung setzt.
An dieser Stelle tauchen einige Widersprüche auf, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie solche der Sache sind, ob sie dem Autor unterlaufen oder ob sie einfach parallel existierende Tendenzen benennen: Auf der einen Seite befördert die Bewusstseinsindustrie totale Zerstreuung und blinde Bewegung, auf der anderen Seite sollen die inneren Ressourcen der Menschen in kognitiver und affektiver Arbeit produktiv gemacht werden. Der Ohrwurm wird auf der einen Seite als vollkommene Realisierung der Kolonisierung des Inneren beschrieben, auf der anderen als Konzentrationsmoment, das der Zerstreuung entgegenwirkt, und in seiner Nutzlosigkeit als Erscheinung der Potentialität des Denkens schlechthin.
So weit die ersten beiden Kapitel dieses Teils. Das dritte hebt, so scheint es, bereits ins Experimentelle ab, indem er sich mit dem Film Upstream Color von Shane Carruths beschäftigt, der auch etwas mit Würmern, Gedanken und Musik zu tun hat, und es der Leserin überlässt, die systematische Verbindung zum real existierenden Ohrwurm herzustellen. Und dann ist es Zeit, das Buch umzudrehen.
Priest macht zu Beginn klar, dass es sich hier nicht um einen stringenten Argumentationsgang handeln wird, sondern um ein traumartige Verknüpfungslogik, die Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen und Herangehensweisen zusammenführt. Dabei soll es um das Schreiben selbst gehen, dessen rhythmische Struktur und Modulation, um etwas gedanklich Neues hervorzubringen. Dies beginnt allerdings mit einem recht klassisch und nachvollziehbar gestalteten Teil über J.M. Coetzee’s Erzählung The Lives of Animals, gefolgt von einer längeren Ausführung, die sich noch einmal mit Langers Begriff des Geistes beschäftigt und an deren Ende das dementiert wird, was man gerade lesend erlebt hat: Es handele sich nämlich nicht um eine primär diskursive Textform – sondern, wie man mit Langer ergänzen kann, um eine präsentative Form, die in ihrer eigenen Struktur das verkörpert, was sie darstellt, statt es zu sagen. Der etwas vertüdelte Leitfaden scheint dabei die Frage zu sein, ob Tiere Ohrwürmer haben können (also ob sie ein geistiges Leben haben, oder vielmehr was für eins, und ob sie ein sich auf diese Weise im Leeren drehendes Denken erfahren können).
Dann geht es um Käfer – denjenigen in der Schachtel im Kopf, mit dem Wittgenstein die Vorstellung ad absurdum führen wollte, Empfindungen seien eine Art Entitäten, die wir in uns tragen und von denen wir berichten, und denjenigen, in den sich Kafkas Gregor Samsa verwandelt. Der sich dann weiterverwandelt in eine Ratte. En passant verneint Priest die Frage, ob Tiere Ohrwürmer haben können, aber sie könnten Refrains oder Ritornelle haben, Wiederholungen, die sich zu Strukturen ihres Daseins verdichten und Handlung und Denken zugleich sind. Das letzte Kapitel schließlich ist mit „Do Earworms Have Daydreams?“ betitelt, womit das formale selbstreflexive Gemenge zu kulminieren scheint. Es geht aber doch nur um Tagträume als solche, die den Ohrwürmern verwandt zu sein scheinen, aber nicht auf obsessiver Wiederholung, sondern auf zielloser Zerstreuung beruhen. Man fragt sich, wie der Tragtraum des Ohrwurms, also das ziellose Träumen einer obsessiven Wiederholung, und vor allem dessen sprachliche Darstellung aussehen würden. Oder ist es genau das, was wir gerade lesen?
Das Ende des Kapitels beschäftigt sich mit – oder wird in Anspruch genommen von – Pontypool changes everything, dem Buch von Tony Burgess und dem Film von Bruce McDonald, in dem es um eine verbal übertragene Seuche geht, die Menschen in immer gleiche Sprachfetzen wiederholende Zombies verwandelt, also, wie man vielleicht sagen könnte, um den letzten Triumph des Ohrwurms als Virus, der sich unaufhaltsam verbreitet und an die Stelle des menschlichen Geistes setzt.
Auch das Tagträumen wird, wie Priest berichtet, mittlerweile als produktive Ressource betrachtet, als regenerative und kreative Phase, die der arbeitenden Bevölkerung eingeräumt werden sollte und dadurch in Dienst genommen wird. Das Buch, das wir hier vor uns haben, versucht sich dieser Produktivität möglichst konsequent zu entziehen. Der Autor weiß, wie er immer wieder unter Beweis stellt, sehr genau, wovon er spricht, er kann in großer Klarheit philosophische Gedanken darstellen und kritisch auf gesellschaftliche Gegenwartsphänomene anwenden. Aber er will dabei nicht stehenbleiben.
Priest führt eine Weise des Schreibens am Rande des Akademischen vor, das gleichwohl Relevanz für die theoretische Auseinandersetzung mit den Dingen beansprucht und beanspruchen kann. Es lässt sich auf seinen Gegenstand auf eine Weise ein, die keine distanzierte Souveränität prätendiert, sondern sich von ihm durchkreuzen lässt. Die Berufung auf Langers „präsentative Formen“ verweist darauf, dass der Text ebenso sehr etwas tut wie etwas sagt, und man ist auf weite Strecken mit einer sozusagen doppelten Lektüre beschäftigt. Wenn das Denken als solches durch „flows and breaks“ gekennzeichnet ist, so ist es auch das Lesen dieses Buches. Vielleicht ist es so, dass wir in Teilen des Buches dem von Ohrwürmern in Anspruch genommenen Tagtraum eines Philosophen zusehen oder -hören. Das ist immer wieder sehr aufschlussreich, macht stellenweise großen Spaß, irritiert bisweilen und führt manchmal zu Orientierungslosigkeit. Aber, mit John Cage: Maybe what we want is to be lost.
Fußnoten
- „EW“ steht bei der Paginierung für die spekulative Earworm-Seite, „EV“ für die experimentelle Event-Seite.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Jens Bisky.
Kategorien: Körper Kunst / Ästhetik Philosophie
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Adorno in Lüneburg
Rezension zu „Sprache, Literatur und Kunst“, „Kultur, Ausdruck und Bild“ und „Philosophie und Gesellschaft I“ von Hermann Schweppenhäuser
Die verborgenen Kräfte des Sozialen sichtbar machen
Rezension zu „Ethologie der Kunst. Deleuze, Guattari und Simondon“ von Anne Sauvagnargues
