Heike Ohlbrecht, Daniel Ewert | Rezension | 16.10.2025
Zur Soziologie der Einsamkeit
Rezension zu „Zeiten der Einsamkeit. Erkundungen eines universellen Gefühls“ von Janosch Schobin
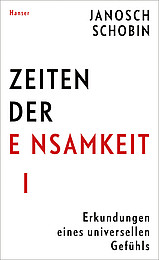
Aktuell sind alle Augen auf Einsamkeit gerichtet. Im gesellschaftlichen Diskurs wird das Thema nicht mehr vorrangig als subjektives Erleiden und individuelles Schicksal, sondern zunehmend als gesellschaftlich verursacht und als Bedrohung für den demokratischen Zusammenhalt wahrgenommen. Folgen von Einsamkeit, der vermeintlich „größten Volkskrankheit“[1] unserer Zeit, werden beispielsweise mit einer zunehmend digitalisierten Lebensführung in Verbindung gebracht und nicht zuletzt mit Blick auf die gesundheitlichen Risiken diskutiert. Auf politischer Ebene werden Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit entwickelt, wie etwa das Strategiepapier der Bundesregierung gegen Einsamkeit, und eine vom Kompetenznetz Einsamkeit zur Verfügung gestellte Angebotslandkarte informiert über die regionalen sozialen Projekte mit einem mehr oder weniger starken Bezug zur Einsamkeitsprävention. Derart angeheizte Diskurse laufen Gefahr, sich zu verselbstständigen und den Blick für allgemeinere, umfassende(re), komplexe und sich zum Teil widerstreitende Perspektiven zu verschließen. Umso mehr ist eine nüchterne, wissenschaftliche Einordnung des Phänomens zu begrüßen.
Janosch Schobins Zeiten der Einsamkeit – Erkundungen eines universellen Gefühls ist eine von diversen neuen Publikationen zum Thema. Auf Basis von 71 Interviewgesprächen in Deutschland, Chile und den Vereinigten Staaten werden verschiedene Formen und Entstehungskontexte von Einsamkeitserfahrungen ausgelotet. Das Werk richtet sich an ein breites Publikum und ist im essayistischen Stil gehalten. Für den Autor steht nicht die Positionierung hinsichtlich der Frage nach der empirischen Zunahme oder Abnahme von Einsamkeitsempfindungen im Vordergrund, sondern sein Hauptanliegen besteht darin, „,Bohrkerne‘ einzelner Biografien zu sammeln, um die vielen gegeneinander laufenden, kurz- und langwelligen gesellschaftlichen Prozesse und die unterschiedlichen Arten der Einsamkeit in den Blick zu bekommen“ (S. 46 f.). So erfolgt der Aufbau der zentralen Kapitel (3-9) jeweils ähnlich: Anhand eines eingangs vorgestellten Fallbeispiels (mal als empirisches Datum, mal als Collage unterschiedlicher, zum Teil auch fiktiver Fälle) wird eine zentrale These entfaltet. Während sie in einigen Kapiteln ausformuliert wird, muss sie in anderen von den Lesenden abgeleitet werden.
Handelt es sich bei Zeiten der Einsamkeit tatsächlich um das „Buch der Stunde“ (wie es im Klappentext ambitioniert attestiert wird)? Wenn ja, dann sollte das Werk zu einer notwendigen und differenzierten Perspektiverweiterung innerhalb des teilweise dramatisierenden Einsamkeitsdiskurses beitragen. Um es vorwegzunehmen: Indem Schobin eine Einordnung der Einsamkeit spätmoderner Gesellschaften bietet und zugleich wertvolle Denkanstöße gibt, welche die etablierten Standards einer psychologisch dominierten Einsamkeitsforschung sinnvoll erweitern, nimmt er eine wichtige Position in der Debatte ein.
Schobin legt im ersten Kapitel („Zur Einleitung – Eine kurze Geschichte der modernen Einsamkeit“) eine sensibilisierende historische und begriffliche Einordnung des Einsamkeitsphänomens vor, in der er Einsamkeitserfahrungen vom 17. Jahrhundert bis zu heutigen spätmodernen Gesellschaften nachzeichnet und den Mythos der positiven Einsamkeit, etwa im Sinne „religiöser und spiritueller Arten der gesuchten Einsamkeit“ (S. 12), überzeugend infrage stellt. Insbesondere seit dem 19. Jahrhundert etablierte sich eine zunehmend negative Besetzung der Einsamkeitserfahrung.
Die Ausführungen hätten jedoch von einer stärkeren Ausrichtung an emotionssoziologischen Perspektiven und insbesondere einer Bezugnahme auf die Romantik profitiert. Schließlich ist diese Epoche besonders geprägt durch die Aufwertung des Gefühlserlebens und die Etablierung neuer Gefühlsnormen, wie etwa der Suche nach wahren Gefühlen als Ausdruck von Tiefe und Authentizität oder den idealisierten Erwartungen an eine romantische Liebe, wodurch auch Enttäuschungserfahrungen und Einsamkeit Einzug erhielten. Seltsamerweise finden sich keine für ein soziologisch inspiriertes Werk unablässigen Bezüge zur Entstehung einer Epoche der Empfindsamkeit vor 250 Jahren und zur Entdeckung des Ichs, obwohl diese eigentlich auf der Hand liegen.
Den argumentativen Kern des Buches finden die Lesenden im zweiten Kapitel („Sechs Thesen über die Einsamkeit der Gegenwart“), wo Schobin eine Auseinandersetzung mit der bisher sehr eindimensionalen Betrachtung der Moderne als Zeitalter der zunehmenden Einsamkeit vornimmt. Angesichts der - trotz unzureichender Datenlage – immer wieder ins Diskursfeld geführten These der einsamkeitsverstärkenden Dynamiken moderner Gesellschaften ist Schobins differenzierte Darlegung der Modernisierungsdividenden (Wohlstandsgewinne, emanzipatorische und inklusionsbezogene Fortschritte) eine wohltuende Lektüre. So zeigt der Autor auf, dass die Moderne und die mit ihr verbundenen Individualisierungsschübe eben auch einsamkeitsreduzierende Potenziale bieten.
Am Fallbeispiel Johns, eines US-Amerikaners aus Boston, entfaltet Schobin im dritten Kapitel („Einsamkeit als Lebensform“) seine These von der (neuen) Sichtbarkeit der Einsamkeit. Analog zu chronischen Schmerzen schlage sich Einsamkeit als verkörperte Ausdruckspraxis habituell nieder, in Form von Haltungen und Bewegungsabläufen sowie veränderten Selbst- und Weltverhältnissen. Schobin legt dar, dass Einsamkeit nicht ausschließlich aus einem kognitiv gesteuerten Abwägungsprozess der Beurteilung sozialer Beziehungen und Bedürfnisse resultiert, sondern eine „zutiefst leibliche Erfahrung der Unbehaustheit in der Welt“ (S. 62) sein kann. Etwas irritierend ist jedoch, dass Schobin zwar offensichtliche körpersoziologische und praxeologische Bezüge herstellt, dabei allerdings nicht auf einschlägige Literatur wie etwa das Konzept der Hexis, als die körperlich sichtbare Dimension des Habitus im Sinne Bourdieus, verweist.
Ähnlich gelagerte Verstetigungseffekte von Einsamkeit geraten im vierten Kapitel („Einsame Klassen“) am Beispiel von Martha in den Blick - einer Chilenin aus prekären Verhältnissen, deren Leben gekennzeichnet ist von massiven Armuts- und Abwertungserfahrungen sowie geschlechtsspezifischen Abhängigkeitsverhältnissen und Benachteiligungen. An ihrem Beispiel lässt sich die These plausibilisieren, dass sich Klassenlagen und -differenzen in einem negativen Klassenbewusstsein niederschlagen, welches wiederum in einer tiefschürfenden und anhaltenden Einsamkeit resultiert. Einsamkeit habe jedoch, so der Autor, etwas Schicksalhaftes, dem man auch mittels sozialen Aufstiegs nicht entkommen könne. Das Kapitel eröffnet eine wertvolle interkulturelle Perspektive, in der die These, dass individualistische Gesellschaften infolge der Auflösung familiärer und persönlicher Bindungen und damit einhergehenden Wahlfreiheiten (und Zwängen) einsamer seien, angezweifelt wird.
Einen ähnlichen Erkenntnisgewinn ermöglicht das anschließende fünfte Kapitel („Die Einsamkeit der Überlebenden“) über die verwitweten Frauen Doris (Chile) und Gisela (Deutschland), an deren Beispiel zwei kulturell divergierende Formen von Einsamkeit, bezogen auf den Umgang mit Trauer (sozial eingebettete vs. stille Einsamkeit), vorgestellt werden. In beiden Fällen wird jedoch eine Tendenz deutlich, die sich auch in anderen Kapiteln zeigt: Des Öfteren muss Schobin einräumen, lediglich Mutmaßungen über das „tatsächliche“ Einsamkeitserleben der interviewten Personen anzustellen. Es fehlen Informationen zur Methodik und zur Generierung des Datenmaterials, die Aufschluss darüber geben, auf welche Weise Einsamkeit beforscht wurde, also wie Schobin sie in den Gesprächen erfragt und inwiefern er den Selbstpositionierungen und -auskünften der Interviewten Rechnung getragen hat. Im Buch entsteht teilweise der Eindruck, dass der Autor seine Aufgabe darin sieht, die zum Teil kaum oder gar nicht verbalisierte Einsamkeit der Interviewten „aufzudecken“. An dieser Stelle hätte eine stärkere Rückbindung an empirische Auszüge einen besseren Nachvollzug der subjektiven Einsamkeitsdeutungen der Befragten ermöglicht.
Im sechsten Kapitel („Die Einsamkeit der Sterbenden“) präsentiert Schobin aus methodischen sowie persönlichkeitsrechtlichen Gründen und unter Rückgriff auf alternative Datenmaterialien (Statistiken zu Amtsbestattungen sowie Gespräche mit Mitarbeiter*innen aus Ordnungsämtern) das fiktive Fallbeispiel von Egon. Der Autor konstruiert Egon als typischen Fall eines Mannes „mit kleine[m] Lebenszuschnitt[], starren Rollenbildern und großen Träumen“ (S. 115). Männer wie er stünden ökonomisch vergleichsweise schlecht da und blieben auf den Partnerschaftsmärkten erfolglos. Auch wenn das Kapitel mit „Die Einsamkeit der Sterbenden“ überschrieben ist und daher einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt erwarten lässt, geben insbesondere die Hinweise zum Zusammenhang von Einsamkeit und Erwerbsarbeit wichtige Impulse für die Bearbeitung eines bis dato kaum erforschten Themas. Hier hätte es durchaus Material für ein separates Kapitel gegeben. Denn der Protagonist „Egon“ pflegt zwar stabile Kontakte zu Arbeitskolleg*innen, seine massiven Einsamkeitserfahrungen bleiben aber dennoch unerkannt.
Die anschließenden Kapitel drehen sich um „Die Einsamkeit der Fixpunktmacher“ (Kapitel 7) sowie „Die Einsamkeit der Dynamisierten“ (Kapitel 8). Gespräche mit Pete, einem New Yorker, der verschwörungstheoretische Positionen vertritt, führen Schobin zu der These, dass Einsamkeit als „Symptom des Mangels glaubwürdiger sozialer Referenzinformationen“ (S. 137) zu deuten sei. Menschen seien konstitutiv auf vertrauensvolle, kooperative Beziehungen angewiesen. Pete verfüge nicht über solche Beziehungen und verliere in der Folge auch den Bezug zu sich selbst. Die Strategie des Fixpunktmachens - etwa die Suche nach festen Routinen und Gewohnheiten oder die Erklärung des politischen Geschehens durch vereinfachende Muster – sei Petes Umgang mit ontologischen Ungewissheiten.
Die im anschließenden Kapitel entfaltete Geschichte der sozialen Auf- und Abstiege der Afroamerikanerin Doloris und ihrer Familie verweist auf den Zusammenhang von Einsamkeit und instabilen Statusverhältnissen, die für dynamisierte Gesellschaften besonders typisch seien. Doloris fühle eine innere Zerrissenheit, verliere ihr Herkunftsmilieu doch zunehmend an Bedeutung und büße seine Schutz- und Unterstützungsfunktion ein, so Schobin. Auch bleibe die Inklusion in ihr neues soziales Umfeld – Künstler*innenkreise – schwach und stets vorläufig (S. 149). Hier bezieht sich der Autor auf ein bekanntes und gut ausgeleuchtetes Phänomen in der Soziologie, welches unter anderem durch die Arbeiten von Didier Eribon[2] wieder Gegenstand einer soziologischen Analyse wurde: Die sozialen Kosten, die „Klassenflüchtlinge“ tragen müssen, deren Herkunftsbindungen schwinden, ohne dass Sicherheiten im neuen Milieu entstehen.
Eine letzte Variante von Einsamkeit („Die Einsamkeit der Projektion“, Kapitel 9) exemplifiziert der Autor am Fallbeispiel der erfolgreichen, hochgebildeten und normschönen Natascha. Ihre Einsamkeitsempfindungen basierten auf tiefgreifenden biografischen Erfahrungen, die mit Selbstbeschreibungen als Außenseiterin oder auch der Selbstabwertung des eigenen Körpers einhergingen und eng verknüpft seien mit der Frage nach Identität, Begehren und der Rolle fiktiver wie virtueller Beziehungen in Spielewelten. Das Kapitel leistet Differenzierungsarbeit, indem exemplarisch gezeigt wird, inwiefern die in der Einsamkeitsforschung etablierte Unterscheidung zwischen sozialer und emotionaler Einsamkeit nicht ausreicht, um die Bandbreite verschiedener Einsamkeitserfahrungen – insbesondere in der Jugend – abzudecken. Vielmehr werde eine Art existenzieller Einsamkeit empfunden, die aus unerfüllten Wünschen, idealisierten Liebesvorstellungen sowie dem Scheitern an imaginären oder gesellschaftlichen romantischen Beziehungsidealen entstehe.
Im zehnten und letzten Kapitel („Die Zukunft der Einsamkeit“) stellt Schobin Überlegungen zu zukünftigen Entwicklungen an. Die Prognosefähigkeit der Sozialwissenschaften ist begrenzt, sodass die Antwort auf die Frage nach zukünftigen Entwicklungen spekulativ und fehleranfällig bleiben muss. Angesichts einer Vielzahl einschneidender gesundheitsbezogener Trends (z. B. in Richtung einer fortschreitenden Medikalisierung von Einsamkeit), technischer Revolutionen (Etablierung der künstlichen Intelligenz zur Herstellung von und als Ersatz für soziale Beziehungen) sowie antizipierter Zukunftsängste und Drohszenarien (Stichwort Klimakrise) ist richtigerweise davon auszugehen, dass das Thema Einsamkeit mindestens eine Begleiterscheinung bleiben wird, deren Bewältigung von der Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit spätmoderner Subjekte, Kollektive und Gesellschaften abhängt.
Was bleibt abschließend festzuhalten? Trotz der Komplexität des Phänomens ist es Schobin gelungen, unterschiedliche Facetten und Varianten von Einsamkeitserfahrungen stilistisch ansprechend und gut nachvollziehbar aufzubereiten. Zeiten der Einsamkeit ist das Buch für den öffentlichen Einsamkeitsdiskurs, da es einer breiten Leser*innenschaft eine gut informierte, differenzierte und sozialwissenschaftlich erhellende Einordnung des Themas bietet. Aus den wenigen Ausführungen zur methodischen Herangehensweise, sowohl bei der Datenerhebung als auch bei der Analyse des empirischen Materials, ergeben sich jedoch Einschränkungen hinsichtlich der empirischen und theoretischen Anschlussfähigkeit für die Einsamkeitsforschung.
Interessant am Band ist sicherlich der kulturvergleichende Ansatz. Dennoch bleiben fundamentale Fragen offen: Wird Einsamkeit in Chile oder den USA (oder anderen Ländern) anders erlebt als in Deutschland? Wird die Einsamkeit der abgehängten sozialen Schichten in Lateinamerika ähnlich erlebt und verursacht wie in Westeuropa? Der befremdete Blick des ethnografisch inspirierten Soziologen ermöglicht Erkenntnisse, die nur durch diese Befremdung greifbar werden. Dennoch ist mit einer essayistischen Aneinanderreihung interessanter Fälle auch die Gefahr verbunden, dass die Systematik verloren geht. Können wir die sozialen Kontexte von Einsamkeit beliebig variieren, oder sollten wir die anthropologische Konstante der Einsamkeit im Lebenslauf besser mittels einer minimal und maximal kontrastierenden Analyse in den Blick nehmen? Schobins Buch lädt dazu ein, diesen ersten essayistischen Spuren forschungsseitig nachzugehen und die Einsamkeitsforschung auf ein methodisches und theoretisches Fundament zu stellen.
Fußnoten
- Einsamkeit „die größte Volkskrankheit“, 24. 12. 2022, www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/einsamkeit- 121.html
- Didier Eribon, Eine Arbeiterin. Leben, Alterns, Sterben, Berlin 2024, übersetzt von Sonja Finck. Didier Eribon, Gesellschaft als Urteil. Klassen, Identitäten, Wege, Berlin 2017, übersetzt von Tobias Haberkorn. Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Berlin 2009, übersetzt von Tobias Haberkorn.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Affekte / Emotionen Familie / Jugend / Alter Kapitalismus / Postkapitalismus Methoden / Forschung Sozialstruktur Wissenschaft
Empfehlungen
Solidarität statt Liebe
Rezension zu „They Call It Love. The Politics of Emotional Life“ von Alva Gotby
Eine Frage der Deutung
Rezension zu „Fehlgeburt und Stillgeburt. Eine Kultursoziologie der Verlusterfahrung“ von Julia Böcker

