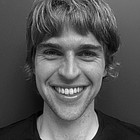Noah Serve | Zeitschriftenschau | 17.09.2025
Aufgelesen
Die Zeitschriftenschau im September 2025
Allein im September 2015 beantragten mehr als 165.000 Menschen Asyl in Ländern der Europäischen Union.[1] Die Bundesregierung setzte in dieser Lage zeitweise die Dublin-III-Verordnung aus – und damit die Rückführung von Asylsuchenden in ihr EU-Ankunftsland. Ziel war es, eine humanitäre Krise in den südlichen und östlichen EU-Anrainerstaaten – etwa in Italien, Griechenland und Ungarn – abzuwenden. Diese Entscheidung trug dazu bei, dass Deutschland im Jahr 2015 mehr als ein Drittel aller erstmaligen Asylanträge der Europäischen Union zu bewältigen hatte.[2] Die Ereignisse des Septembers 2015 und ihre mediale Inszenierung rückten die Migrationspolitik wieder einmal ins Zentrum politischer Auseinandersetzungen. Fremdenfeindliche Aggressionen, zu denen es etwa im sächsischen Heidenau schon im August 2015 gekommen war, erinnerten viele an die Ausschreitungen zu Beginn der 1990er-Jahre in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, und provozierten Gegenreaktionen einer Mehrheit im Land. Befürworter einer liberalen Flüchtlingspolitik artikulierten ihre Zustimmung zur Aufnahmebereitschaft der Bundesrepublik gleichermaßen mit symbolischen Gesten wie praktischer Hilfe; so wurde die Idee einer deutschen „Willkommenskultur” populär.[3] Gegner des Asylrechts und jene, die eine drastische Beschränkung von Migration wünschten, sahen sich wiederum bestätigt: Die Situation bewies ihnen einen „Kontrollverlust“. Wenn dagegen nicht bald etwas unternommen würde, drohte aus ihrer Sicht Thilo Sarrazin mit seiner 2010 aufgestellten These recht zu behalten: „Deutschland schafft sich ab“.[4]
Besondere Resonanz erfuhr in der Folge Angela Merkels Satz „Wir schaffen das!“. Inzwischen gilt er manchen als prägendster Topos ihrer Kanzlerschaft.[5] Zehn Jahre später hat die Union mit Merkels Erbe gebrochen und die „Migrationswende“ ins Zentrum ihres Wahlkampfs gestellt.[6] Der „Sommer der Migration“, seine Folgen und die Erinnerung an ihn, haben nichts von ihrer politischen Brisanz verloren. Allerdings hat sich die politische Stimmung deutlich verändert. Während 2015 die deutsche Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann beschloss, Flüchtlinge von der österreichisch-ungarischen Grenze aufzunehmen, lädt heute der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt seine europäischen Amtskolleg:innen zu einem Migrationsgipfel auf der Zugspitze ein, um gemeinsam einen „besseren Schutz“ der EU-Außengrenzen zu fordern.[7] Fragt man das Spitzenpersonal der Union, ob ‚wir‘ es in den letzten zehn Jahren geschafft haben, so fällt die Antwort in der Regel negativ aus.[8]
Entscheidend ist, wer mit „wir“ gemeint ist (die Bundesregierung, die Zivilgesellschaft oder die Geflüchteten selbst); auf welcher Ebene (Kommunen, Nation oder EU) welches Politikfeld (Wirtschafts-, Bildungs- oder Grenzpolitik) betrachtet wird; und auch, welcher Maßstab für eine erfolgreiche („geschaffte“) Migrationspolitik gelten soll. In der Süddeutschen Zeitung verwiesen etwa die Politikwissenschaftlerin Petra Bendel und die Soziologin Yuliya Kosyakova positiv auf die hohe Beschäftigungsquote von Geflüchteten.[9] Andere Migrationswissenschaftler:innen bemängeln die Entwicklung der letzten zehn Jahre: Die Politologin Naika Foroutan betont das Fehlen eines einheitlichen Asylsystems in Europa. Der Soziologe Ruud Koopmans kritisiert den hohen Anteil an Bürgergeldempfänger:innen unter Geflüchteten. Und die Humangeografin Birgit Glorius moniert die mangelnde Infrastruktur für Integration. Für die Union dagegen scheint ein anderer, primär politischer Indikator entscheidend: die Größe der AfD. Eine restriktive Migrationspolitik solle, so heißt es oft, die einzige Möglichkeit sein, die Zustimmung zur AfD zu verringern, nur so könne die AfD „wegregiert“ werden.[10] Die implizite Annahme lautet: Nicht ein Diskurs über den Schutz von, sondern über den Schutz vor Geflüchteten schütze das parlamentarische System vor den Rechtsextremen.[11]
Jüngst erschienene Zeitschriftenartikel erlauben es, den Blick auf die zukünftige Entwicklung einer stets restriktiveren deutsch-europäischen Flüchtlingspolitik zu richten. Sie zeigen, inwiefern viele europäische Regierungen zunehmend versuchen, das Asylrecht zu umgehen (1), warum eine Neudiskussion des Asylrechts sinnvoll sein könnte (2) und wie sich individuelle Einstellungen zur Flüchtlingspolitik überhaupt herausbilden (3).
Wohin steuert die europäische Migrationspolitik?
Bernd Kasparek und Vassilis Tsianos zeigen in ihrem Text „Zehn Jahre ‚Wir schaffen das!‘ – Wie Europa das Asylrecht abwickelt“, wie sich die zunehmende Bereitschaft europäischer Regierungen zu einer restriktiven Migrationspolitik auf deren Umgang mit dem europäischen Asylrecht auswirkt. In Heft 8 der Blätter für deutsche und internationale Politik argumentieren die beiden Migrationsforscher, dass sich ein harter Migrationskurs auf EU-Ebene bislang aufgrund der Uneinigkeit rechter Parteien nicht erfolgreich organisieren ließ. Dies habe sich jedoch geändert: Rechte Migrationspolitik hat sich durchgesetzt, sie bestimmt nun den Kurs der Europäischen Union. Kasparek und Tsianos verstehen unter einer rechten, skeptischen, harten oder restriktiven Migrationspolitik ein politisches Handeln, welches versucht, „der Migration grundsätzlich ihre Legitimität abzusprechen, sie zu unterbinden und […] [sie] rückgängig zu machen“ (S. 111). Inwiefern für diese Position die ethnische Identität der Migrant:innen eine Rolle spielt, bleibt unbeantwortet.
Ein Beweis für die gegenwärtige institutionelle Hegemonie rechter Migrationsbestrebungen in Europa sei, so heißt es im Artikel, die Teilnahme des deutschen Bundeskanzlers an einem informellen, migrationskritischen Treffen von insgesamt 15 europäischen Staats- und Regierungschefs, das vor dem EU-Gipfel Ende Juni stattfand. Diese sogenannte ‚Meloni-Runde‘ trifft sich seit Oktober 2024 regelmäßig vor den EU-Gipfeln, um zu beraten, wie Migrationszahlen gesenkt und Pull-Faktoren reduziert werden können. Im Gegensatz zu Friedrich Merz besuchte Olaf Scholz diese Treffen in seiner Amtszeit nicht.[12] Die Autoren fassen den Kreis der Staats- und Regierungschefs um die italienische Ministerpräsidentin als Europas Rechte zusammen, ohne an dieser Stelle zwischen den migrationspolitischen Zielen der deutschen Bundesregierung und denen von europäischen Rechtsextremen zu unterscheiden. Trotz der derzeit günstigen politischen Stimmung für restriktive Migrationspläne in Europa ist deren Umsetzung jedoch durch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) eingeschränkt. Das seit den 1990er-Jahren stetig um Kompetenzen erweiterte GEAS setzt für die Asylpolitik der EU-Mitgliedsstaaten menschenrechtliche Mindeststandards fest, die ein individuelles Recht auf Asyl garantieren und institutionell durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gesichert werden. Kasparek und Tsianos schreiben:
„Damit sind Szenarien staatlicher Omnipotenz, wie sie in den Forderungen nach einer Abschaffung des Asylrechts oder Remigration zum Ausdruck kommen, objektive Hürden gesetzt, die sich nicht trivial umschiffen lassen. Die Rechte benötigt daher tatsächlich ‚innovative Ideen‘, um ihre migrationspolitischen Ziele zu verfolgen.“ (S. 112)
Basierend auf der Annahme, dass jeglicher Versuch einer restriktiveren Migrationspolitik folglich darin endet, die Grund- und Menschenrechte von Asylsuchenden einzuschränken, identifizieren die Autoren drei Strategien der Rechten, das europäische Asylrecht zu umgehen.
Als erste Strategie benennen die Autoren den vorsätzlichen Bruch mit europäischem Recht. Hierzu gehöre beispielsweise der Opt-out-Antrag der Niederlande an die EU-Kommission, aus dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem auszutreten, sowie der offene Brief von neun Staaten an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom Mai 2025, in dem sie eine Neuauslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention fordern. Kasparek und Tsianos werfen zudem dem Bundesinnenministerium vor, vorsätzlich eine rechte Geschichtsschreibung zu reproduzieren. Um die eigenen rechtswidrigen Rückweisungen von Asylsuchenden zu verschleiern, erkläre das Ministerium die Nicht-Abweisung von Asylsuchenden an der deutsch-österreichischen Außengrenze im September 2015 zur illegitimen mündlichen Weisung. Die Autoren schlussfolgern:
„Die Strategie des Bundesinnenministeriums ist der fortgesetzte Rechtsbruch. Ob derartige Strategien erfolgreich sein werden, lässt sich noch nicht abschließend bewerten. Festhalten lässt sich aber, dass der Bruch fundamentaler grundrechtlicher Normen zwar eine restriktive Migrationspolitik ermöglichen könnte, zugleich aber einen tiefgreifenden Schaden an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa hinterlassen würde.“ (S. 114)
Praktisch nicht umzusetzen und obendrein kostspielig sei, so die beiden Autoren, die zweite Strategie der Rechten: die Drittstaatenlösung. Anstatt Asylverfahren auf dem eigenen Territorium durchzuführen, sollen Asylsuchende nach dieser Externalisierungslogik entweder a) vor Erreichen des europäischen Ziellandes ihren Asylantrag in einem Drittstaat stellen und dort auf eine Entscheidung warten (Pazifische Lösung), b) nach Erreichen eines europäischen Staates für die Dauer des Verfahrens in einen Drittstaat gebracht werden (Ruanda-/Albanien-Modell) oder c) bei abgelehntem Asylantrag und fehlender Rückführungsmöglichkeit ins Herkunftsland in ein externes Abschiebezentrum verlegt werden. Eine rechtliche Regelung der im Jahr 2026 in Kraft tretenden GEAS-Reform verbietet die Abschiebung von Asylsuchenden in Drittstaaten, zu denen sie keine tiefgreifende Verbindung haben. Obwohl die Europäische Kommission im Mai 2025 vorgeschlagen hat, dieses Verbot zu kippen, sind die Autoren der Ansicht, dass Drittstaatskonzepte zum Scheitern verurteilt sind:
„[…] es ist dennoch davon auszugehen, dass diese [Drittstaatskonzepte] keine effektive Strategie für eine de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl darstellen, denn es ist schwer vorstellbar, dass es ein oder mehrere Länder gibt, die dauerhaft ein externalisiertes Asylsystem für die Europäische Union zur Verfügung stellen wollen. Zumindest würden sich diese Länder eine solche Dienstleistung mit erheblichen Summen vergüten lassen.“ (S. 115–116)
Während die ersten beiden Strategien aufgrund mangelnder Rechtskonformität beziehungsweise fehlender Effektivität bislang keine Möglichkeit für eine europäisch einheitliche, rechte Migrationspolitik bieten, sehen die Autoren im Fall der dritten Strategie, der missbräuchlichen Verwendung der Kategorie der Instrumentalisierung von Migration, eine solche „Gefährlichkeit“ (S. 116). Im Gegensatz zu vorherigen Versuchen, das individuelle Recht auf Asyl auszuhebeln, soll diese Strategie auf Basis europarechtlicher Verordnungen umsetzbar sein. Grundlage sei die Asyl-Krisenverordnung, die mit der GEAS-Reform im Jahr 2026 in Kraft tritt. Sie ermögliche es den Mitgliedstaaten, im Falle einer Instrumentalisierung von Migration durch Drittstaaten zur Destabilisierung der Europäischen Union vom europäischen Recht abzuweichen. Als realpolitischer Ursprung dieser Angst gilt der Versuch des belarussischen Präsidenten im Sommer und Herbst 2021, mithilfe staatlich gesteuerter Migration gegen die von der EU verhängten Sanktionen vorzugehen. So ermöglichte Alexander Lukaschenko vor allem Menschen aus dem Irak und Afghanistan mit belarussischen Touristenvisa die Weiterreise nach Litauen und Polen – mit dem Ziel, die beiden Staaten durch eine ungewöhnlich hohe Aufnahme von Schutzsuchenden zu überfordern.[13]
Für Kasparek und Tsianos gilt: Auch wenn der EuGH bislang kein Notlageverfahren zur Abweichung vom europäischen Recht zugelassen hat, entfaltet die Vorstellung, Migrant:innen könnten von feindlichen Akteuren als Waffe eingesetzt werden, erhebliche politische Wirkung. Die humanitäre Notlage der flüchtenden Personen gerät in den Hintergrund, deren Einsatz als Mittel zum Zweck rückt in den Vordergrund. Das individuelle Recht auf Asyl verliert an Bedeutung – es wird delegitimiert. Gerade jetzt, in Zeiten der Versicherheitlichung von Politik, erscheint den Autoren die Anwendung dieser Strategie somit nicht mehr fern:
„Im Kontext der Rückkehr des Kriegs als Mittel der Politik zeichnet sich damit eine neuartige Strategie zur Aushebelung des individuellen Rechts auf Asyl und Schutz ab. Die europäische Zivilgesellschaft wird dafür Sorge tragen müssen, dass Nationalstaaten völkerrechtlich belangt werden können, wenn sie staatliche Vergehen an Geflüchteten tolerieren. Denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie etwa kollektive Refoulements, verjähren nicht.“ (S. 116)
Während Kasparek und Tsianos ihren Artikel mit einem Appell an die europäische Zivilgesellschaft beenden, sich gegenüber ihren nationalstaatlichen Regierungen für das internationale Recht auf Asyl einzusetzen, legt sich der Rechtsphilosoph Andreas Funke die Frage vor, ob das europäische und internationale Asylrecht in seiner gegenwärtigen Fassung beibehalten werden sollte.
Was soll das Asylrecht leisten?
Die Frage nach dem Nutzen des Asylrechts, so Funke, sollte innerhalb der europäischen Zivilgesellschaft offen diskutiert werden. „Mehr Demokratie in der Migrationsdebatte wagen“ – so könnte das Credo seines Textes „Urteile ohne Regel, Regel ohne Prinzip – Worüber in der Migrationspolitik (auch) zu diskutieren wäre“ aus Heft 914 der Zeitschrift Merkur lauten. Keineswegs soll hiermit der Argumentation des Beitrags ein phrasenhafter Charakter unterstellt werden – im Gegenteil. Funke veranschaulicht differenziert und sachlich, weshalb das internationale Flüchtlingsrecht einer Diskussion bedarf.
Der Text beginnt mit einer Einordnung der aktuellen deutschen Migrationsdebatte, die sich primär auf „den Stellenwert eines individuellen Rechts auf Asyl“ konzentriere (S. 67). Eine Debatte, die meist zweigliedrig wahrgenommen werde: Auf der einen Seite stehen Vorschläge zur Modifikation bis hin zur Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl, auf der anderen Seite dessen Beibehaltung. Funke stört sich hierbei an letzterer, vor allem im linken politischen Spektrum verorteten Rechtsauffassung, wonach das individuelle Asylrecht ein starkes Recht sei, das allen politisch Verfolgten Schutz in einem Konventionsstaat garantiere und daher unantastbar bleiben müsse. Diese Position verenge sich auf die Angst, jede Reform könnte die völkerrechtliche Bindung der Genfer Flüchtlingskonvention aushöhlen. Doch es verhält sich anders. Funke zufolge entscheidet am Ende nur ein Mechanismus über Schutz oder Nicht-Schutz: „Der Körper muss in Kontakt mit dem potenziellen Gaststaat gebracht werden.“ (S. 69) Spreche man vom individuellen Recht auf Asyl, so meint man letztendlich das Prinzip der Nichtzurückweisung (non-refoulement) der Genfer Flüchtlingskonvention – das Verbot, Verfolgte, die keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen, in Staaten abzuschieben, in denen für sie Lebensgefahr besteht. Entgegen der Annahme, die Konvention verpflichte dazu, allen politisch verfolgten Menschen Asyl zu gewähren, möchte Funke zeigen, dass de facto nur ein schwaches Recht besteht und zwar dieses: Geflüchtete nicht zurückzuweisen.
Das Asylrecht erweise sich jedoch nicht nur als schwach in seiner Wirkung, sondern auch als veraltet, unzureichend demokratisch verhandelt und frei von einem übergeordneten Prinzip. Für Funke ist es wichtig, zwischen den beiden großen Säulen des internationalen Flüchtlingsrechts zu unterscheiden: der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 mit dem Zusatzprotokoll von 1967 und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Während die Genfer Flüchtlingskonvention den Non-Refoulement-Grundsatz beinhaltet, ist dieser in der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht verankert. Die Europäische Menschenrechtskonvention basiere stattdessen auf menschenrechtlichen Verpflichtungen, wie zum Beispiel dem Schutz vor Folter und erniedrigender Behandlung (Art. 3). Diese Verpflichtungen verhindern die Rückführung von Personen in Länder, in denen diese Rechte verletzt werden, und wirken somit letztendlich wie ein Schutz vor Verfolgung. Funke kritisiert diese Wirkung, denn der Europäische Gerichtshof setzt in der Folge das Non-Refoulement-Gebot bei Einzelfällen indirekt durch, ohne dass dieses je durch demokratische Verfahren legitimiert wurde. Als Beispiel führt Funke ein Urteil des EuGH vom Oktober 2024 an. Darin wurde festgestellt, dass die menschenrechtliche Situation von Frauen in Afghanistan derart prekär ist, dass alle afghanischen Frauen in der EU rechtlich als politisch verfolgt gelten. Die Mitgliedstaaten sind somit verpflichtet, allen afghanischen Frauen, die in die EU einreisen, Schutz zu gewähren. Für Funke ist dieses Urteil juristisch nachvollziehbar, es stelle aber auch eine politische Entscheidung dar, wer in Europa Schutz erhält – eine Entscheidung, deren Begründung und Begrenzung außerhalb von Einzelfällen kaum Teil öffentlicher Debatten sei. Es werden Urteile gefällt, ohne dass es eine entsprechende Regel gibt: Es sind Puzzleteile, von denen man sicherlich sagen kann, dass sie zusammenpassen; aber niemand hat ein Bild darauf gezeichnet“, schreibt Funke (S. 70).
Die Non-Refoulement-Regel sei zwar in der zweiten Säule – der Genfer Flüchtlingskonvention – verankert, ein übergeordnetes Prinzip fehle dieser hingegen. Sie sei ein historisches Überbleibsel der „rechtliche[n] Vergangenheitsbewältigung“ (S. 68) nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Konvention von 1951 und das Zusatzprotokoll von 1967 seien nämlich zu einer Zeit verabschiedet worden, in der die westlichen Staaten nicht mit großen Fluchtbewegungen konfrontiert waren, während heute mehr Menschen auf der Flucht sind als je zuvor. Funke beklagt, dass die Verantwortung auf die Leidenden selbst übertragen wird. In der Konsequenz finde eine willkürliche Auswahl schützenswerten Lebens statt: Nur diejenigen, die die Flucht wagen, geschweige denn überleben, können politischen Schutz vor Verfolgung beanspruchen. Hilfe vor Ort? Fehlanzeige.
Aus diesen Erkenntnissen schlussfolgert Funke, dass eine Aktualisierung der normativen Basis des gegenwärtigen Asylrechts dringend erforderlich ist. Hierfür brauche es eine grenzüberschreitende, offene Diskussion. Um das Credo vom Beginn zu korrigieren: Es ist Zeit, „mehr Deliberation zu wagen“. Für den Autor kann eine zielgerichtete migrationspolitische Diskussion nur funktionieren, wenn sie „ohne Scheuklappen“ (S. 74) geführt wird. Er beklagt im Zuge dessen die Polarisierung des Politikfeldes und macht hierfür vor allem linke Positionen verantwortlich. Diese hätten sich, wie bereits erwähnt, für den „mutlos[en]“, respektive „konservativ[en]“ (S. 73) Weg entschieden, am schwachen individuellen Recht auf Asyl (dogmatisch) festzuhalten, anstatt es weiterzuentwickeln. Funke geht es vor allem um den Diskurs selbst: Auch wenn der derzeitige Zustand des Asylrechts unverändert bliebe, sei es sinnvoll, migrationspolitische Prinzipien zu verhandeln. Humanitäre Prinzipien sieht er dabei in seinen Vorstellungen einer offenen Diskussion nicht in Gefahr, denn:
„Die Diskussion sollte sich am Leitbild des Schutzes von Menschen als Menschen orientieren. Denn sowohl diejenigen, die sich um Anpassungen bemühen, als auch die Verfechter eines Rechts auf Asyl sind sich insoweit doch eigentlich einig. Die Frage ist nur, wie man diesem humanitären Imperativ am besten gerecht werden und wie dies auf gerechte Weise geschehen kann.“ (S. 72)
Ließe man die Argumentation beider Artikel aufeinanderprallen, so würden Kasparek und Tsianos Funkes Lob für Politiker:innen und Wissenschaftler:innen, die eine Abschaffung und Aktualisierung des individuellen Rechts auf Asyl fordern, vehement widersprechen. Während Funke jeglichen diskursiven Anstoß bezüglich des Asylrechts als Zugewinn für die deliberative Demokratie betrachtet, befürchten Kasparek und Tsianos, dass nicht alle Diskursteilnehmer:innen ein Interesse an rechtsstaatlichen Institutionen und völkerrechtlichen Normen haben. Funke würde wiederum davor warnen, dass diese Position die Gefahr birgt, die bereits vorherrschende Polarisierung der Migrationsdebatte zu verstetigen. Wie allerdings humanitäre oder bedrohungsgeleitete Wahrnehmungen von Migration zustande kommen und welche Wirkung demografische und Framing-Aspekte hierauf haben, zeigt ein Aufsatz aus den Migration Studies.
Wie kommen individuelle Migrationseinstellungen zustande?
In ihrer quantitativen Studie „Humanitarian concerns and threat perceptions: An analysis of the key drivers of refugee attitudes in Germany” untersuchen die Wissenschaftler:innen Tobias Hillenbrand, Bruno Martorano, Laura Metzger und Melissa Siegel die Entstehung einer individuellen Migrationseinstellung (refugee attitude), die bislang zu wenig Aufmerksamkeit erfahren habe: humanitäre Bedenken (humanitarian concerns). Gemeint sind damit das Mitgefühl und die Wahrnehmung einer moralischen Verantwortung für das Wohlergehen anderer Menschen – insbesondere jenen in Not. Laut ihrem Artikel in der Zeitschrift Migration Studies (Volume 13, Issue 3) beschäftigt sich die Forschungsliteratur vor allem mit dem Zusammenhang zwischen wahrgenommenen ökonomischen, sicherheitspolitischen oder kulturellen Bedrohungen (threat perceptions) durch die Zuwanderung Geflüchteter und der Unterstützung restriktiver Migrationspolitiken. Inwiefern humanitäre Nachrichten und Frames (humanitarian messaging) die Bedenken des Einzelnen bestimmen und somit seine/ihre Unterstützung für liberale Migrationspolitiken beeinflussen, ist hingegen kaum untersucht.
“This research contributes to the existing literature on the formation of attitudes toward humanitarian migrants in different ways: First, it sheds more light on the formation of attitudes toward humanitarian migration, particularly by systematizing and refining the channel of humanitarianism as a critical determinant of public attitudes in the context of refugee migration. Second, we speak to the body of literature concerned with the effects of framing on immigration attitudes. (S. 3)
In dieser Absicht präsentiert die Studie zunächst einen theoretischen Rahmen, der die Entstehung humanitärer Bedenken und migrationspolitischer Gefahrenwahrnehmungen erklären soll – und anschließend empirisch überprüft wird. Dem Modell zufolge wirken verschiedene Wahrnehmungsfaktoren zusammen: die humanitäre Situation von Geflüchteten (environmental adversity), ihre persönlichen Merkmale wie Alter oder Geschlecht (personal characteristics), die angenommenen Folgen von Migration für das eigene Land (implications of immigration); darüber hinaus intrapersonale Dispositionen wie die persönliche humanitäre Orientierung. Aus diesen Konstellationen ergeben sich unterschiedliche Einstellungen zur Flüchtlingspolitik. Wer mit Informationen über die prekäre Lage von Schutzsuchenden konfrontiert wird, neigt demnach eher zu Mitgefühl und befürwortet aufnahmefreundliche Politiken; wer hingegen auf potenziell negative Folgen von Zuwanderung hingewiesen wird, zeigt sich zurückhaltender oder ablehnender. Zur Überprüfung ihrer Annahmen führten die Autor:innen im Mai 2023 ein large-scale online survey experiment mit einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung durch. Die Versuchsgruppe sah dabei eines von vier kurzen Informationsvideos über syrische Geflüchtete in der Türkei. Diese Aufnahmen folgten jeweils einem anderen Deutungsmuster: zwei Videos stellten die humanitäre Notlage in den Vordergrund, zwei die sicherheitspolitischen Risiken. Zudem variierte, ob in den Clips Familien oder junge Männer gezeigt wurden. Im Anschluss beantworteten die Teilnehmenden einen Fragebogen, in dem sowohl ihre humanitären Sorgen – etwa um Sicherheit, Gesundheit und Zukunftschancen der Geflüchteten – als auch ihre Befürchtungen für Wirtschaft, Sozialstaat, Sicherheit, Kultur erfasst wurden. Außerdem wurden ihre Präferenzen bezüglich verschiedener fiktiver politischer Petitionen (pro-refugee policy preferences) abgefragt. Die statistische Auswertung der Umfrageergebnisse zeigt, dass das Ausmaß des Mitgefühls von Personen neben deren individueller humanitarian orientation auch durch persönliche Charakteristika von Geflüchteten sowie von deren Lage beeinflusst wird. Die migrationspolitische Einstellung der Personen verhält sich hierbei jedoch keineswegs gleichförmig:
“Moreover, we demonstrate the relevance of measuring the pathways through which a treatment is channeled. This matters, among other things, because manipulating a single variable may affect both humanitarian concerns and perceived threats simultaneously. For example, when highlighting the presence of families among refugees, this led to increases in both concerns for the refugees’ safety as well as in perceived welfare threat.” (S. 20)
Die Regressionsanalyse ergibt, dass Frames, die Geflüchtete ausschließlich als Familien darstellen, bei Testpersonen sowohl die Sorge um die Sicherheit von Geflüchteten als auch die Sorge um eine Gefährdung des deutschen Wohlfahrtsstaats verstärken. Die Zunahme von humanitarian concerns hat demnach nicht zwangsläufig eine geringere Gefahrenwahrnehmung zur Folge – und umgekehrt. Entgegen dem Eindruck, den polarisierte Migrationsdebatten hervorrufen, verhalten sich migrationspolitische Einstellungen somit nicht eindimensional zueinander. Je nach Framing weisen Personen nicht automatisch extreme Einstellungen pro oder contra Immigration auf. Stattdessen zeigt die Analyse, dass bei den meisten Personen in sich widersprüchliche Gefühle gegenüber der Immigrationspolitik vorherrschen, die sich je nach medialem und persönlichem Kontext multidimensional und verschieden ausprägen. In Bezug auf den persönlichen Kontext zeigt sich beispielsweise, dass die Konfrontation mit Frames einer Notlage die humanitären Überzeugungen von Personen, die sich politisch links positionieren, stärker positiv beeinflusst. Die Analyse kommt für den deutschen Fall zudem schließlich zu dem Ergebnis, dass sich je nach demografischer Herkunft der Testpersonen – aus Ost- oder Westdeutschland – unterschiedliche Reaktionen auf die Frames beobachten lassen:
“We also documented that East and West Germans differ largely in how they respond to the frames, which is different from the – more widely known – fact that attitudes toward immigration differ across this geographical divide (Lange 2021; Wieland 2024). Interestingly, attitudes of East and West Germans look similar in our comparison group. However, East Germans are affected much more negatively in their attitudes and policy preferences by our frames than their West German counterparts. The reasons for these different reactions could be explored in future research.” (S. 19)
Die Erkenntnisse zur Multidimensionalität migrationspolitischer Einstellungen unterstützen das Argument Andreas Funkes, dass eine deliberative Diskussion des individuellen Rechts auf Asyl durchaus möglich ist, ohne dass die humanitäre Grundlage der Migrationspolitik zwangsläufig verloren geht. Nur weil eine Diskussion die Schwächen des Asylrechts thematisiert, bedeutet das nicht, dass Menschen ihre humanitären Bedenken verlieren. Inwiefern diese Gleichzeitigkeit von Mitgefühl und sicherheitspolitischen Sorgen in einem Diskurs, der – wie Kasparek und Tsianos betonen – zunehmend von rechten Polarisierungsunternehmern dominiert wird, bestehen bleibt, wäre künftig zu beobachten. Die Studie misst ausschließlich die Wirkung einzelner Videosequenzen auf die Testpersonen, nicht aber die langfristige Verschiebung des gesamten Diskurses von einer liberalen hin zu einer restriktiven Flüchtlingspolitik. Ob humanitäre Grundsätze folglich in den nächsten zehn Jahren noch dieselbe Rolle spielen werden wie zu Zeiten von Merkels „Wir schaffen das!“, ist angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen mehr als ungewiss.
Fußnoten
- Elisabeth Schmidt-Ott, 10 Jahre Flüchtlingssommer. Chronologie des ‚Flüchtlingsjahrs‘ 2015, in: Mediendienst Integration, 24. August 2025; online unter: https://mediendienst-integration.de/artikel/chronologie-des-fluechtlingsjahrs-2015.html [9. September 2025].
- Eurostat, Asyl in den EU-Mitgliedstaaten. Rekordzahl von über 1,2 Millionen registrierten erstmaligen Asylbewerbern im Jahr 2015. Syrer, Afghanen und Iraker an erster Stelle, in: Eurostat – Pressemitteilung, 4. März 2016, S. 2; online unter: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203837/3-04032016-AP-DE.pdf/9fcd72ad-c249-4f85-8c6d-e9fc2614af1b [9. September 2025].
- Streng genommen bezeichnet Flüchtlingspolitik nur den staatlichen Umgang mit Menschen, die aus Gründen politischer Verfolgung fliehen. Die hier behandelten Artikel konzentrieren sich vor allem auf das individuelle Asylrecht, das somit ebenfalls unter Flüchtlingspolitik fällt. Da Änderungen im Asylrecht darüber entscheiden, wer rechtlich als Geflüchteter gilt und wer nicht, verwende ich ebenfalls den weiter gefassten Begriff der Migrationspolitik. Er umfasst alle politischen Maßnahmen, die grenzüberschreitende Bewegungen beeinflussen sollen.
- Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010.
- René Schlott, ‚WIR SCHAFFEN DAS!‘. Vom Entstehen und Nachleben eines Topos, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 70 (2020), S. 30–32, 8–13.
- CDU/CSU, Politikwechsel für Deutschland. Kurzfassung, Wahlprogramm von CDU und CSU, Januar 2025, online unter: https://www.cdu.de/app/uploads/2025/01/politikwechsel-fuer-deutschland-wahlprogramm-von-cdu-csu-kurzfassung.pdf [9. September 2025].
- Paul Middelhoff, Migrationsgipfel Zugspitze. Ansage von ganz oben, in: Die Zeit, 18.7.2025; online unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-07/alexander-dobrindt-migrationspolitik-nachbarlaender-zugspitze-gipfeltreffen [9. September 2025].
- Der Tagesspiegel, Kommunen überfordert, Gesellschaft verunsichert. CDU-Generalsekretär Linnemann kritisiert Merkels Flüchtlingspolitik scharf, in: Der Tagesspiegel, 30. August 2025; online unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/kommunen-uberfordert-gesellschaft-verunsichert-cdu-generalsekretar-linnemann-kritisiert-merkels-fluchtlingspolitik-scharf-14250689.html [9. September 2025].
- Jan Bielicki, 10 JAHRE ‚WIR SCHAFFEN DAS‘. Haben wir es geschafft?, in: Süddeutsche Zeitung, 23.8.2025, S. 2. Die erwähnten Aussagen von Petra Bendel, Yuliya Kosyakova, Naika Foroutan, Ruud Koopmans und Birgit Glorius geben lediglich einen Bruchteil der im Artikel vertretenen Einschätzungen wider.
- Friederike Haupt, Fast fünfzig Prozent mehr rechtsextreme Straftaten. Bundesinnenminister Dobrindt stellt Verfassungsschutzbericht vor, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.6.2025, S. 2.; Ohne Autor, „Merz wollte AfD wegregieren - nach 100 Tagen noch nicht gelungen“, in: Agence France Presse, 14.8.2025.
- Die Formulierung zur Unterscheidung zwischen dem Schutz vor oder von Migrant:innen geht auf folgendes Buch zurück: Ludger Pries, Migration. Warum man sie nicht steuern kann – aber verstehen und mitgestalten, Weinheim 2025, S. 28.
- Josef Kelnberger, EU-Migrationspolitik. Merz schließt sich dem Lager der Hardliner an?, in: Süddeutsche Zeitung, 25.6.2025; online unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-asyl-migrationspolitik-merz-meloni-zusammenarbeit-li.3273913?reduced=true [9. September 2025].
- Kai-Olaf Lang, Im Zeichen der Sicherheit: Die Migrationskrise an der polnisch-belarusischen Grenze im Herbst 2021, in: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 8.7.2022, online unter: https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/509958/im-zeichen-der-sicherheit-die-migrationskrise-an-der-polnisch-belarusischen-grenze-im-herbst-2021/ [9. September 2025].
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Jens Bisky.
Kategorien: Affekte / Emotionen Europa Internationale Politik Migration / Flucht / Integration Politik Rassismus / Diskriminierung Recht
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Geschichte vor Ort
Rezension zu „Blumen und Brandsätze. Eine deutsche Geschichte, 1989–2023“ von Klaus Neumann
Schluss mit „Das war eben damals so“
Rezension zu „Rassismus begreifen. Vom Trümmerhaufen der Geschichte zu neuen Wegen“ von Susan Arndt
Weder Bilanz noch Vorschlag
Rezension zu „Die Asyllotterie. Eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg“ von Ruud Koopmans