Armin Steinbach | Rezension | 29.09.2021
Den Staat entfesseln
Rezension zu „Der entzauberte Staat. Was Deutschland aus der Pandemie lernen muss“ von Moritz Schularick
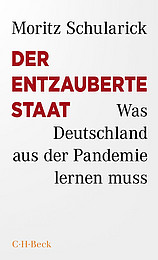
Ein gängiges Krisennarrativ handelt vom Argwohn gegenüber einer ausgreifenden Exekutive, die in der Krise die Gunst der Stunde erblickt und das engmaschige rechtsstaatliche Korsett abstreift. Unter dem Vorwand der Handlungsfähigkeit kokettiere die Regierung mit den Sachzwängen des Ausnahmezustands, unterlaufe das Regelungsprimat des Gesetzgebers und schleife individuelle Freiheiten. In das Raunen über den selbstbestimmten Ausnahmezustand mischt sich auch ein Unbehagen über die Selbstverzwergung des Parlaments gegenüber dem ministerialen Aktivismus. Im letzten Jahr hatte der Passauer Verfassungsjurist Tristan Barczak eine Analyse vorgelegt – Der nervöse Staat –, die das Wesen des Pandemiestaates auf den Punkt zu bringen schien. Der nervöse Staat ruhe nie, betreibe aus Angst vor Krisen ständig Ausnahmezustandsvorsorge und operiere in einem Modus permanenter Alarmbereitschaft.[1] Barczaks Studie traf unter Juristen auf Zustimmung, bestätigte sie doch den in der Pandemiekrise naheliegenden soupçon, man habe es mit einer hypersensiblen und auf Aktivierung wie Ausweitung ihrer Handlungsmöglichkeiten bedachten Exekutive zu tun.
Weitaus weniger planvoll und ambitioniert agiert der Staat hingegen in der Analyse von Moritz Schularick, dafür viel zu bürokratisch, unentschlossen und verhandlungsversessen. Der Bonner Ökonom dekonstruiert einen entzauberten Staat, der in der Pandemiekrise durch seine Schwerfälligkeit und Handlungsschwäche manifestiert habe, wie schlecht gewappnet er in Wahrheit für Großherausforderungen wie etwa den Klimawandel sei. Seine Analyse atmet den Geist permanenten Staatsversagens. „Anmeldeportale gingen nicht, Hotlines gingen nicht, Impfen am Wochenende ging nicht, Gurgeltests gingen nicht, Erfassung von Patientendaten in einem nationalen Pandemie-Register ging schon gar nicht“ (S. 37) – nichts gelingt im „Geht-nicht“-Staat, dessen Politik durch erratische Entscheidungen ebenso gelähmt werde wie durch verworrenes Regelungsdickicht. Von dieser Defizitanalyse ist der Weg zum Ausnahmezustand nicht weit und Schularicks Faible für das US-amerikanische Kriegsrecht, wo nicht „wochenlang kontrovers diskutiert“, sondern „einfach gemacht wird“, wird bei ihm zur Chiffre für den handlungsfähigen Staat, befreit von einlullenden Verhandlungsnächten und rechtlichem Korsett (S. 89). Nur Kopfschütteln hat der Autor übrig für den Hemmschuh Datenschutz, sehnt sich nach effektiver Warn-App-Verfolgung der Infizierten wie in Korea und flexiblen Brandschutzvorschriften, die der Installation von Luftfiltern in Klassenzimmern nicht im Wege stehen.
Dekonstruktionen des handlungsunfähigen Staates haben sich zu einem populären Post-Krisen-Genre gemausert. Unter dem Brennglas des Krisenmanagements rückt die Rolle des Staates, insbesondere der Exekutive, in den Fokus kritischer Begutachtung. Robin Alexander hatte die politischen Akteure der Migrationskrise als Getriebene charakterisiert, versiert im politischen Manövrieren und Intrigieren, aber ohne Prinzipien und verstrickt in opportunistisches Mikromanagement.[2] Ähnlich entlarvte Adam Tooze in Crashed die multiplen Finanzkrisen teils als Produkte des Unvermögens einzelner politischer Akteure, teils als Ausflüsse institutionellen Versagens.[3] Verbleiben diese Studien noch in der analytischen Distanz kritischen Beschreibens, spitzt Schularick seinen Befund „mangelnder politischer Führungsstärke und Verzagtheit“ auf die Forderung nach einem Mentalitätswandel zu, der die notorische Regelorientierung der Deutschen zugunsten eines „risikobereiten Mindsets“ seiner Akteure überwinden soll (S. 123). Inhaltlich enthält das Erneuerungsprogramm des Autors zwar viel Richtiges – mehr Investitionen, eine moderne digitale Verwaltung, weniger Bürokratie. Hinzuzufügen wäre außerdem, dass angesichts der Mehrebenen-Governance zwischen EU, Bund und Ländern im Krisenfall die Vorteile subsidiär-dezentraler Lösungen hinter den Nachteilen langwieriger Abstimmungsprozesse zurücktreten und damit ein Bedürfnis nach Entscheidungsbündelung wecken, um Handlungsfähigkeit zu bewahren.
Allerdings täte der beißenden Kritik am Zick-Zack-Kurs der Regierung in Sachen Lockdown-Maßnahmen, Teststrategie oder Impfstoffbeschaffung ein bisschen mehr Karl Popper gut. Zu würdigen wäre ein notgedrungen im Trial-and-rror-Modus agierender Staat, der eine Lernkurve besteigt, gar nicht anders als mit Annäherungen arbeiten kann und erkannte Fehler vergleichsweise zügig revidiert. Ist Popper doch genau das: Der von außen betrachtet schlingernde Kurs im Infektionsschutzgesetz mit seinen sich ändernden Schwellen und Beschränkungen dokumentiert nicht Staatsversagen, sondern die Praxis eines lernenden Staates. Wie wenig selbst die Wissenschaft vor derartigen Lernprozessen gefeit ist und war, zeigen die sich wandelnden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission für die Verimpfung von Astra Zeneca – das Privileg, aus Irrtümern lernen zu können, sollte auch den politischen Akteuren zugestanden werden, zumal unter Krisenbedingungen.
Schularicks Plädoyer für eine Risikotoleranz als Mentalitätswandel sollte deshalb eher als ein Impuls aufgegriffen werden, eine neue Fehlerkultur zu etablieren. Staatliches Handeln neigt zur Risikominimierung und Fehlervermeidung, es konserviert zu häufig den Status quo. Berechtigte Erwartungen an einen der Sparsamkeit, Rechtmäßigkeit und Sicherheit verpflichteten Staat befördern die Entscheidungsunlust seiner Akteure von innen her. Von außen wird sie zudem stabilisiert durch das in (Sozialen) Medien grassierende Vergnügen daran, institutionelles Versagen und staatliche Ineffizienz anzuprangern. Demgegenüber würde eine neue Fehlerfreundlichkeit Explorationsspielräume eröffnen: Sie anerkennt, dass Innovationen eine Folge von Versuch und Irrtum sind, dass ein unternehmerischer Staat genauso wie jedes andere Unternehmen auch scheitern darf. Institutionell sind Einrichtungen wie die Bundesagentur für Sprunginnovationen Ausdruck einer derartigen Fehlertoleranz: Der innovierende Staat muss auch Millionen in den Sand setzen dürfen. Umgekehrt kann nicht der Staat allein Adressat des geforderten Mentalitätswandels bleiben. Fehlerfreundlichkeit bedeutet im Infrastrukturstaat, dass nicht allen Partizipationsmöglichkeiten und Klagebegehren entsprochen werden kann, dass Planungen umgesetzt und Verwaltungsentscheidungen vollzogen werden.
Schularick treibt – pro domo – noch ein weiteres Anliegen um: Das Versagen des Staates mache sich nicht zuletzt in unzureichender Einbindung der Wissenschaft bemerkbar, für den Autor beispielhaft illustriert durch die unterlassene harte Lockdown-Notbremse und das generelle Herumlavieren der Politik (S. 57 ff.). Der entfesselte Staat hingegen paart sich bei Schularick mit einer Wissenschaftsgläubigkeit nach dem Vorbild (auch hier) der USA durch stärkere Einbindung von Wissenschaftlern in das Regierungshandeln, und zwar „direkter und in Echtzeit in den Entscheidungsprozess eingebettet“ (S. 126). Das verspricht bei ihm Heilung des von Inkompetenz geplagten politischen Systems. Die häufig von der Ökonomenzunft verschriebene Rezeptur, durch importierten Sachverstand Politik zu rationalisieren, kaschiert jedoch ein gewisses Fremdeln mit den Mechanismen politischer Entscheidungsfindung. Die institutionalisierte Kompromissfindung, verkörpert durch ministeriales Ressortprinzip, Bund-Länder-Gremien oder Koalitionsschlüsse, bildet den Rahmen, in dem sich Politik nicht als Erkenntnisprozess mit dem Ziel der Wahrheitsfindung darstellt, sondern als das aufwändige und häufig auch aufreibende Unterfangen, einen Ausgleich zwischen heterogenen Interessen herbeizuführen. Diese Realität steht im Kontrast zu denjenigen wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, die Regierungen als benevolente Diktatoren modellieren – allwissend und fähig, die optimalen Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Solche Projektionen suggerieren, das Gemeinwohl lasse sich als Resultat erkenntnisgeleiteter Verständigung kompetenter Politiker und Experten etablieren. Im Fazit könnte die Lektion aus der Pandemiekrise bei Barczak und Schularick unterschiedlicher nicht ausfallen: Während der eine die Handlungsspielräume des Staates restringieren, die Exekutive von den Mühsalen der Verhandlungsdemokratie nicht entbinden will, sieht der andere in den Einhegungen des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips Bremsklötze für effektives Krisenhandeln.
Wenig hat diese Vorstellung mit einer ergebnisoffenen Verständigung über ein Gemeinwohl zu tun, das doch nichts von Wissenschaftlern Feststellbares sein kann, sondern wie eine Diagonale durch das gesellschaftliche Kräftefeld führt. In der Tat erinnert die Version einer zu verwissenschaftlichenden Politik an ein in den 1950er-Jahren populäres expertokratisches Trugbild, das suggerierte, aus wissenschaftlichen Einschätzungen ließen sich politische Tatsachen machen. Dabei ist nicht nur die Sphärentrennung zwischen Wissenschaft und Politik unscharf, auch die zugrundeliegende Vorstellung einer mit Max Weber postulierten Werturteilsfreiheit der Wissenschaft liefert allenfalls ein Zerrbild der Realität: dort das politische Ziel, hier die wertneutrale Wissenschaft, die für sich reklamiert, die Politik in der Wahl der Mittel beraten sowie die Wirkungen und Nebenwirkungen der getroffenen Entscheidungen sicher prognostizieren zu können. Dass auch Wissenschaft, selbst ihre empirisch fundierten Disziplinen, nicht ohne explizite oder implizite Wertungen auskommen, ist längst unstrittig.
Hinzu kommt, dass die Forderung vieler Wissenschaftler an die Politik, ihrer Stimme mehr Gewicht zu geben, eine schlichte Beziehung zwischen einer Ein-Ziel-Politik und den Instrumenten ihrer Umsetzung vortäuscht. Dabei sollte doch klar sein, dass Politik in der Pandemie nie allein danach streben konnte, das effektivste Mittel zur Pandemieeindämmung zu ergreifen, genauso wie sie sich angesichts der Klimakrise nicht darauf bornieren darf, nur das wirkungsvollste Mittel zur CO2-Reduktion auszumachen. Immer geht es darum, mehrere Ziele und Nebenbedingungen auszutarieren, Freiheiten und sozialen Ausgleich mitzudenken. Damit erwirbt der demokratische Prozess kein Gütesiegel auf wissenschaftliche Rationalität, soll es aber auch nicht. Ob stärkere Einbindung der Wissenschaft in politisches Entscheiden schließlich zu größerer Akzeptanz von Politik führt, darf nach den Erfahrungen vieler Länder mit expertokratischen Ansätzen bezweifelt werden. Sicher aber würde sie den aktuellen Trend verstärken, geistige Führungsfiguren mit unklaren Zuständigkeiten und großer Medienpräsenz zu erzeugen. Caspar Hirschi hat deshalb eine durchsichtige Rollentrennung eingefordert, um die Neutralität wissenschaftlicher Expertise zu sichern: „Wer als Experte Politik berät, kann nicht gleichzeitig als Aktivist auf Twitter auftreten, als Kritiker in den Medien Stellung beziehen oder als Intellektueller öffentliche Manifeste unterschreiben.“[4]
Politisches Handeln bleibt gerade im Krisenmodus durch die vielfältigen Wissenslücken und Prognoseschwächen auf externe Expertise angewiesen – hier ist Schularick zuzustimmen. Das gilt insbesondere auf dem Gebiet der Daten – evidenzbasierte Politik als Ausdruck einer elaborierten Fehlerkultur ermöglicht den Zugang zu Daten und deren wissenschaftlichen Auswertung, um möglichst effektive Maßnahmen zur Erreichung politischer Ziele zu identifizieren. Eine Herausforderung besteht darin, dieses Wissen in die Verästelungen ministerialer Organigramme zu kanalisieren, in denen die fachlichen und disziplinspezifischen Dimensionen des Krisenmanagements kleingearbeitet werden. Interdisziplinäre Verständigung ist dabei entscheidend: In der COVID-19-Krise stand die Disziplinrationalität der Epidemiologen gegen die Rationalität von Kinderärzten oder den Rat der Pädagogen. Plural-monodisziplinär vorgebrachte Evidenz kann nur in einem politischen, von Wertungen angeleiteten Abwägungsprozess rezipiert und für eine Entscheidung (mit-)berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist das Verhältnis von Wissenschaft und Politik nur im reziproken Sinne fruchtbar: Die in der externen Expertise häufig übergangenen Fallstricke des Verwaltungs- und Rechtsstaates, etwa die administrativen Hürden von Datenschutz, Haushaltsordnung und Vergaberecht, müssten gerade auch vom wissenschaftlichen Ratgeber internalisiert werden. Am ehesten gelingt das in den über die Ministerien dezentral verteilten, nach Professionen und Disziplinen ausdifferenzierten Austauschforen – sie schaffen permeable Grenzen zwischen Wissenschaft und Politik, ohne die Trennung zwischen politischer Ausgleichsleistung und wissenschaftlicher Evidenzbasierung zu verwässern, und ermöglichen damit eine ergebnisoffene Organisation von Expertise.
Fußnoten
- Tristan Barczak, Der nervöse Staat. Ausnahmezustand und Resilienz des Rechts in der Sicherheitsgesellschaft, Tübingen 2020.
- Robin Alexander, Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht, München 2017.
- Adam Tooze, Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben, übers. von Norbert Juraschitz, Karsten Petersen und Thorsten Schmidt, München 2018.
- Caspar Hirschi, Kalkül schlägt Kompetenz, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.3.2021, S.11.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Martin Bauer.
Kategorien: Politik Staat / Nation Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
The COVID-19 Crisis from a German, European and International Perspective
Three-Part Online Discussion Series of the Institute for International Law of Peace and Armed Conflict and Verfassungsblog
Was lehrt die Schule des Südens?
Folge 24 des Mittelweg 36-Podcasts
