Peter Wagner | Rezension | 17.11.2025
Gegenseitige Traumatisierung
Rezension zu „Brutale Nachbarn. Wie Emotionen den Nahostkonflikt antreiben – und entschärfen können“ von José Brunner
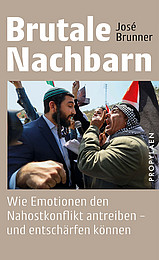
Der andauernde Krieg und die Gewalt in Palästina lassen uns hilflos und empört zurück. Kriege enden. Sie enden mit der Niederlage einer Seite oder mit der Erschöpfung aller Beteiligten. Dieser Krieg und diese Gewalt aber scheinen nie zu Ende zu gehen: Es gab bereits vor der Gründung des Staates Israel Auseinandersetzungen, danach gab es einen Krieg aus Anlass der Gründung und seitdem gibt es eine Serie von Kriegen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit unterschiedlicher Form, Intensität und Dauer. Die Serie wird zeitweilig unterbrochen, wenn Israel seine militärische Überlegenheit demonstriert, garantiert durch die Vereinigten Staaten und weitere westliche Mächte. Und sie findet ihre Fortsetzung aufgrund von – im weitesten Sinne – Reaktionen auf die erfahrene Demütigung durch die zur Schau gestellte Machtasymmetrie und auf die Unerträglichkeit der Lebensbedingungen am Westufer des Jordan und im Gazastreifen, wie etwa in der ersten und zweiten Intifada.
Warum geht die Gewalt in Nahost nicht zu Ende? Dies ist die Frage, die José Brunner in Brutale Nachbarn stellt und in neuer Weise zu beantworten versucht. Im Hintergrund stehen zwei Beobachtungen, die zeigen, wie festgefahren der Konflikt ist. Zum einen: Alle Vorschläge zur Konfliktbewältigung, die meisten davon bestanden aus einer mit internationaler Unterstützung kreierten Teilung des Territoriums, sind gescheitert. Mehrere von ihnen haben sogar weitere Gewaltaktionen provoziert, weil sie aus Sicht einiger der Beteiligten unzumutbare Komponenten enthielten. Zum anderen: Gegenwärtig teilen sich die weltweiten Reaktionen auf die Gewalt recht klar in propalästinensische Demonstrationen und Israel-freundliche Positionen – oder zumindest werden die Reaktionen in den Medien und der Politik als solche säuberlich etikettiert. Für Mehrdeutigkeiten scheint kein Platz zu sein. Um die scheinbare Ausweglosigkeit zu überwinden, ist ein tiefergehendes Verständnis dieser Brutalität unter Nachbarn erforderlich.
Mehr noch als in vorangegangenen Kriegsphasen ist es höchst voraussetzungsvoll geworden, über den Konflikt überhaupt sprechen zu können und gehört zu werden. So konnte (und kann) in westlichen Ländern kaum israelische Gewalt thematisiert werden, ohne zunächst den brutalen Überfall der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 zu erwähnen. Aber „Denkverbote“ (S. 25) müssen überschritten, „Tabuisierung“ (S. 204–206) durchbrochen, „Denkfehler“ (S. 26 f.) korrigiert und „Gedankensperren“ (S. 203) beiseite geräumt werden, um den Konflikt angemessener zu verstehen. José Brunner überschreitet zunächst ein „israelisches Denkverbot“ (S. 25), indem er die Hamas-Attacke in den weiteren Kontext der israelisch-palästinensischen Beziehungen stellt. Der erste Teil seines Buches ist daher eine politisch-historische Rekonstruktion des Konflikts, die darauf besteht, dass keine einzelne lineare Narration der komplexen Geschichte gerecht wird. Zugleich arbeitet Brunner heraus, dass der Geschichtsverlauf trotz seiner vielen Wendungen auf beiden Seiten eine psychologische Verfassung und Geisteshaltung geschaffen hat, die die andauernde Brutalität fördern.
Brunners nuancierte Rekonstruktion kann ich hier nicht wiedergeben. Er erinnert daran, dies sei beispielhaft erwähnt, dass im Zuge des sogenannten Oslo-Prozesses im Jahre 1998 ein Flughafen in Gaza eröffnet wurde, den internationale Fluggesellschaften anflogen, also „Gaza nicht immer das Gefängnis war, das es heute ist“ (S. 48). Mittlerweile aber hat sich in Israel die Auffassung verfestigt, in Gaza lebten „überflüssige“ Menschen, ein Wort von Hannah Arendt verwendend. Die Bevölkerung in Gaza wehrt sich daher nicht nur gegen ihre materiellen und politischen Bedingungen, sondern auch gegen einen „Seelenzustand“, das „Gefühl der Wertlosigkeit“ (S. 41). Insofern die israelische Haltung ebenso wie Israels militärische und politische Handlungen Gazas Bevölkerung entmenschlichen, kann die Grausamkeit am 7. Oktober als „Rache für die Dehumanisierung der Palästinenser verstanden werden“ (S. 53). Dabei dürfen wir instrumentelle Erwägungen aufseiten sowohl der israelischen Regierung als auch der Hamas nicht übersehen. Auch für Hamas gilt: „Wenn man sich barbarisch gegenüber anderen verhält, dehumanisiert man sich zugleich auch selbst.“ (S. 54)
Die Weigerung, die Existenz des anderen zu akzeptieren, hat sich dadurch verstärkt, dass sich der Konflikt von einem nationalen zu einem religiös gerechtfertigten gewandelt hat, der sich auf religionsgeschichtlich begründete und unverhandelbare Gebietsansprüche stützt.
José Brunner betont wiederholt die „enorme Asymmetrie des Konflikts“ (S. 77), zugleich will er aufzeigen, wie im Konfliktverlauf auf beiden Seiten – gegenwärtig befördert von der Hamas sowie der israelischen Regierung und ihren jeweiligen Unterstützern – eine Mentalität „absoluter Feindseligkeit“ (ebd.) entstanden ist. Er greift zu deren Kennzeichnung auf den von Achille Mbembe geprägten Begriff der Nekropolitik zurück, deren Kern in der physischen Auslöschung des Feindes besteht. Die Weigerung, die Existenz des anderen zu akzeptieren, hat sich dadurch verstärkt, dass sich der Konflikt von einem nationalen zu einem religiös gerechtfertigten gewandelt hat, der sich auf religionsgeschichtlich begründete und unverhandelbare Gebietsansprüche stützt. Für die psychologische Verfassung Israels ist dabei die Entstehung eines „bösartigen Narzissmus“ (S. 82) zentral – ein Begriff, der auf den Psychoanalytiker Heinz Kohut zurückgeht. Mit der Hamas-Attacke am 7. Oktober 2023 zerbrach die „Illusion der Omnipotenz“ (S. 80), die Israel über Jahrzehnte, nämlich seit dem Krieg von 1967, entwickelt hatte: Die Gewissheit militärischer, politischer, wirtschaftlicher und moralischer Überlegenheit ist „Ausdruck einer Fassade, hinter der existenzielle Ängste unbewusst weiter bestehen“ (S. 84). Allerdings, so hebt Brunner hervor, entstand vom 1973er-Krieg bis zur ersten Intifada (ab 1987) auf beiden Seiten zeitweilig ein „gutartiger Narzissmus“, der „rehumanisierende“ und „konstruktive Gewalt“ ausübte (S. 93 f.), indem nämlich etwa durch Steinewerfen Dialog erreicht werden und nicht der Gegner gedemütigt oder vernichtet werden sollte. Die zweite Intifada ab 2000, provoziert durch den damaligen israelischen Oppositionspolitiker Ariel Scharon, führte jedoch zu einer „langen Phase, in der ein zerstörerischer Narzissmus schrankenlos die Oberhand hat“: „Von einem bösartigen, nekropolitischen Narzissmus angetrieben, stürzen sich beide Seiten ungebremst in die Sackgassen des Absoluten.“ (S. 100–102)
Vor dem Hintergrund der historisch-politisch-psychologischen Rekonstruktion thematisiert der zweite Teil des Buches die psychischen Folgen des anhaltenden Konflikts. Der Hamas-Angriff war für Israelis ein traumatisches Ereignis, das das „Selbst- und Weltbild langfristig erschüttert“ (S. 105). Das Trauma wurde dadurch verstärkt, dass der Überfall im israelischen Selbstverständnis „nicht hätte passieren dürfen“ (S. 110). Zudem blieb Hilfe für viele Stunden aus, weshalb sich die Israelis „verraten und verlassen“ fühlten (S. 110). Viele werden wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) psychologisch betreut. Umgekehrt traumatisiert die Verwüstung Gazas durch israelische Streitkräfte die dortige Bevölkerung.[1] Individuelle psychologische Betreuung ist in Gaza selten möglich; sie ist im arabisch-muslimischen Raum auch weniger akzeptiert. Wichtiger noch ist, dass eine posttraumatische Störung nur diagnostiziert werden kann, „wenn Gewalt oder Gefahren in der Wirklichkeit nicht mehr präsent sind und dennoch im Kopf der Betroffenen weiter inszeniert werden“ (S. 132). Da aber die Gewalterfahrung und der Sicherheitsverlust in Gaza anhalten, spricht man besser, der Psychologin Gillian Straker folgend, von „kontinuierlichem traumatischen Stress“ (S. 133).
In der Psychologie und Psychiatrie bezieht sich der Begriff des Traumas auf einzelne Personen; mit gebotener Vorsicht lässt er sich aber auch auf ganze Bevölkerungen übertragen, die gemeinsam radikal verunsichernde Erfahrungen machen – so kann man von kollektiven Traumata sprechen. Diese Übertragung wird oft und begründeterweise für Israel und den 7. Oktober gemacht. Es überrascht aber, so José Brunner, dass hierbei von Erinnerungen an den Holocaust die Rede ist, mit dem – bei aller Grausamkeit – die Hamas-Attacke kaum verglichen werden kann. Brunner erkennt den Holocaust als „gewähltes Trauma“, dem Psychoanalytiker Vamık Volkan folgend, der diesen Begriff verwendet, wenn ein „Kollektiv – zwar unbewusst, aber letztlich eben doch – die Wahl getroffen hat, [ein bestimmtes] Ereignis zu einer fundamentalen Erfahrung, seine Identität definierenden Erfahrung zu machen“ (S. 137).[2] Obgleich die Parallelität zwischen den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und der Hamas-Attacke historisch wenig plausibel ist, erlaubt diese Verknüpfung recht umstandslos die „politische Instrumentalisierung des Holocausts“ (S. 139) zur Rechtfertigung der Kriegführung in Gaza. „Traumata sind nicht nur Folgen politischer Gewalt, sie haben auch politische Folgen.“ (S. 139)
Die Ungewissheit, der sich viele jüdische Holocaust-Überlebende oft für lange Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt sahen, führte zu einer „nachträglichen Verschärfung ihrer Holocaust-Traumata“ durch eine „Chronifizierung der Vorläufigkeit“ (S. 147 f.), ein Begriff von David Becker und Barbara Weyermann. Es ist erstaunlich, wie Einwanderer nach Palästina ihr Streben nach einer sicheren Existenz darauf aufbauten, die dort lebende Bevölkerung in eine traumatisierende „Vorläufigkeit“ zu stoßen, die über Jahrzehnte – bis heute – anhalten sollte.[3] So erscheint die Nakba, die Zerstörung der palästinensischen Gesellschaft, als das „gewählte Trauma“ der Palästinenser. Aber auch hier sind die Parallelen begrenzt. Zum einen bestimmt das Machtgefälle zwischen Israelis und Palästinensern die Lebensbedingungen in der Region, die anhaltende, kumulative Traumatisierung der Palästinenser führt dazu, dass die Nakba nicht Geschichte werden kann. Zum anderen erzählt sich die israelische Gesellschaft aufgrund ihrer wiederholten militärischen Erfolge und trotz der anhaltenden Bedrohungen „eine Geschichte der Resilienz“, die über die erfahrenen Traumata hinausweist. Allerdings hat die Hamas-Attacke die Gewissheit der Resilienz unterminiert, was die gegenwärtige Situation prägt: „Psychologisch gesehen, ist der Nahostkrieg ein Versuch, der Gesellschaft der Angreifer ein kollektives Trauma zuzufügen, das das eigene in den Schatten stellt, damit man darüber hinwegkommen kann. Der Vernichtungskrieg als Selbsttherapie, sozusagen. Das kann nicht gelingen.“ (S. 168 f.)
Der dritte Teil des Buches thematisiert die Frage, wie man gesellschaftlich mit der Brutalität lebt, die man nicht nur erleidet, sondern auch selbst ausübt. Israelis sind mit sich selbst zufrieden, glaubt man den Ergebnissen der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung. Wie aber vereinbart sich diese Selbstzufriedenheit mit dem Wissen um die Brutalität, die sie gesellschaftlich gegenüber ihren Nachbarn ausüben? Zur Beantwortung dieser Frage zeigt Brunner auf, inwiefern das Bestreben, die eigene Angst zu kontrollieren, anders gesagt: sich einzubilden, man habe alles im Griff, paranoide Spaltungen mit kategorischen Freund-Feind-Unterscheidungen hervorbringt, „wenn die Inszenierung der Angstkontrolle in sich zusammenfällt“(S. 180) – wie am 7. Oktober. In der Folge sieht sich die israelische Gesellschaft als Opfer, „das gezwungen ist, sich zu verteidigen, sich zu rächen, die Feinde zu strafen und abzuschrecken“ (S. 186), und der öffentliche Diskurs macht Andersdenkende in Israel zu Außenseitern und außerhalb zu angeblichen Antisemiten.
Dennoch bleibt die Frage offen, wie sich die weithin sichtbare und bekannte Gewaltausübung mit dem moralischen Selbstbild der israelischen Gesellschaft vereinbaren lässt. Um mit dieser „ethischen Dissonanz“ zu leben, braucht es psychologische Schutzschilde, Abwehrmechanismen, von denen Brunner fünf hervorhebt (S. 196–206): „Rationalisierung“ betont, es gäbe keine Alternative; „Isolierung“ hält das unmoralische Verhalten vom übrigen Leben fern; „Verleugnung“ verneint die Existenz dessen, was das Selbstbild stören könnte; „Klischees“, wie jene vom gerechten Krieg und der moralischen Armee, dienen als Gedankensperren; und „Tabuisierung“ grenzt Kritiker aus dem erlaubten öffentlichen Diskurs aus. Die säkularen Eliten Israels mobilisieren diese Abwehrmechanismen, um ihr moralisches und demokratisches Selbstbild aufrechtzuerhalten. In einer der beunruhigendsten Passagen des Buches skizziert Brunner, wie ein Teil der israelischen Gesellschaft, vor allem unter den Siedlern im Westjordanland, nunmehr „jenseits von Schuld und Scham“ (S. 207) lebt und sich offen zum „Prinzip Rache“ (S. 211) bekennt.
Die Spaltung in Freund und Feind, die implizit verlangt, dass die andere Seite irgendwie verschwindet, ist gerade wegen ihrer Simplifizierung emotional befriedigend und zugleich politisch mobilisierbar.
Auch auf palästinensischer Seite besteht eine ethische Dissonanz, aber nicht in gleicher Weise. Wenn die Demütigung durch Israel darauf abzielt, „die Quellen von Autonomie und Unabhängigkeit zu ersticken“ (S. 214), wie die Psychiaterin und Psychotherapeutin Samah Jabr sagt, dann gilt es zum einen, die dadurch verursachte Scham abzuwehren, und zum anderen, Gewaltakte der eigenen Seite als legitimen Widerstand aufzufassen. Letztere sind aus Brunners Sicht ein „fehlgeleiteter Versuch“ (S. 217), trotz Demütigung Selbstrespekt und Würde zu erlangen. Frantz Fanon, ein heute oft zitierter Vordenker der Dekolonialisierung, war sich der dunklen Seite des antikolonialen Kampfes bewusst: „Das kolonisierte Subjekt ist eine verfolgte Person, die ständig davon träumt, zum Verfolger zu werden.“[4] Die Spaltung in Freund und Feind, die implizit verlangt, dass die andere Seite irgendwie verschwindet, ist gerade wegen ihrer Simplifizierung emotional befriedigend und zugleich politisch mobilisierbar. Der vierte und letzte Teil des Buches widmet sich daher der Frage, wie man diesen „psychologisch-politischen Teufelskreis“ (S. 223) durchbrechen kann.
José Brunner sucht nach Wegen, auf denen sich Israel und Palästina gegenseitig als legitime Nachbarn akzeptieren können. Akzeptanz ist für ihn mehr als Toleranz, das schlichte Ertragen des anderen, und zugleich weniger als Anerkennung, in der man die eigene positive Identität in der Beziehung zum anderen gewinnt, was in der gegenwärtigen Situation schwer vorstellbar ist. So widerspricht der Teilung des Territoriums, die unterschiedliche Parteien schon seit 1937 in verschiedenen Varianten immer wieder vorschlagen, heute vielleicht mehr denn je eine „emotionale Grundhaltung“, die eine Befürwortung der Teilung als „Verrat am eigenen Volk“ empfindet (S. 240). Brunner widmet den letzten Teil seines Buches eindrucksvoll den durchaus zahlreichen und vielfältigen Versuchen, in gemeinsamen Initiativen von Israelis und Palästinensern einen emotionalen Wandel „von unten“ (S. 278) anzustoßen – ein „Umfühlen“ über das „Umdenken“ hinaus (S. 262). Dazu gehören für ihn „die Fähigkeit, etwas aufzugeben und den damit verbundenen Verlust zu betrauern“ (S. 243); die Realisierung und Akzeptanz, dass mindestens zwei unterschiedliche historische Narrative existieren; die Anerkennung der gemeinsamen Täterschaft zusätzlich zu jener des gemeinsamen Leidens; und vielleicht am grundlegendsten: der Bruch der „psychologischen Herrschaft der Vergangenheit über die Gegenwart und Zukunft“ (S. 248).
Eingangs erwähnte ich, wie voraussetzungsvoll es gegenwärtig ist, über den Nahostkonflikt zu sprechen. Dabei wird häufig auch kritisch betrachtet, wer spricht. José Brunner wurde 1954 in Zürich geboren und wuchs in einer orthodoxen jüdischen Gemeinde auf. Mit 19 Jahren ging er – eine Woche vor Beginn des Jom-Kippur- oder Ramadan-Krieges im Oktober 1973 – nach Israel, um zunächst an einer Talmudhochschule und dann als säkularer Student an der Hebräischen Universität in Jerusalem zu studieren. Später lehrte er Politik- und Rechtswissenschaften sowie Wissenschaftsgeschichte und -philosophie an der Universität Tel Aviv und beschäftigte sich unter anderem mit der Psychologie der Holocaust-Überlebenden und mit psychologischen Erklärungen des Nationalsozialismus. Das Buch ist durchzogen von autobiografischen Elementen, die zum einen das Leben in Israel im Kontext der Wandlungen des Nahostkonflikts verdeutlichen – zwischen Hoffnungen, Angst und Entsetzen – und die zum anderen an Beispielen zeigen, wie sich Brunner gemeinsam mit seiner Frau beständig für ein friedliches Zusammenleben von jüdischen Israelis und Palästinensern als „legitime Nachbarn“ einsetzt.
Diese Elemente und die Reflexionen, zu denen sie Anlass bereiten, geben dem Buch eine besonders intensive Färbung. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Rezensent es kaum noch aus der Hand legen konnte, nachdem er einmal begonnen hatte, es zu lesen. Zugleich tragen sie in sich die Ambivalenz der Analyse und Diagnose. José Brunner betrachtet die Geschichte im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sie einst eröffnete und in Zukunft wieder eröffnen mag. Nach der üblichen Zählung gehöre er zwar der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden an, allerdings weise er diesen Status zurück und breche selbst mit der Vergangenheit: Ich gehöre „nicht einer Opferdynastie an, sondern [...] verstehe mich als Teil des jüdischen Neuanfangs nach dem Holocaust“ (S. 141). Das eigene Handeln könne durchaus einen Unterschied machen, wenn auch nur einen kleinen und temporären. Seine eindrücklichen Schilderungen von Begegnungen mit anderen Menschen und deren Initiativen verdeutlichen dies, auch wenn manchmal ein tragisches Ende zu berichten bleibt. Aber die Betonung, dass vieles anders sein könnte, kollidiert, so scheint es, mit den kumulierten Erfahrungen. Während sich Brunner schon zu seiner Studienzeit als Teil einer Minderheit in Israel sah, so ist seine Distanz zur israelischen Gesellschaft vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten enorm gewachsen. „Wenn man anders fühlt, ist man in dieser Gesellschaft nicht mehr zu Hause.“ (S. 58) Die gegenwärtige Situation veranlasst ihn auch zu einer Reflexion über seine frühe Erziehung zu jüdischen Werten: „In den Händen der Meister der Nekropolitik ist das Judentum zu einer Religion der Zerstörung und des Todes geworden.“ (S. 78)
Seine beeindruckende Schilderung der vielen Initiativen zum „empathischen Aufrütteln“ (S. 264) der Gesellschaft kontrastiert Brunner mit der nüchternen Bemerkung, dass ein umfassenderer Handlungswandel auch „von oben“ (S. 278) angetrieben werden müsse. Hier trifft sich die psychologische Analyse mit der politikwissenschaftlichen. Zwei Politikern schenkt der Autor in dieser Hinsicht besondere Aufmerksamkeit: Jitzchak Rabin, dem israelischen Premierminister von 1974 bis 1977 und von 1992 bis 1995, und Anwar as-Sadat, dem ägyptischen Präsidenten von 1970 bis 1981. Beide versuchten, die Bedingungen für ein friedlicheres Zusammenleben zu verbessern, und beide wurden von Extremisten ihrer eigenen Seite ermordet, die sie als Verräter ansahen. Wie Brunner feststellt: „Gelegentlich unternommene Versuche, die Flammen des Nahostkonflikts zu beruhigen, scheitern, weil Fanatiker sie wieder entfachen.“ (S. 74)
José Brunner hat ein sehr mutiges Buch geschrieben, und er weiß, dass er sich mit vielem, was er sagt, keine Freunde macht. Dem deutschsprachigen Diskussion über die gegenwärtige Lage des Nahostkonflikts sind Vereinfachungen und Gedankensperren keinesfalls fremd. Es ist zu hoffen, dass dieses Buch weithin und aufmerksam rezipiert wird.
Fußnoten
- Mehr als 2 Prozent der Bevölkerung Gazas sind bereits getötet worden. „Auf die Bevölkerung Deutschlands von über 83 Millionen Menschen übertragen, würde dies fast zwei Millionen Tote bedeuten – eine unvorstellbar hohe Zahl.“ (S. 125).
- Brunner diskutiert auch kurz, wie der Holocaust erst mit dem Eichmann-Prozess 1961 zum zentralen Element von Israels kollektiver Selbstdefinition wurde.
- „Niemand schlug vor, dass Deutschland, weil es den Holocaust zu verantworten hatte, zum Beispiel Bayern räumen sollte, um den überlebenden Juden Europas zu ermöglichen, dort einen eigenen Staat zu gründen.“ (S. 155).
- Frantz Fanon, The Wretched of the Earth [1961], New York 2004, S. 81, zit. nach der Übers. von José Brunner, S. 218.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Gewalt Politik Psychologie / Psychoanalyse Religion Staat / Nation
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Caroline Neubaur, Hannah Schmidt-Ott
Was macht Spaß beim Rezensieren?
Episode 23 des Mittelweg 36-Podcasts
Der Antagonismus der Partikularwillen
Rezension zu „Das politische Bewusstsein“ von Geoffroy de Lagasnerie
Eine Wissenssoziologie der Apokalyptik
Rezension zu „Corona und andere Weltuntergänge. Apokalyptische Krisenhermeneutik in der modernen Gesellschaft“ von Alexander-Kenneth Nagel
