Florian Weigand | Rezension | 18.06.2025
Gescheiterter Einsatz
Rezension zu „How to Lose a War. The Story of America’s Intervention in Afghanistan“ von Amin Saikal
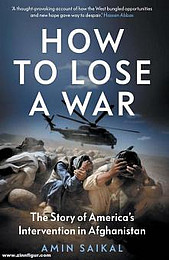
Nach dem Fall Kabuls im August 2021, der damit einhergehenden vollständigen Übernahme Afghanistans durch die Taliban und dem Ende der zwanzigjährigen, US-geführten internationalen Präsenz im Land ist die wissenschaftliche und politische Aufarbeitung der Ereignisse in vollem Gange. Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit den Gründen für das Scheitern der internationalen Intervention. In diesem Kontext leistet Amin Saikal mit seinem Buch How to Lose a War einen wichtigen Beitrag. Es handelt sich um ein klar strukturiertes und meinungsstarkes Buch, das den Anspruch erhebt, nicht nur Entwicklungen zu beschreiben, sondern auch zugrunde liegende Dynamiken sichtbar zu machen.
Mit How to Lose a War legt Amin Saikal eine fundierte Analyse der internationalen Intervention in Afghanistan vor. Aufbauend auf seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Region und gestützt durch die Eindrücke zweier politischer Akteure – Mahmoud Saikal, Afghanistans Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York (2015–2019) und der Bruder des Autors, und Karl Eikenberry, US-Amerikanischer Botschafter in Afghanistan (2009–2011) – bietet der Autor eine detaillierte Darstellung der historischen, politischen und geopolitischen Faktoren, die zum Scheitern des Einsatzes beigetragen haben. Mahmoud Saikals und Karl Eikenberrys Schilderungen ermöglichen wertvolle Einblicke in diplomatische und sicherheitspolitische Prozesse. Allerdings decken sie nur einen Teil des politischen Spektrums ab. Neue empirische Befunde und weitere Stimmen aus anderen politischen Lagern, Landesteilen und Bevölkerungsgruppen sowie weiterführende Belege für pointierte Aussagen könnten dazu beitragen, das Bild stärker zu differenzieren.
Vier strukturelle Variablen dienen als Leitmotiv: strategische Lage, soziokulturelle Vielfalt, innenpolitischer Machtdualismus und wiederkehrende externe Einmischung.
Saikal entwickelt einen eigenen analytischen Rahmen, bestehend aus vier strukturellen Variablen, die ihm als Leitmotiv dienen: strategische Lage, soziokulturelle Vielfalt, innenpolitischer Machtdualismus und wiederkehrende externe Einmischung. Die Stärke dessen liegt weniger in der theoretischen Innovation als in der konkreten analytischen Anwendung auf Afghanistan. Eine vertiefte theoretische Verankerung mit Bezügen zu einschlägiger wissenschaftlicher Literatur über Themen wie Staatsaufbau und Governance von bewaffneten Gruppen hätten das Argumentationsniveau weiter erhöht.
Das Buch ist in acht Kapitel gegliedert und folgt einem klaren chronologischen und thematischen Aufbau. Das erste Kapitel analysiert die ideologischen Prämissen und strategischen Interessen, die das US-amerikanische Engagement nach dem 11. September 2001 prägten. Saikal beschreibt, wie in den USA unter der Bush-Regierung ein machtpolitischer Konsens entstand, der für die militärische Intervention in Afghanistan und die gleichzeitige Vernachlässigung langfristiger politischer Reformziele verantwortlich gemacht wird.
Im Anschluss (Kap. 2) skizziert der Autor die historische Entwicklung Afghanistans von Ahmad Shah Durrani (Herrschaft: 1747–1772) bis 2001. Er hebt hervor, wie wiederholte Interventionen von Großmächten – darunter Großbritannien und die Sowjetunion – sowie interne Machtfragmentierung und ethnische Spaltungen die Herausbildung belastbarer staatlicher Institutionen behinderten. Die ethnische Vielfalt und tief verwurzelte lokale Loyalitäten erschweren Saikal zufolge bis heute jede Zentralisierungsstrategie.
Die Kapitel drei bis fünf widmen sich den Phasen der Bemühung zum Aufbau eines neuen Staats in Afghanistan nach 2001. Zunächst beleuchtet Saikal die Rolle der Bonner Konferenz, die seiner Einschätzung nach zu stark von externen und zu wenig von afghanischen Interessen geprägt war. In den anschließenden Jahren versuchte die internationale Gemeinschaft unter Führung der USA, einen zentralisierten Staat zu errichten. Dabei, so Saikal, wurden bestehende lokale Machtverhältnisse ignoriert, was langfristig die Legitimität der Regierung untergrub.
Die Ansätze der Präsidenten Hamid Karzai (2004–2014) und Aschraf Ghani (2014–2021) stellt Saikal als sehr unterschiedlich dar. Während Karzai als Vermittler zwischen internationalen Erwartungen und lokalen Interessen erscheint, war Ghani Saikal zufolge ein machtorientierter Präsident, der zentrale Entscheidungsprozesse stark personalisierte, ein enges Netzwerk meist junger, paschtunischer Berater aufbaute und rivalisierende politische Kräfte – insbesondere aus nicht paschtunischen Bevölkerungsgruppen – systematisch ausgrenzte. Trotz seines technokratischen Auftretens und reformerischen Anspruchs habe Ghani damit zur politischen Fragmentierung und zur Erosion institutioneller Legitimität beigetragen. Die Gegenüberstellung der beiden Präsidenten ist in ihrer Klarheit erhellend, wirkt jedoch mitunter etwas holzschnittartig – eine differenziertere Betrachtung der jeweiligen politischen Zwänge und Handlungsspielräume hätte hier zusätzliche Tiefe bringen können. Saikal betrachtet insbesondere Ghanis Rolle kritisch, hierbei wäre eine Auseinandersetzung mit dessen Buch Fixing Failed States. A Framework for Rebuilding a Fractured World (2008) interessant gewesen.
Als nächstes analysiert der Autor die sozialen und ökonomischen Herausforderungen, die den Staatsaufbau begleiteten (Kap. 6): Korruption, fehlende Infrastruktur, ungleiche Entwicklung und ein florierender Drogenhandel, in den sowohl lokale Eliten als auch regionale Akteure involviert waren. Es wird deutlich, wie schwer es der internationalen Gemeinschaft fiel, tragfähige institutionelle Strukturen zu etablieren.
Im folgenden Kapitel steht die sicherheitspolitische Dimension im Zentrum. Saikal zeigt auf, wie die internationale Militärstrategie zunehmend auf kurzfristige Erfolge und Technologisierung setzte, während langfristige Überlegungen zu kurz kamen. Besonders ausführlich behandelt er die Rolle Pakistans, hierbei nimmt er eine kritische Perspektive ein: Aus seiner Sicht verhielt sich Pakistan ambivalent, indem es sich offiziell als Verbündeter der USA präsentierte, gleichzeitig jedoch auch die Taliban unterstützte. Auch die Interessen anderer regionaler Mächte wie Iran, China und Russland werden angeschnitten.
Das achte und abschließende Kapitel widmet sich dem Abzug der internationalen Truppen und der schnellen Machtübernahme durch die Taliban im Jahr 2021. Saikal bewertet dies zutreffend als Ausdruck eines tieferliegenden Scheiterns: Die internationale Gemeinschaft habe das politische System Afghanistans nicht nachhaltig stabilisieren können. Die politischen und militärischen Entscheidungen des Westens waren, so Saikal, nicht ausreichend auf die Realitäten vor Ort abgestimmt.
Im Zentrum steht die Frage, wie unterschiedliche Phasen des Engagements – von der militärischen Intervention bis zum Staatsaufbau – miteinander verknüpft waren und welche strukturellen Bedingungen deren Verlauf prägten.
In seinem Buch bietet Saikal somit einen systematisch aufgebauten Überblick zur internationalen Intervention in Afghanistan. Im Zentrum steht die Frage, wie unterschiedliche Phasen des Engagements – von der militärischen Intervention bis zum Staatsaufbau – miteinander verknüpft waren und welche strukturellen Bedingungen deren Verlauf prägten. Zwar bilden die teilweise zugespitzten Interpretationen die Ambivalenzen und Komplexität nicht immer vollständig ab, dafür sind sie analytisch prägnant. Das Buch ist strukturiert gegliedert und verbindet historische Rückblicke mit einer gekonnten Analyse geopolitischer Konstellationen sowie innenpolitischer Entwicklungen.
Stilistisch überzeugt das Buch durch eine klare, gut lesbare Sprache. Es ist nicht nur für ein akademisches Publikum, sondern auch für eine breitere, politisch interessierte Öffentlichkeit gut zugänglich. Ihre Balance aus analytischem Anspruch und Lesbarkeit macht die Publikation zu einer hilfreichen Lektüre in der Auseinandersetzung mit dem Krieg in Afghanistan. Im Vergleich mit anderen aktuellen Titeln – etwa Carter Malkasians The American War in Afghanistan. A History (2021), das von Michael Cox herausgegebene Afghanistan. Long War, Forgotten Peace (2022) sowie Zur Intervention Afghanistan und die Folgen, herausgegeben von Teresa Koloma Beck und Florian P. Kühn (2023) – liegt Saikals besondere Stärke in der makrohistorischen Einordnung und in der Verbindung geo- und innenpolitischer Dynamiken. Die Nahaufnahme und Analyse lokaler Realitäten und Komplexitäten kommt dabei – zugunsten eines leicht zugänglichen, übergeordneten Blicks – etwas zu kurz. Nicht zuletzt bietet das Buch wertvolle Anknüpfungspunkte auch für die politische Debatte in Deutschland. Die instruktive Analyse von Zielkonflikten, institutionellen Schwächen und geopolitischen Interessen kann wichtige Impulse für eine weiterführende Aufarbeitung geben.
How to Lose a War ist eine lesenswerte Studie zum Krieg in Afghanistan, die zentrale Aspekte der internationalen Afghanistan-Intervention nachvollziehbar und prägnant darstellt und dadurch zur kritischen Reflexion anregt, wenngleich einzelne Aspekte – etwa die theoretische Fundierung oder die Vielfalt empirischer Stimmen – hätten ausgebaut werden können. Saikals Kritik an strategischer Unentschlossenheit, institutioneller Schwäche und mangelnder Kontextkenntnis wirkt durchdacht, besonders hervorzuheben ist die Klarheit, mit der er die strukturellen Herausforderungen des internationalen Engagements beschreibt. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Afghanistan und seinem Zugang zu politischen Entscheidungsträgern gelingt es ihm, bestehende Zusammenhänge verständlich zu machen. Saikal liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung eines internationalen Projekts, dessen Auswirkungen Afghanistan und die internationale Gemeinschaft noch lange beschäftigen werden.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Gewalt Gruppen / Organisationen / Netzwerke Internationale Politik Militär Sicherheit Staat / Nation
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Frieden als Prozess
Rezension zu „Über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen“ von Jörn Leonhard
Prototyp der wirtschaftswissenschaftlichen Großforschung
Rezension zu „Primat der Praxis. Bernhard Harms und das Institut für Weltwirtschaft 1913–1933“ von Lisa Eiling
Nachgefragt bei Nina Leonhard
Fünf Fragen zur Studie „Armee in der Demokratie - Ausmaß, Ursachen und Wirkungen von politischem Extremismus in der Bundeswehr“
