Till Hahn | Rezension | 19.10.2023
„Schade, dass Beton nicht brennt!“
Rezension zu „Beton. Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus“ von Anselm Jappe
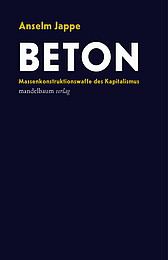
„Le béton est armé, et vous?“ – „Der Beton ist bewaffnet,[1] und ihr?“ Diese Frage, gestellt in einem Graffito aus den 1970er-Jahren (S. 18), scheint noch immer aktuell, sind es doch vor allem die hastig hochgezogenen, aus Stahlbeton konstruierten Trabantenstädte Frankreichs, aus denen heraus Revolte und Protest die Republik mit periodischer Regelmäßigkeit heimsuchen. Der Beton – oder präziser: der Stahlbeton – ist nicht nur der wichtigste Baustoff des modernen Industriekapitalismus. Mit der Verdrängung der Unterschicht aus den Innenstädten in die Banlieus ermöglicht er auch die Verdrängung der Klassenspaltung und der kapitalistischen Ausbeutung aus der unmittelbaren Sichtbarkeit.[2]
Das Gemisch aus Sand, Kies, Zement und Wasser, das über ein Gerüst aus Stahlverstärkungen gegossen wird und auf diese Weise Wohn- und Bürotürme, Einkaufsmeilen, Schulen, Krankenhäuser, Brücken und Staudämme, Universtäten und Gefängnisse entstehen lässt, ist überall. Der Baustoff ist so allgegenwärtig, dass ihn die Bewohner:innen von Städten des globalen Kapitalismus scheinbar als selbstverständlich hingenommen haben. Dieser Selbstverständlichkeit begegnet der Philosoph Anselm Jappe nun mit einer umfassenden Kritik: Sein Essay Beton – Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus vertritt die These, der Baustoff sei nicht weniger als „die konkrete Seite der Warenabstraktion“.
Warum es gerade der (Stahl-)Beton ist, der sich nach Auffassung des Autors als Ansatzpunkt für eine solche Kritik des Alltagslebens eignet, liegt auf der Hand: In diesem Material verbinden sich Totalität und Hybris der kapitalistischen Produktionsweise auf paradigmatische Weise.[3] Im Kleinen lenken die aus Stahlbeton gefertigten Infrastrukturen die Bahnen unseres alltäglichen Lebens: Von den Wohnungen in den Vorstädten gelangen wir über Autobahnen, Bahnschienen, Fahrradwege oder U-Bahnstationen zu den Büros, Schulen, Universitäten, Einkaufszentren etc. – alles aus Beton gebaut. Im Großen sind es die gigantischen Bauprojekte, etwa der Hoover-Staudamm in den USA oder der Dreischluchtenstaudamm in China (von den Kühltürmen der dortigen Atomkraftwerke ganz zu schweigen), die die Megalomanie und Hybris des Kapitalismus verkörpern. Der Baustoff Stahlbeton ist für Jappe Ausdruck der zerstörerischen Tendenzen der kapitalistischen Moderne. Daher argumentiert er, dass „[d]ie übliche Rechtfertigung, wonach ohne Beton die moderne Architektur nicht möglich geworden wäre, […] in einen Akt der Anklage verkehrt werden [muss]“ (S. 16). Es ist gerade der Baustoff Stahlbeton, in welchem sich verschiedene Dimensionen der Kapitalismuskritik miteinander verbinden lassen: die ästhetische, die ökonomische und die epistemische – und nicht weniger bringt Jappe in seinem Buch auf‘s Tapez.
Kehren wir also zurück zur Ausgangsthese, die da lautet: „Beton verkörpert die kapitalistische Logik und stellt die konkrete Seite der Warenabstraktion dar.“ So verkündet es der Klappentext, und die Einleitung verspricht nicht weniger als eine vollständige Analyse dieser These (ebd.). Systematisch – und das leider auch nur im weitestmöglichen Sinne des Wortes – wird diese These erst im letzten Kapitel (auf gerade einmal zwölf Seiten) verhandelt, dabei ist sie durchaus reizvoll. Bevor ich also genauer darauf eingehe, was der Autor stattdessen behandelt, lohnt es sich noch bei ihr zu verweilen: Indem sie die Frage nach der Materialität der Warenabstraktion stellt, wirft sie zugleich die Frage nach der Realität der Konkretion auf. Wenn die Form des Erscheinens eines jeden Gegenstandes im Kapitalismus die Warenform – und damit ein Abstraktum – ist, dann steht nicht weniger auf dem Spiel als der Verlust des Konkreten selbst (S. 144). Jappe definiert den Kapitalismus zunächst als eine „Herrschaft der Abstraktion“ (ebd.), zu der der Autor über die Begriffe „Hypostase“, „Entfremdung“ und schließlich „Ideologie“ gelangt. Jappe scheint sie jedoch wahllos aus dem Zettelkasten des historischen Materialismus zu ziehen. Die Begriffe selbst werden dabei zu bloßen Schwundstufen ihrer selbst: Mit Hypostase meint der Autor lediglich die Verkörperung von Abstraktem in Konkretem, unter Entfremdung fasst er die „Entwertung des konkreten und besonderen Subjekts zu Gunsten einer Abstraktion“ und mit Ideologie schließlich eine „falsche Idee, die gesellschaftliche Macht erlangt, weil die Leute daran glauben […]“ (S. 145 f.).
Hätte Jappe dem Kerngeschäft der Philosophie, nämlich der Arbeit am Begriff, mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wäre ihm womöglich der folgende Gedankengang gekommen: Wie herrscht Abstraktion im Kapitalismus (und umgekehrt, wie herrscht der Kapitalismus durch Abstraktion)? Marx legt diesen Mechanismus bekanntermaßen im ersten Teil des ersten Kapital-Bandes dar:[4] Indem Menschen die Produkte ihrer Arbeit als Waren (und damit als gleiche) austauschen, setzen sie auch ihre unterschiedlichen Arbeiten einander gleich, abstrahieren also von den Unterschieden, die ihre Werke konkret aufweisen. Arbeit im Kapitalismus ist damit abstrakte Arbeit, und zwar nicht abstrakt, weil sie unsinnig, repetitiv oder stupide wäre; sie ist abstrakt, weil sie Wert erzeugt – und damit ein abstraktes gesellschaftliches Verhältnis der Arbeitsprodukte zueinander. Die eigentliche Hypostase nun besteht darin, dass dieses abstrakte Verhältnis im Geld eine materielle Form annimmt, konkret wird. Dies ist aber keine bloße Verwechslung, sondern wirklicher, konkreter, materieller Ausdruck eines abstrakten Verhältnisses:
„Es ist als ob neben und ausser Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Thieren, die gruppirt die verschiedenen Geschlechter, Arten, Unterarten, Familien, u.s.w. des Thierreichs bilden, auch noch das Thier existierte, die individuelle Incarnation des ganzen Thierreichs.“[5]
Die Hypostase der Wertform besteht also gerade darin, dass in ihr der Dualismus abstrakt/konkret aufgehoben ist. Inwiefern hat das Einfluss auf Jappes Ausgangsthese, Beton sei „die konkrete Seite der Warenabstraktion“? Das Baumaterial wäre demnach materieller Ausdruck genau dieser Hypostase: Ein Verlust des Konkreten, da sich im Konkreten lediglich die Herrschaft der Abstraktion konkretisiert: Concrete ist genau diese materielle, konkrete Existenz der Abstraktion als solcher. Die kapitalistische Logik, die den:die Arbeiter:in als Träger:in abstrakter Arbeitskraft massenhaft hervorbringt, schlägt sich nieder in einer Bauweise, die massenhaft Wohn- und Arbeitsraum produziert, in welchem sich diese abstrakte Arbeit verausgaben und reproduzieren soll.
Dies wäre ein Weg, den Jappe in seiner Argumentation hätte weiterverfolgen können. Stattdessen lässt er ihn nach wenigen Seiten und einigen vagen Andeutungen fallen und verlegt sich auf eine ästhetisierende Polemik gegen das Immergleiche der Betonarchitektur im Namen konservativer Dorfromantik. Wie weit Jappe sich in seiner Gegenwartsdiagnose von einer materialistischen Kapitalismuskritik entfernt hat, zeigt das Kapitel 4: „Bauen ohne Beton und ohne Architekten (S. 92–119), indem er gegen den modernen Beton „traditionelle Bauweisen“, die der Beton „ermordet“ habe (S. 93), ins Feld führt. Hier geht es viel um thermische Eigenschaften von Lehm und den ökologischen Fußabdruck von Naturstein; um die Notwendigkeit in einer Massengesellschaft ebenjenen Massen, nach denen dieselbe benannt ist, Wohnraum zu verschaffen, geht es nicht. In politischer Hinsicht verbleibt Jappe damit auf dem zynischen Niveau eines Großbürgers, der den elenden Vorstadt-Bewohner:innen empfiehlt, doch einfach öfter in ihre Landhäuser zu fliehen. Dass dies, unter einem sehr fadenscheinig gewordenen Mäntelchen marxistischer Terminologie, der Weg ist, den Jappe eingeschlagen hat, zeigt schließlich sein Resümee:
„Das heutige Subjekt hat sich an Obsoleszenz und unaufhörliche Erneuerung seiner Kleidung und Autos gewöhnt. Es hat sich auch an den ständigen Austausch seiner Freunde und Liebespartner, seiner Kinder (im Falle der Patchworkfamilien) und seiner Arbeit, seines Wohnorts und seiner politischen Überzeugungen gewöhnt – falls nötig unter Zuhilfenahme von Psychopharmaka und Therapeuten. Aber die völlige Abwesenheit von schon bekannten und daher erkennbaren Rahmen kann das Subjekt in den Wahnsinn treiben […], während die Existenz stabiler Strukturen eine wichtige stützende Rolle spielt, die das Schlimmste verhindert.“ (S. 155)
Dass diese Diagnose – die „völlige Abwesenheit von schon bekannten und daher erkennbaren Rahmen“ – der Grundkritik des Buches, der Beton habe jegliche Form der architektonischen Einmaligkeit ausgelöscht und alle Städte einander gleich gemacht, diametral entgegensteht, scheint den Autor nicht zu stören – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das „Schlimmste“, das da „verhindert“ werden soll, nicht weiter definiert wird; es raunt lediglich düster von der Zukunft her. Dieser abgeschmackte Kulturkonservatismus macht das Buch nicht nur (und das allein wäre schon schlimm genug) belanglos, sondern vor allem politisch unbrauchbar. Ist zwar der Diagnose der inhärenten Verwobenheit von Kapital/Kapitalismus und Beton zuzustimmen, so bietet das Buch – da es die historische Notwendigkeit der Betonbauweise vor dem Hintergrund einer kapitalistischen Massengesellschaft nicht einmal verkennt, sondern schlicht ignoriert – keinerlei politische Perspektiven, mit denen der gegenwärtige Zustand progressiv zu überwinden sei. Die Bewohner:innen der Pariser Vorstädte können schließlich schlecht geschlossen in die Gascogne umziehen, um dort auf kleinen Landparzellen an traditionellen Baumethoden weiter zu tüfteln.
Fußnoten
- Hierbei handelt es sich um ein Wortspiel, das darin besteht, dass armé im Französischen nicht nur bewaffnet bedeutet, sondern auch die Bezeichnung für die Stahlverstärkung im Inneren des Stahlbetons ist: béton armé.
- Eine vergleichbare These findet sich bereits bei Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Frankfurt am Main 1965
- Vorwort und Einleitung legen dies dar.
- Ich werde ihn hier nur kursorisch zusammenfassen, für eine exzellente Einführung in dieses Thema vgl. Michael Heinrich, Kritik der politischen Ökonomie, Eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx, Stuttgart 2021.
- Karl Marx, Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie Erster Band Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals, Freiburg/Wien 2022[1867], S. 27
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Kapitalismus / Postkapitalismus Kritische Theorie Öffentlichkeit Politik Politische Ökonomie Stadt / Raum
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
