Hartmut Esser | Rezension | 06.11.2025
Wider die Vermessenheit!
Rezension zu „Wissenschaft im Wettbewerb. Die Universität im akademischen Kapitalismus“ von Richard Münch
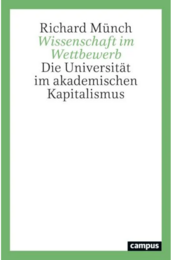
Nicht nur die akademische Welt blickte Ende Mai dieses Jahres gespannt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse zur nächsten Runde der sogenannten Exzellenzinitiative. Die DFG ließ verlauten:
„In der zweiten Wettbewerbsrunde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder zur weiteren Stärkung der Spitzenforschung an den Hochschulen in Deutschland sind die Entscheidungen über die künftigen Exzellenzcluster gefallen. Die mit den Wissenschaftler*innen des internationalen Committee of Experts (vormals: Expertengremium) und den Wissenschaftsminister*innen des Bundes und der Länder besetzte Exzellenzkommission wählte am Donnerstag, den 22. Mai 2025, in Bonn aus 98 Förderanträgen insgesamt 70 Exzellenzcluster zur Förderung aus. Damit wurde die maximale Zahl an Projekten bewilligt, die in der Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern zur Exzellenzstrategie vorgesehen ist. Sie wurde auch von der Wissenschaft mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystems für dringend wünschenswert erachtet.“[1]
Das klingt doch gut: Die Spitzenforschung wird weiter gestärkt, es wurde alles an Geld ausgegeben, was gerade möglich war, und die Wissenschaft selbst hält die Exzellenzinitiative für „dringend wünschenswert“, und zwar mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wer wollte da denn noch meckern?
Richard Münch tut es, seit langen Jahren und mit nicht nachlassendem Nachdruck. 2011 veröffentlichte er unter dem Titel Akademischer Kapitalismus ein Buch Über die politische Ökonomie der Hochschulreform. Jetzt hat er eine Sammlung seiner Arbeiten zu diesem Thema vorgelegt: Wissenschaft im Wettbewerb. Das letzte Kapitel formuliert ein Forschungsprogramm, wie es theoretisch und empirisch weitergehen soll, um besser zu verstehen, was sich im Zuge der „Hochschulreformen“ abgespielt hat und weiter geschieht. Münchs übergreifender Bezugspunkt ist das, was die Wissenschaft als gesellschaftliches Funktionssystem ausmacht: der Code der „Wahrheit“ sowie die Methoden der neutralen und sachgerechten empirischen Prüfung, nach Luhmann das Programm zum Code also, das Regelsystem der technischen und auch legitimierenden Verfahren mit den sozialen Spielregeln von Universalismus, organisiertem Skeptizismus, intellektuellem Kommunismus und Uneigennützigkeit. Das ist alles nicht weit entfernt von den Übereinkünften und Zielsetzungen des Kritischen Rationalismus zur Prüfung von informationshaltigen und falliblen Hypothesen und von der Vorstellung der Wahrheitsannäherung als regulativer Idee und des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments in einer idealen Sprechsituation des herrschaftsfreien Diskurses: Jeder Fremdeinfluss muss abgeschirmt werden, daher sind Wertneutralität, Interesselosigkeit an bestimmten Ergebnissen sowie die Unabhängigkeit von praktischer Verwertbarkeit und öffentlichem Augenmerk entscheidend. Wie schwierig es ist, das durchzuhalten, haben die Ereignisse im Zuge der Corona-Pandemie gezeigt, als sich mit einem Schlage alle nur auf dieses eine Thema zu konzentrieren schienen, auch weil man sich damit Beachtung und Marktvorteile erhoffte. Das war in den meisten Fällen vergeblich und gewiss nicht zum Besten für die Wissenschaft.
Das ist der Punkt von Münch: Nach und nach und nahezu unaufhaltsam wird der Wissenschaft und ihren Institutionen, insbesondere den Universitäten, eine ganz andere Codierung aufgedrückt, eine Logik der wirtschaftlichen Rechnungsprüfung, der Kosten-Nutzenrechnung, des Wettbewerbs und der Effizienz, der Kontrolle und Verwertbarkeit. Münch kritisiert und attackiert dieses Überstülpen einer ganz anderen Funktionslogik auf die Codierung der Wissenschaft. Es sei die Folge des globalen Siegeszugs der neoliberalen Agenda, verbunden mit der Vorgabe an die Universitäten, sich zu spezialisieren und in einem Ausleseprozess, einem Wettbewerb, zu differenzieren. Dabei verwandeln sich die Hochschulen in so gut wie nur noch strategisch agierende Institutionen. Das ist, so heißt es an vielen Stellen des Buches, eine Logik der Vermessenheit, der Ökonomie insbesondere, mit ihren Methoden der Vermessung und der Quantifizierung, mit ihren Theorien der (rationalen) Maximierung und der Strategien, der Zielvereinbarungen, der Managementmethoden, des internen Controllings und der betriebswirtschaftlichen Rechnungslegung. Und all das gedeiht in einer Atmosphäre des generalisierten Misstrauens und des vorauseilenden Gehorsams gegenüber der Öffentlichkeit wie der Politik. Zudem in einem noch besonders undurchschaubaren Bereich, der Wissenschaft und der akademischen Freiheit, die, wie man so hören kann, flächendeckend für lange Aufenthalte in der Toskana und der Cote d´Azur genutzt werde, wo aber überwiegend nichts herauskäme. Es ist dies kaum anders als im schulischen Bereich mit seinen regelmäßig wiederkehrenden Aufregungen um PISA. Richard Münch behandelt auch dieses Thema und rückt dem ökonomischen Konzept der accountablity von Schulen und Lehrpersonal sowie der damit verbundenen Abwertung eines breiteren Bildungsbegriffs zu Leibe.
Der Kern der Beiträge ist die Unterscheidung von drei Varianten der so veränderten Universitäten „im akademischen Kapitalismus“: Die unternehmerische Universität, die strategiefähige Universität und die Audit-Universität. In der unternehmerischen Universität geht es um den Wettbewerb, um „Exzellenz“, in der strategischen Universität um die Umstellung von der Einzelforschung auf die Verbundforschung und in der Audit-Universität um die Substitution der wissenschaftsinternen Qualitätssicherung auf die externe Kontrolle, gemessen über Kennziffern wie die Summe der Einwerbung von Drittmitteln oder Rankings. Davon gibt es alle denkbaren Mischungen und Kumulationen, eine so bedenklich wie die andere.
Letztlich greifen alle diese Varianten an dem gleichen Punkt an: Eine „zunehmende horizontale Differenzierung in Spezialhochschulen auf Kosten der Idee der Universität als Ort der Begegnung vieler Disziplinen und eine Stratifikation nach Rang und Kosten eines offenen Wettbewerbs um Erkenntnisfortschritt“ (S. 59; Hervorhebungen HE) nach den Maßstäben der Codierung der Wissenschaft, wie sie oben beschrieben wurde. Kurz: Das, was die alte Universität einmal ausgemacht hat, ist verloren: die Vielfalt und die Unabhängigkeit und die Möglichkeiten, die eine Innovationsbeschleunigung wie das „Anything Goes“, in der Toskana oder in der stillen Studierstube, für den Erkenntnisfortschritt immer gelassen hat, sind vorbei. Stattdessen: Ein verengendes und langweiliges, an vorgegebene Zwecke und standardisierte Indikatoren gebundenes mainstreaming, was zum Beispiel in der Soziologie dazu geführt hat, dass sich mittlerweile etwa die Hälfte der Zeitschriftenaufsätze mit theoretisch eher anspruchslosen Analysen der sozialen Ungleichheit befassen. Dabei ist es relativ leicht, sich mit immer neuen, von außen eingeschleppten Methoden, derzeit etwa der ökonometrischen Kausalanalyse, von anderen abzusetzen, einer anfangs wenigstens undurchsichtig scheinenden, aber bald wieder ersetzten Art des Uni-Bluffs, dem man ansonsten eher in philosophischen Hauptseminaren begegnete.
Es gibt eine lange Liste weiterer Perversitäten dieses Systems, keineswegs beschränkt auf den akademischen „Kapitalismus“ allein. Dazu zählt insbesondere, dass sich mit der Erweiterung von Möglichkeiten auf eine Fortsetzung der akademischen Karriere bis hin zur Erfüllung des großen Traums einer Professur für die allermeisten eine fatale Mobilitätsfalle auftut. Die entsprechenden Zuarbeiten werden in den Projekten dringend gebraucht, von innen her entwickelt sich ein eigener Sog, alles so lange fortzuführen, wie es nur geht. Doch es geht eben nicht: Die ersehnten Positionen sind und bleiben knapp und die Verlängerungen (höchst) unsicher. Aber das wird weitgehend verdrängt, auch weil alles letztlich doch an vielen Unsicherheiten und Konditionalisierungen hängt. Für das geduldige und mühsame Bohren dicker Bretter und der Suche nach der „Wahrheit“ sind das keine guten Voraussetzungen.
Exzellenzcluster sind, so Richard Münch immer wieder, beileibe nicht die einzigen Brutstätten dieser Verwerfungen. Sie sind nur ein Teil der verfehlten Strukturen, speziell des deutschen Systems. Dieses ist gekennzeichnet von der Trennung von Forschung und Lehre dank der Auslagerung der Forschung an eigene Institutionen, des nach wie vor bestehenden Lehrstuhlsystems und – insbesondere – der Drittmittelforschung in den chronisch unterfinanzierten Universitäten, und auch der Sonderforschungsbereiche, einer vielfach nachgeahmten Spezialität des deutschen Wissenschaftssystems.
Dem stellt Richard Münch das (amerikanische) Departmentsystem gegenüber: 30 bis 40 Professuren ohne eigene Mitarbeiter:innen, aber eben keine Lehrstühle im klassischen Sinne. Die Universität Bielefeld wird dazu in einem eigenen Kapitel ausdrücklich herausgehoben und beschrieben (Kapitel 5). Sie sei ein einsames Vorbild für das, was man sich wünschen könne: Eine große Anzahl von Professuren nur für die Soziologie, eine ungewöhnlich hohe Varianz von Denominationen und Ausrichtungen, mit dem Glücksfall Niklas Luhmann als einem Solitär ohnegleichen, der „der Soziologie eine theoretische Grundlage für die Ewigkeit gegeben“ habe (S. 115), und einer kaum noch zu überbietenden Vielfalt an Ansätzen und Richtungen, exemplarisch und „legendär“ die „Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen“. Das habe die Fakultät zum „Zentrum der Soziologie in Deutschland“ gemacht. Heute sei das allerdings nicht mehr denkbar – oder nur gegen starke Widerstände: Eine ganze Fakultät ohne die strategische Aufsicht der Hochschulleitung und ohne die Gefahr von Wildwuchs im Universitätsmanagement, im administrativen Apparat und der Organisation, die alle nur noch – wie in den USA – mit „Planungen, Besprechungen und Retreats“ (S. 120) beschäftigt seien. Deshalb, es ist eine Festrede, die Richard Münch zum 50. Jahrestag der Gründung der Bielefelder Fakultät gehalten hat, der dringende Rat: Lasst das alles! Kein Sonderforschungsbereich mit 15 bis 20 „PI“´s, keine Drittmittel folgerichtigerweise, schon gar kein Excellenzcluster! Dafür aber, wenn es sich wieder ergäbe, einen Niklas Luhmann, der das alles mit seiner berühmten Antwort auf die Frage bei seiner Berufung, was er denn brauche: „30 Jahre, Kosten keine“, überstrahlen und ersetzen kann.
Hinzu kommt der Rat, nicht nur an Bielefeld, auf die Gängeleien, die Forschungsverbünde und externe Förderungen immer mit sich bringen, bewusst zu verzichten. Sie gefährden, was eigentlich das Kerngeschäft der Wissenschaft ist. Denn:
„Neue Erkenntnisse werden immer und überall allein aus dem Erkenntnistrieb der Forscher und spontanen Zusammenschlüssen heraus, niemals aufgrund irgendwelcher Zielvereinbarungen, Anordnungen und organisatorischen Vorkehrungen, immer da, wo der Entfaltungsspielraum am größten, kleine Teams ohne Antrags- und Dokumentationsdruck, allein ihrer Neugierde folgen.“ (S. 122).
Ergänzt wird dieses Bild über eine, sagen wir: etwas optimistische, Vorstellung, dass es innerhalb des Autonomiebereichs der Wissenschaft immer genügend Kontrolle geben würde, was alle externen Rankings überflüssig mache: Kontrolle nämlich durch die Forschergemeinschaft, die gegenseitige Korrektur über Forschung und Lehre, Peer-Reviews und das Einüben des wissenschaftlichen Habitus. Außerdem gebe es interne Anreize genug, die intrinsische Motivation, sowieso, die Reputation aus Zitationen, auch wissenschaftsbezogene Ehrungen und Mitgliedschaften. Externe Anreize würden das alles eher ausdünnen oder sogar pervertieren. An Beispiele wollen wir hier nicht erinnern. Kurz: Der akademische Kapitalismus und die Vermessenheit der Kontrollen zerstören auch die Grundlagen des Selbstfunktionierens der Wissenschaft – und das lässt sich durch nichts mehr wirklich kompensieren.
Soweit in groben Zügen der Inhalt des Buches. Es handelt sich um eine Sammlung früher erschienener Beiträge. Manche von den zahllosen Einzelheiten, über die Richard Münch in der ihm eigenen Sorgfalt und Umsicht berichtet, wiederholen sich angenehmerweise, so dass sie sich gut einprägen. Jeder, der die letzten 25 Jahre im Universitätsbetrieb beobachtet oder erlebt hat, könnte genügend Ähnliches berichten und damit das Geschilderte bestätigen. Es soll auch nichts bestritten werden, was die Grundtendenzen und die meisten Einzelheiten angeht. Wohl aber doch, was die Darstellung des Gegenmodells angeht, das der „reinen“ Wissenschaft unter der Codierung von Wahrheitssuche und wissenschaftlichem Fortschritt und mit der Vorstellung, das ginge – massenhaft – überhaupt noch so wie bei Luhmann: keine Kosten und unendlich viel Zeit. Wir wollen ein Beispiel herausgreifen, bei dem ohne sehr viel an Zusatzförderung, Koordinations- und Kooperationsbedarf, Verwaltungsaufwand, Antragstellung und Berichten, Evaluationen, Begehungen, Standardarbeiten und – nicht zuletzt – eine breite Unterstützung aus anderen Funktionssphären extrem wichtige und erfolgreiche Investitionen und Innovationen liegen geblieben wären, von denen jetzt alle profitieren, auch diejenigen, die es nicht lassen können, das ganze verkommene System zu beklagen.
Es handelt sich um Mannheim, das man als Gegenpol zu Bielefeld betrachten kann. Es geht dabei um die lange Geschichte einer Serie von Bemühungen, inzwischen auch über mehr als 50 Jahre schon, der (analytisch-empirischen) Sozialwissenschaft eine Infrastruktur zu bieten, mit der sich, wie es damals hieß, ein bedenklich angewachsener „Hypothesenstau“ abbauen ließe. Nachdenken, Reflexion und Pluralismus allein hätten da nicht mehr weitergeholfen. Gegenstand waren zwei Stränge: Die Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Mobilitätsforschung in der Lebenslaufperspektive und die Beziehungen zwischen Ökonomie, Sozialpsychologie und Soziologie in der jeweiligen Mikrofundierung ihrer Theorien, wenn man so will, Max Weber in der vollen Breite seiner Handlungstypen. Und dahinter die für alles so wichtige Frage nach den konkreten Techniken und Methoden der Datenerhebung, der Datenaufbereitung, der Datenanalyse und der Datenarchivierung. Das Ergebnis waren verschiedene Panelprojekte, das SOEP und PAIRFAM zum Beispiel, auch NEPS in seiner Gründungsphase, ZUMA beziehungsweise GESIS später und eine ganze Serie sogar von drei Sonderforschungsbereichen mit (weltweit) anerkannten Spezialisten für das, was die Grundlagenforschung der Sozialwissenschaften immer noch beschäftigt: Die Einheit der Mikrofundierung in der Fortentwicklung der Handlungs- und Verhaltenstheorien, zusammen mit drei weiteren Fakultäten in Mannheim und an anderen Orten, etwa Frankfurt am Main, mit dem WZB, später dem DIW in Berlin beim SOEP oder bei SHARE, jetzt in München. Das alles hat etwas gebracht, es hat aber auch mehr als 30 Jahre gedauert, und man kann nicht sagen, dass es keine Kosten gegeben hätte. Ein Luhmann hätte dies nicht hinbekommen, auch keine lockere DFG-Arbeitsgruppe. Es war auch nicht so, als seien die Beteiligten den Platzierungen in den Rankings hinterhergelaufen oder den manchmal sehr betriebswirtschaftlichen Autoritäten in Rektorat und Universitätsrat, auch nicht den ab und an allzu bereitwilligen regionalen Sponsoren. Diese wollten sowieso meist etwas anderes, nämlich einen Ehrendoktor für sich, den sie aber nicht bekamen, wenn sie außer Motorenölproduktion nichts vorzuweisen hatten, was akademische Würden verdient. Kurz: Es gibt auch die fruchtbare und produktive Autonomie unter der unvermeidlichen Heteronomie, wenn man in Beziehungen nach außen treten muss, um die spezifischen wissenschaftlichen Ziele zu erreichen. Und das ist eben keine Frage der Muße und der akademischen Ungebundenheit allein.
Vor diesem Hintergrund bleibt ein Vorwurf von Münch unverständlich: Das deutsche Lehrstuhlsystem sei einer der Gründe für die Klagen über die Ineffizienz. Es gibt zumindest zwei Aspekte, die vermuten lassen, dass sich mit diesem, sagen wir, lebensweltlichen Puffer die Heteronomie des Systems nicht auswächst, sondern womöglich geradezu dabei hilft, sich vor den schlimmsten Folgen einer neoliberalen Dominanz zu schützen.
Das hat mehrere Gründe. Erstens: Lehrstühle mit wenigen Mitarbeiter:innen unter einer lockeren, aber doch auch enger gefassten Koordination und einer langfristig angelegten Forschungsagenda von begrenztem Umfang können höchst effiziente Einheiten sein, besonders dann, wenn sie in ein Gesamtkonzept der Fakultät und der Universität insgesamt passen und in diesem Rahmen ihren ganz speziellen Beitrag liefern, der von allen goutiert und anerkannt wird. Lehrstühle sind vor allem auch soziale Verbünde, in denen sich – ohne großes Aufheben – das normalwissenschaftliche Geschäft eher nebenher einüben lässt, ungestört von meist lästigen und zeitraubenden „Vernetzungen“ und Pflichtveranstaltungen in den Kollegs und Verbünden. Auf diese Weise können sich dann leichter weiter gezogene Einheiten bilden, die dann, aber wirklich nur dann, den Kern von so etwas wie einer Forschergruppe, eines Sonderforschungsbereichs, eines Graduiertenkollegs und dann auch eines (Exzellenz-)Clusters bilden. Jedenfalls gibt es Beispiele dafür, speziell dann, wenn es auf der Leitungsebene der Universität auch so gesehen und betrieben wird. Das aber ist selten, und deshalb wäre Bielefeld auch etwas anders zu sehen als Münch das tut.
Der zweite Aspekt hat mit gewissen fatalen Folgen der Vorgänge zu tun, die Münch zu Recht beklagt. Die Drittmittel-, Sonderforschungsbereichs- und Exzellenzcluster-Universität trifft, eher unbemerkt zu Beginn und dann schleichend, besonders hart das Personal, das dafür einmal eingestellt werden musste, mit großen Hoffnungen bei allen: Die Zeit und der Erfolgsdruck der Projekte erzwingen in mehr Fällen als sonst schon früh vorzeigbare Fortschritte. Bleiben diese aus, gibt es gleichwohl genug Möglichkeiten, die Phase des Verbleibs im System zu verlängern, Graduiertenkollegs, Postdoc-Programme, Service- und Hilfsfunktionen hier und da, manchmal und mit viel Glück auch eine Dauerstelle, denn oft genug sind die Projekte darauf angewiesen, dass das Personal bleibt. Und so unterbleibt im großen Stil und strukturell unvermeidlich, was sonst naheliegend gewesen wäre: Der an einem Lehrstuhl bei den begrenzteren Möglichkeiten ohne diese ganzen Drittmittel unvermeidliche, mehr oder weniger sanfte, aber frühzeitige Hinweis, sich doch besser nicht länger auf eine Professur zu kaprizieren und womöglich mit über 40 ohne etwas dazustehen, was der langen Zeit der Qualifikation und den nun verlorenen Investitionen entsprechen könnte. So gesehen wäre das Lehrstuhlsystem eher ein Teil wenigstens noch der Humboldt‘schen Konzeption der Universität, gerade auch der Einheit von Forschung und Lehre, im praktischen Vollzug des akademischen Geschäfts, bei viel mehr an personalisierten Beziehungen und oft genug auch dem Kollektiverlebnis einer Forschungsgemeinschaft. Richard Münch sieht dies anders (S. 66). Er wertet das Lehrstuhlsystem als einen Teil von überkommenen oligarchischen Strukturen, die für die Ineffizienz des deutschen Systems stünden, quer zum System der amerikanischen Departments.
Das gerade skizzierte Lob des Lehrstuhlsystems, das Richard Münch offensichtlich fern liegt, führt zurück zu einem grundlegenderen Aspekt. Er ist schwer zu beschreiben. Es geht um die Frage, wie sich die beiden Pole der Autonomie und der Heteronomie in der Wissenschaft differenzierter bewerten lassen, als es sich nach der Lektüre des Buchs von Richard Münch aufdrängt. Es ist vordergründig die alte und bisher jedenfalls nicht konsensuell beantwortete Frage nach dem Verhältnis der (mindestens) „zwei Soziologien“, der, in die einfachste Form gebracht, Frage nach Pluralisierung und Einheit des Fachs, auch in den grundlegenden methodologischen Ausrichtungen. Dabei ist nicht gemeint, dass es Einschränkungen in der Fragestellung, den theoretischen Hypothesen, in der Verwendung von Methoden geben dürfe, auch nicht, wer das letztlich bezahlt. Da gibt es nichts an Einschränkungen des Pluralismus, außer vielleicht ethische und moralische Grenzen: Anything Goes! What Else? Aber es ist auch nicht alles denkbar, was zugelassen werden könnte.
Das wird unter anderem dann erkennbar, wenn man die Codierung der Wissenschaft als spezielles Funktionssystem aufgreift, als jenes „Feld“ der gesellschaftlichen Differenzierung nämlich, in dem als einzigem der Primat der Wahrheitssuche gilt. Was dann aber auch hieße, dass alles zu geschehen habe, wenn es Tendenzen der – funktionsfremden und schädlichen – Interpenetration mit anderen funktionalen Sphären gibt. Und das hat Richard Münch mit einer bewunderungswürden Klarheit herausgearbeitet und belegt, und sein Forschungsprogramm will sich genau dieser soziologischen Frage widmen. Dann aber muss auch daran erinnert werden, dass alles das, was in der Wissenschaft unter dem Code der Wahrheit und der Wahrheitsannäherung geschieht, letztlich auch auf ein oberes Ziel hinausläuft: gültige Erklärungen für die ungelösten Fragen der Welt zu suchen und zu finden. Wissenschaft ist eine besondere und in ihrer Art auch einzige Form der Problemlösung, und das auch dann, wenn man weiß, dass die gefundenen Lösungen immer nur tentativ sein können und sich in den Produkten, den Aufsätzen und den Büchern, nicht immer wiederfinden, wenn denn überhaupt.
Der wichtige Punkt wäre dann aber: Nun geht es nicht mehr allein mit „Pluralismus“ und Vielfalt der Perspektiven und auch nicht mit einem Programm, das nichts weiter benötigt als einen Solitär, dem alle die Wege ebnen, auch denen, die kaum mehr sind als ein Fußvolk von Zwergen. Wenn es an einer Stelle wirklich einmal weiter gehen soll, benötigt man eben Ressourcen und Organisation mit allem, was dazu gehört, nicht übertrieben und immer mit der Notwendigkeit, Ausuferungen zurechtzustutzen: Berichte, Anträge, Konkurrenz und auch –, warum denn nicht? – Rankings. Es gibt gute und schlechte Wissenschaft. Über die Kriterien muss und kann man sich einigen. Und dass die Rankings dann alle irgendwie immer daneben liegen, wäre auch erst einmal nachzuweisen. Und auch umgekehrt: Es fällt schon auf und wird zum Gesprächsstoff, wenn die Spitzenpositionen, die Auszeichnungen und die Ehrenpreise, die der großen Forschungsinstitute, der Akademien und der DFG zum Beispiel, aber auch der Fachorganisationen, unverdient und womöglich sogar peinlich sind, etwa weil Richtungen und Personen prämiert werden, die, was schon vorgekommen ist, mit der Codierung der Wissenschaft, wie sie Richard Münch in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellt, nichts, aber auch gar nichts zu tun haben, aber Bestseller vorweisen können, die etwa Friedrich Merz auf dem Schreibtisch liegen hatte.
Es gibt eine Stelle, bei der offenkundig wird, dass Münch diesen Gesichtspunkt nicht im Blick hat, wohl gar nicht in Rechnung stellt. Das ist sein Beispiel der unterschiedlichen Entwicklungen der neuen „Verhaltensökonomie“ in den Wirtschaftswissenschaften und der „Neuen Wirtschaftssoziologie“ in der Soziologie (S. 43 f.). Beides sind theoretische Innovationen mit ähnlichen Ausgangsfragen, aber nur in den Wirtschaftswissenschaften hat sich die Fragestellung zu einem lang andauernden Forschungsprogramm und in einer konsistenten Richtung der, so lässt sich vermuten, Wahrheitsannäherung entwickelt. In der Soziologie war es, wie so oft, anders. Hier ging es bald wieder auseinander in die bekannte Richtung: tausend neue Varianten ohne erkennbaren Fortschritt. Der (Hinter-)Grund: Hier ein relativ einheitliches, analytisch lange gut durchdachtes und axiomatisiertes Modell als Rahmen für das eigentliche Ziel, der Wahrheit (in der Mikrofundierung der ökonomischen Theorie) näher zu kommen. Dort eine eher wieder untertheoretisierte weitere Spezialausrichtung mit vielen ad-hoc-Annahmen und alsbald tausend kleinen Variationen, bald als wünschenswerte Pluralisierung goutiert und gefeiert. Manches soziologische Forschungsinstitut hat sich damit – ungestört – profilieren können – und die Auseinandersetzung darum, wo es denn nun weiter gegangen ist, erfolgreich vermeiden können.
Man sage nun nicht, dass das alles auch nur Oberfläche und Überbau der eigentlich relevanten Vorgänge der kapitalistischen Landnahme der Wissenschaft durch die neoliberalen Doktrinen mit der flächendeckenden Deformation des Wissenschaftssystems wären. Es ist die soziologisch wohlbekannte, aber schon lange nicht mehr aufgeworfene Frage nach den Beziehungen zwischen den Funktionssystemen einer Gesellschaft allgemein, also das, was Richard Münch ganz zum Schluss als sein nächstes Forschungsprogramm für das Gebiet seiner Wissenschaftssoziologie beschreibt. Von Seiten der Theorie der sozialen Produktionsfunktionen, der analytisch-empirischen Fassung der Orientierungshypothesen etwa bei Luhmann, auch Bourdieu und mit beiden auch bei Münch, ist die Antwort leicht und nicht sonderlich geheimnisvoll: Die wechselseitigen Beziehungen der Funktionssysteme sind eine Frage der relativen Gewichte bei den objektiven Knappheiten in der Realisierung des jeweiligen „Oberziels“, relative Preise und Opportunitäten also, einerseits und andererseits der Verankerung bestimmter, auch habitualisierter subjektiver Vorstellungen, Handlungsbereitschaften und Skills, Frames und Skripte also, bei denen, die das System tragen. Und dann kann man erwarten, dass in einem Funktionssystem, in dem sich ein Gleichgewicht so verschiebt, dass es Einseitigkeiten und dauerhafte Fehlfunktionen gibt, von innen heraus Korrekturen einsetzen – sofern es ein Sensorium gibt, das solche Ungleichgewichte registriert. Andernfalls: Ende der Autopoiesis unter diesem Code. Soweit man sehen kann, ist das die Lösung, die auch Luhmann schon hatte, nun aber in einer Form, die den Vorgaben einer Codierung entspricht, die die Erklärungskraft von Theorien in den Mittelpunkt stellt. Und dann eben mit einer Vorgabe der Pluralisierung der Wissenschaft alleine nicht auskommen kann, aber auch nicht mit einem System, das sich im Drang nach Effizienz und Kontrollen und der Vermessenheit anderer Funktionssysteme, dann doch die Dominanz zu übernehmen, allmählich selbst auflöst.
Das Buch von Richard Münch beschreibt sehr nachdrücklich wie weit solche Fehlfunktionen schon eingetreten sind, und man kann nur hoffen, dass das zur Restitution der Autopoiesis der Wissenschaft mit ihrer speziellen Codierung beiträgt, die, wie alle Codierungen von Funktionssystemen, immer deutliche Einschränkungen dafür mit sich bringen, was geht und was eben nicht. Es gibt viele weitere Anzeichen, dass manches aus dem Ruder der differenzierenden Ordnung läuft und mehr als nur ein Teil der derzeitigen (weltweiten) Anomie ist, auch aus dem System der Wissenschaft von innen heraus. Eines der Beispiele dafür ist die offensichtliche Krise auch der Bildungsforschung, ein weiteres Thema der Arbeiten von Richard Münch, oben schon einmal kurz erwähnt: Die (Bildungs-)Wissenschaft hat sich inzwischen so weit von den erkennbaren Sachlagen entfernt, auch über eine schon bedenkliche Hypertrophie von Geld, Aufmerksamkeit und Monopolisierungen, dass die Verwirrungen in der Diskussion um die Ursachen der neuerlichen Katastrophe bei PISA 2022 niemanden verwundern sollten.
Ein anderes Beispiel der Korrumpierung der Codierung der Wissenschaft von innen heraus ereignet sich ganz aktuell in der Fachvertretung der deutschen Soziologie, der DGS. Da klagen die neue und die vorherige Vorsitzende einhellig darüber, dass bei den letzten Vorstandswahlen nur noch Frauen gewählt worden seien und – in diesem Zusammenhang – dass sich kaum noch jemand aus der analytisch-empirischen, quantitativ forschenden Richtung der Soziologie dazu bereitfindet oder gewählt wird und es, besonders bedauerlicherweise, inzwischen auch mehr und mehr Zurückhaltungen gerade bei den jüngeren „Quantis“ gibt, sich bei der DGS zu engagieren. Auch das ist ein Beleg für die kurze Skizze von funktionalen Verschiebungen oben, eine, die aber durchaus etwas hoffnungsfroh stimmen kann: Es wird wenigstens schon einmal registriert, dass sich etwas verändert hat, was für die Funktionserfüllung der Soziologie als Wissenschaft von Bedeutung sein könnte. Die Repräsentation nach Geschlecht und die Pluralisierung der Perspektiven in einer Fachvertretung alleine sind es jedenfalls nicht, so wird jetzt eingestanden. Man will jetzt darüber sprechen. Warum nicht schon früher?
Über die Codierung eines Funktionssystems aber lässt sich nicht verhandeln, allenfalls darüber, ob das Funktionssystem, so wie Code und Programm lauten mögen, (noch) benötigt wird. Das wird sich zeigen, etwa wenn man in einem degenerierenden Fach so weiter macht wie bisher und es gleichwohl eine nicht still zu stellende Nachfrage gibt nach gewissen Leistungen, hier also: die nach belastbaren Erklärungen zur Lösung drängender Probleme, etwa für die Entwicklung von Techniken der regenerativen Energieversorgung oder der Erklärung für das Aufkommen autoritativer Regime. Der Code der Wahrheitsfindung ist dann wieder der unverzichtbare Rahmen, unter dem alles erst geordnet ist. Dieser Rahmen muss aber mit Überzeugung geteilt werden, und zwar nicht bloß als strategische Absicherung nach außen, wenn einmal gefragt würde, etwa angesichts des Programms eines Soziologie-Kongresses: Was machen die denn eigentlich da? Und dann erst entscheidet sich, ob sonst noch etwas zwingend dazu gehört oder nicht: Das Geschlecht der Vorsitzenden, und eine Repräsentation nach Quoten, die unterschiedlichen Ansätze, ein neuer Luhmann und natürlich auch einmal die Methoden und Techniken, die qualitativen wie die quantitativen? Die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Und damit auch die nach der Bewertung eines Fachs, das sich seinen Kern der Codierung als Wissenschaft so einfach nehmen lässt wie das in der Soziologie jetzt schon vor Jahren geschehen ist. Von außen auch, aber mehr noch von innen.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Jens Bisky.
Kategorien: Bildung / Erziehung Kapitalismus / Postkapitalismus Methoden / Forschung Systemtheorie / Soziale Systeme Universität Wissenschaft
Empfehlungen
Luhmann für Einsteiger
Julian Müller und Ansgar Lorenz erklären die Grundlagen der Luhmannschen Systemtheorie
Über provozierende Bücher und solche, die Hoffnung machen
Sieben Fragen an Nicole Mayer-Ahuja
Das Kind als eindimensionales Subjekt
Rezension zu „Das Problem Kind. Ein Beitrag zur Genealogie moderner Subjektivierung“ von Christoph T. Burmeister
