Daniel Stahl | Rezension | 12.09.2025
Zivilisatorischer Fortschritt?
Rezension zu „Fernes Unrecht – Fremdes Leid. Von der Durchsetzbarkeit internationalen Rechts“ von Gerd Hankel
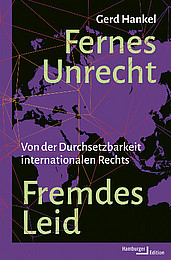
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt haben dazu beigetragen, einer nicht mehr ganz neuen Debatte wieder zu Relevanz zu verhelfen: Wann und mit welchen Mitteln sollen Regierungen, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen auf schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen reagieren?
Die neue Aktualität war – zumindest in diesem Ausmaß – sicherlich nicht absehbar, als Gerd Hankel Mitte der letzten Dekade mit seinem Forschungsprojekt begann, das in dem gerade erschienenen Buch Fernes Unrecht, Fremdes Leid mündete – ein umfassendes Werk, in dem der Jurist seine über Jahrzehnte in Forschung und Praxis gesammelte Expertise zum Völkerrecht und Völkerstrafrecht verarbeitet. Sein Argument beruht auf der These, dass sich im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte ein „zivilisatorischer Fortschritt“ (S. 18) eingestellt habe – trotz vieler Rückschläge und eines gegenwärtigen Gesamtbildes, das keineswegs „hell und strahlend“ (S. 14), sondern widersprüchlich sei. Heute bestehe die reale Möglichkeit, schwere Verbrechen „vor den Augen nationaler und internationaler Öffentlichkeiten“ (S. 18) mit dem Instrumentarium des Strafrechts zu verhandeln. Was diesen „Fortschritt“ ermöglichte und vor allem, wie er weiter vorangetrieben werden könne, davon handelt Hankels Buch.
Als „erste Etappe in der staatenübergreifenden Herausbildung eines ‚humanitären Gewissens‘“ (S. 35) identifiziert Hankel den Kampf gegen den Sklavenhandel. Von dort schlägt er den Bogen über die Gründung des Roten Kreuzes, die Haager Friedenskonferenzen und die Nürnberger Prozesse bis hin zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Dabei mischt er die Elemente eines humanitären Aufstiegsnarrativs (Rotes Kreuz und Friedenskonferenzen) mit denen eines völkerstrafrechtlichen (Nürnberg und Den Haag). Die Fixierung rechtlicher Normen habe in diesem Prozess eine wichtige Rolle gespielt. „Fernes Unrecht“, so eine These, spreche zu uns, „wenn Recht und Gesetz als Maßstab dienen“ (S. 72). Von „fernem Unrecht“ könne man sprechen, wenn die „Verletzung eines Normempfindens“ so massiv sei, „dass sie Tausende von Kilometern überbrückt und zu einer Erfahrung der Nähe wird“ (S. 21). Dabei gelte es, zwischen zivilisatorischem Versuch, der leicht wieder rückgängig gemacht werden könne, und echtem Fortschritt zu unterscheiden. Letzteres sei der Fall, wenn bei Vorliegen eines Unrechts gehandelt beziehungsweise normativ begründbar nicht gehandelt werde.
In seinen Ausführungen unternimmt Hankel dabei immer wieder Abstecher in verschiedene Bereiche, die zwar in einem Zusammenhang mit seinem Untersuchungsgegenstand stehen, aber nicht dem Strafrecht zuzurechnen sind. Mit Blick auf die Frage, wie auf fernes Unrecht zu reagieren sei, diskutiert er anhand zahlreicher Beispiele aus der internationalen Politik der letzten dreißig Jahre drei zentrale Instrumente: Diplomatie, militärische Interventionen (als vermeintliche Lösung) und Straftribunale. Unter dem letzten Punkt behandelt er sowohl internationale Gerichtshöfe wie den für Jugoslawien oder den Internationalen Strafgerichtshof als auch Verfahren vor nationalen Gerichten nach dem Universalitätsprinzip wie der Prozess in Konstanz gegen einen der massenhaften Folter beschuldigten Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes unter Assad. Dabei benennt er kenntnisreich und akribisch die zahlreichen Probleme, Widersprüche und Versäumnisse, die den Umgang mit schweren Gewaltverbrechen prägen. Dennoch kommt er zu dem Schluss, dass die Entwicklungen im Völkerstrafrecht als zivilisatorischer Fortschritt zu deuten seien. Es komme nun darauf an, nicht beim Erreichten zu verharren, sondern die Instrumente, die in der Welt seien, einzusetzen und weiterzuentwickeln.
Hankel greift auf die Nürnberger Prozesse zurück, um anhand dieses „Präzedenzfalls“ die Voraussetzungen für einen weitergehenden Fortschritt zu definieren: Die Objektivität zuständiger Gerichte sei essenziell für die Akzeptanz von Urteilen. Um zu vermeiden, dass das Völkerstrafrecht zu einem Instrument der Machtpolitik verkomme, sei die grundsätzliche Völkerrechtsfreundlichkeit jener Staaten unerlässlich, die sich für Gerichtsverfahren einsetzten. In diesen Verfahren komme es darauf an, den breiten historischen Kontext aufzuarbeiten und einen zu verengenden Blick auf die Straftaten zu vermeiden. Wichtig seien zudem schnelle Verfahren sowie die Wahrung der Rechte von Angeklagten und Opfern.
Abschließend geht er auf den gegenwärtigen Stand der Entwicklung ein und skizziert mögliche Szenarien. Jede Entwicklung, die nicht eine konsequente, auf die Schaffung von Legitimität abzielende Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts stärke, werde letztlich dazu führen, dieses Instrument des Menschenrechtsschutzes zu schädigen. Der Ist-Zustand sei kein Ort, an dem man unversehrt verharren könne.
Die gut geschriebene Studie basiert auf einer Fülle von Beispielen, die erkennen lassen, dass es sich beim Autor um einen langjährigen und präzisen Beobachter internationaler Politik handelt, der in der Lage ist, seine Vorschläge und Argumente auf einer breiten empirischen Basis zu diskutieren. Er geht sowohl detailliert auf die bekannteren Szenarien wie die „humanitären Interventionen“ der 1990er-Jahre (Irak, Jugoslawien, Kosovo) als auch auf die im europäischen Kontext seltener diskutierten Beispiele wie Tansania ein. Auf diese Weise vermeidet er ein Abdriften in ein ungebrochenes Fortschrittsnarrativ. Bei aller Emphase, mit der er für eine Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts plädiert, scheut er doch nicht davor zurück, die Ungereimtheiten einer Politik zu benennen, die für sich beansprucht, für die Menschheit zu handeln. Er zeigt politische Interessen hinter diesen Politiken auf und benennt Inkonsequenzen schonungslos. In der Summe dürfte die Zahl der von ihm kritisch diskutierten Beispiele höher sein als die „humanitärer Erfolgsgeschichten“. Mitunter fragt sich man daher, woher sein Glauben an einen Erfolg des Völkerstrafrechts rührt.
Und dennoch: Auch ein kritisch gebrochenes Festhalten am Narrativ des zivilisatorischen Fortschritts wirft Fragen und Probleme auf. Die Geschichte des Völkerrechts ist in den letzten Jahren zu einem immer intensiver erforschten Feld geworden. Eine wachsende Zahl von Studien zeigt, dass eine Gegenüberstellung von Machtpolitik einerseits und hehren humanitären Zielen andererseits nicht funktioniert. Die Weiterentwicklung des Völkerrechts war immer und in jeder Facette auch Machtpolitik. Humanitäre Argumente standen dazu gar nicht im Widerspruch, sondern im engen Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung globaler Machthierarchien und der Dominanz der Kolonialmächte – wie dies beispielsweise für den Kampf gegen den internationalen Sklavenhandel gezeigt wurde.[1]
Gerade im Bereich des Völkerrechts erfüllte das Zivilisationskonzept bis weit ins 20. Jahrhundert die Funktion, solche globalen Machthierarchien zu stabilisieren. Angesichts dieser Tatsache ist Hankels Entscheidung, weiterhin von zivilisatorischem Fortschritt zu sprechen, schwer nachvollziehbar. Er geht zwar auf die Problematik des Zivilisationskonzepts ein und ignoriert die entsprechende Forschung nicht vollständig, die insbesondere von den Third World Approaches to International Law (TWAIL) vorangetrieben wurde. Hankels Argumente, dennoch mit diesem Begriffsinstrumentarium zu arbeiten, überzeugen aber nicht.
Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht kann man auch die argumentative Nutzbarmachung der Nürnberger Prozesse nicht unkommentiert lassen, die nicht nur im hier besprochenen Buch aufzufinden, sondern generell in der Rechtswissenschaft üblich ist. Die alliierte Nachkriegsjustiz als Modellfall zu diskutieren, entfaltet zwar aus heutiger Perspektive eine gewisse Überzeugungskraft. Doch eine solche Herangehensweise verschleiert den Blick dafür, dass es nicht notwendigerweise den Prozessen immanente Faktoren waren, die „Nürnberg“ zum Erfolg gemacht haben. Dass heute ein positives Bild der alliierten Nachkriegsjustiz dominiert, liegt weniger an den Prozessen selbst als vielmehr daran, dass das Völkerstrafrecht in den 1990er-Jahren als Instrument zur Bewältigung internationaler Krisen entdeckt wurde. Insofern empfiehlt es sich, das Buch so zu lesen, wie der Autor auf das Völkerstrafrecht schaut: mit einem Gespür für seine Stärken und mit einer gehörigen Portion Skepsis.
Fußnoten
- Vgl. Suzanne Miers, Britain and the Ending of the Slave Trade, Boston, MA 1977; Johan Matthew, Margins of the Market. Trafficking and Capitalism across the Arabian Sea, Oakland, CA 2016.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Julia Eichenberg. Zuerst erschienen in H-Soz-Kult.
Kategorien: Gesellschaft Gewalt Globalisierung / Weltgesellschaft Internationale Politik Kolonialismus / Postkolonialismus Macht Militär Moderne / Postmoderne Normen / Regeln / Konventionen Politik Recht Sicherheit
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Prototyp der wirtschaftswissenschaftlichen Großforschung
Rezension zu „Primat der Praxis. Bernhard Harms und das Institut für Weltwirtschaft 1913–1933“ von Lisa Eiling
Das Sicherheitsversprechen
Rezension zu „Staat und Staatlichkeit in der europäischen Moderne“ von Thomas Mergel
Rette sich, wer kann!
Rezension zu „Die Aufklärung vor Europa retten. Kritische Theorien der Dekolonisierung“ von Nikita Dhawan
