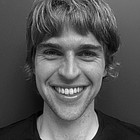Hannah Schmidt-Ott, Jens Bisky, Julian Müller, Stephanie Kappacher, Karsten Malowitz, Noah Serve, Lars Döpking | Veranstaltungsbericht | 24.09.2025
Duisburger Splitter II: Dienstag
Bericht vom 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Duisburg
Von Mythen und Servern
Gesellschaftliche Transitionen sind bekanntlich nicht immer leicht zu greifen. Sie unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer Gestalt – und hinsichtlich ihres Tempos. Das Panel Rasante, zähe Transitionen fragte nach der Rolle, die Temporalität und (Un)Verfügbarkeit als Parameter gesellschaftlicher Veränderung zukommt. Mit seinem Beginn am Dienstagmorgen um 9 Uhr gehörte es zu den allerersten Programmpunkten des Kongresses und ein entsprechend großes und motiviertes Publikum fand sich im Vorlesungsaal auf dem Duisburger Zentralcampus ein.
Den ersten Vortrag der von Oliver Dimbath (Koblenz) und Sarah Speck (Frankfurt an der Oder) moderierten und organisierten Veranstaltung übernahm die Bielefelder Soziologin Tine Haubner. Ihr Vortrag „Abgehängt. Left-Behindedness als Folge sozialräumlicher Transition und das ‚neue Landproletariat‘“ widmete sich sozialräumlicher Ungleichheit in Deutschland: Besonders betroffen von Armut, führte sie aus, seien ländliche Regionen – und zwar nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Landwirtschaftlicher Strukturwandel, Deindustrialisierung, demografischer Wandel und der Rückbau von Infrastrukturen führten zu einer zunehmenden Peripherisierung. Es entstünden ländliche Armutsräume, in denen vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit, private Verschuldung und eine ausgedünnte kommunale Versorgungslage zusammenträfen.
Das so entstehende neue Landproletariat versuche, sich mittels informeller Ökonomien über Wasser zu halten. Dazu gehörten, neben Nachbarschaftshilfe, auch Subsistenzwirtschaft, was die Autorin dieses Splitters dann doch überraschte. Haubner schränkte allerdings ein: War Subsistenzwirtschaft – also Anbau von Obst und Gemüse, Kleintierhaltung und -schlachtung etc. – in den 1980er- und 1990er-Jahren vollständig zum Hobby geworden, erfährt sie heute eine zwar Renaissance, allerdings in kleinem Maßstab und als Zusatzverdienst. Zu hoch sind die Hürden, da sie körperlich fordernd und zeitintensiv ist sowie viel Knowhow erfordert. Auch Nachbarschaftshilfe im Sinne von Tausch und gegenseitiger Unterstützung sei nicht mehr verbreitet, die Erosion dörflicher Gemeinschaften habe auch hier Spuren hinterlassen.
Sascha Dickels (Mainz) faszinierender Vortrag Auf dem rasanten Weg zur Superintelligenz? Zur (Un)Verfügbareit zukünftiger Technik präsentierte eine erhellende Diskursanalyse zu Artificial Superintelligence (ASI). ASI beschreibt eine noch hypothetische Form Künstlicher Intelligenz, die den Menschen in Sachen Klugheit aussticht und die sogenannte Singularität einleitet, also die Phase, in der der technische Fortschritt den Menschen überholt. Lange habe KI die großen Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden, nicht erfüllen können. Radikal gewandelt habe sich das erst mit dem Siegeszug von ChatGPT. Sam Altman, CEO von OpenAI, verkündete jüngst, dass ASI keine Science-Fiction mehr sei, sondern etwas, das man strategisch antizipieren müsse. Dickel zeichnete nach, wie Männer, Philosophen und Unternehmer, ASI antizipierten – mal sehnsüchtig, mal mahnend. Die Begeisterungsstürme seien ab den 1990er-Jahren jedoch zunehmend von Warnungen abgelöst worden; ASI könne schlimmstenfalls den Untergang der Menschheit herbeiführen. Heutige Tech-Unternehmer stellten sie allerdings unbeirrt als Utopie dar, die die komplexen Probleme, mit denen aktuelle Gesellschaften konfrontiert sind, zu lösen vermöge.
Interessanterweise herrscht in einem Punkt Einigkeit: Als Zeitpunkt, wann mit der Entwicklung einer ASI zu rechnen ist, werden stets die 2020er- und frühen 2030er-Jahre genannt. Diese Zukunft rückt also näher, wie könnte sie aussehen? Neben technikdeterministischer Beschleunigung ist laut Dickel auch die Lenkbarmachung technischer Entwicklung eine Option. Dafür sei entscheidend, wer ASI zur Verfügung stelle (Unternehmen? Nationen?) sowie ob und wie sie gesellschaftskonform gestaltet werden könne. In der Diskussion erkundigte sich Oliver Dimbath, was im Kontext der ASI eigentlich unter „Intelligenz“ zu verstehen sei. Dickel führte aus, der Begriff diene dazu, menschliche und maschinelle Leistungsfähigkeit in Bezug zueinander zu setzen – und beide auch in unserem Alltagsverständnis enger zusammenrückten, etwa wenn wir feststellten, dass die Antworten, die uns ChatGPT gebe, ja gar nicht so dumm seien. Anne Krüger hakte nach, welche Rolle dieser Diskurs für das soziologische Verständnis von gesellschaftlichen Entwicklungen spiele; insbesondere wenn Tech-Unternehmer versuchten, mit ihren Prognosen Investments zu generieren. Dickel erwiderte, dass die Debatte um ASI beginne, anderen existenziellen Risikodiskursen wie dem Klimawandel Konkurrenz zu machen – das mache ihn für die Soziologie relevant.
Im Anschluss gab Leo Roepert (Hamburg) in seinem Vortrag Dekadenz, Apokalypse, Wiedergeburt – Zur Zeitstruktur rechter Krisenmythen Einblicke in Geschichtsbilder der extremen Rechten. Sie beschreibe, so zeigte er, Geschichte stets als Bruch mit dem Status Quo – und zwar als gesellschaftlichen Niedergang, der in einer apokalyptischen Gegenwart kulminiere. In diesem Szenario inszeniere sich die Rechte als heroische Kämpferin in einem Entscheidungsmoment, um den Untergang entweder abzuwenden, aufzuhalten oder zu beschleunigen und anschließend die Gesellschaft ihren eigenen Vorstellungen entsprechend einzurichten. Nach einem kurzen Ausflug in die Ideengeschichte der Dekadenz zeigte Roepert, wie flexibel sie in rechten Diskursen eingesetzt wird. So könne etwa Björn Höcke ganz unterschiedliche Phänomene wie Multikulturalismus, Materialismus, Konsumismus etc. unter dem Sammelbegriff subsumieren und zugleich scharfe Kritik an ihnen üben. Dekadenz erscheine also nicht als äußere Bedrohung, sondern als endogener gesellschaftlicher Prozess.
Roepert konkretisiert seine Ausführungen in drei Dekadenzerzählungen. Erstens: Individualismus, Feminismus und ‚Genderideologie‘ bedrohten die binäre Geschlechterordnung und die Reproduktion der Gesellschaft; zweitens: Migration befördere den ‚Großen Austausch‘; und drittens: Russland begehre zu Recht gegen den ‚dekadenten Westen‘ auf. Roepert betonte, dass rechte Krisenmythen durchaus auf reale Krisen reagieren und diese in einer autoritären Weise verarbeiten. Gerade für verunsicherte Identitäten machten sie stabilisierende Angebote, wie man die Krise wahrnehmen, erklären und lösen könne.
Alexandra Schauer erkundigte sich in der Diskussion, ob die Attraktivität rechter Geschichtsbilder nicht auch darin bestehe, dass sie, im Gegensatz zu linken Krisenerzählungen, ein Angebot machten, wie Fortschritt möglich sei. Roepert stimmte zu: Ja, die Bilder verfügten über eine Zukunftsvision. Die sei jedoch keine Folge von Fortschritt in einem linearen Sinne, sondern ein Sprung aus der Geschichte heraus– häufig als apokalyptisches Moment.
Den Schlusspunkt setzte Andreas Folkers (Frankfurt am Main/New York, USA) mit seinem Vortrag über die „Fossile Moderne“. Unter dem Titel „Zur materiellen Grammatik sozial-ökologischer Transition“ zeichnete er ein eindrucksvolles Bild von fossilen Brennstoffen, die Treibstoff und Movens der Moderne seien. Mittlerweile verlangten ökologische Probleme eine Energiewende, die fossile Moderne scheine ausgedient zu haben. Doch das bedeutet nicht, dass wir sie einfach hinter uns lassen können: Sie lebt fort in Plastikbergen und CO2-Emissionen. So steht sie sowohl für eine uns überholt scheinende Vergangenheit, als auch für eine Zukunft, die nicht recht beginnen kann.
(Hannah Schmidt-Ott)

Science Wars
Wer sich auf Wikipedia oder beim Plaudern mit ChatGPT-5 nano über Science Wars zu informieren versucht, gewinnt rasch den Eindruck, es handele sich um längst Vergangenes, eine historische Episode aus den frühen 1990er-Jahren. Waren das nicht idyllische Zeiten damals, als der Physiker Alan Sokal einen von Phrasen und Unsinn strotzenden Beitrag in der Zeitschrift Social Text veröffentlichen konnte? Für viele war damit die „Unwissenschaftlichkeit“ von Poststrukturalismus und postmodernem Denken endgültig erwiesen.
Dass die Sektion Kultursoziologie am Dienstagnachmittag zu einer Sitzung unter dem Titel Science Wars – Kulturkämpfe um die Sozial- und Kulturwissenschaften einlud, hatte jedoch kaum mit antiquarischem Interesse an den Aufregungen der frühen Neunziger zu tun, sondern mit ganz aktuellen Sorgen. Die Kette der Invektiven gegen Sozial- und Kulturwissenschaften reißt nicht ab. Lars Gertenbach (Osnabrück) erinnerte zwar einleitend an die Sokal-Affäre und das uns spätestens seitdem begleitende „unendliche Aneinander-Vorbeireden“, Dringlichkeit aber verliehen der Rede über Science Wars die vielen Feindschaftserklärungen der jüngsten Zeit. Deren klassische Formulierung fand JD Vance, als er noch nicht Vizepräsident der Vereinigten Staaten war: „The professors are the enemies.“ Die Sektion Kultursoziologie überlegt, eine Tagung zum Thema auszurichten. Das Interesse in Duisburg war groß, nicht alle, die zuhören wollten, fanden Platz im Seminarraum. Um das wichtigste Ergebnis des lehrreichen Nachmittags für eilige Leser:innen, die gleich zum nächsten Kongresstermin wollen, vorwegzunehmen: Es scheint weder politisch noch wissenschaftlich eine gute Idee, Sokal und Vance unter einem Label zu vereinen, zu kritisieren und in die Schranken zu weisen.
Eine Analyse der US-amerikanischen Debatte um Critical Race Theory versprach Stefan Bargheer (Erfurt). Sein Vortrag trug den Titel „Polarisierung um Grenzobjekte“. Grenzobjekte erlauben es verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mit je eigener Logik, unterschiedlichen und eigenwilligen Sinnsystemen aufgrund schwacher Verbindungen, sich zu verständigen und miteinander zu kooperieren. Museen gelten als gutes Beispiel für Grenzobjekte. Bargheer begann seine Analyse mit Christopher Rufo, dessen Auftritt auf Fox News Donald Trump dazu angeregt haben soll, ein Dekret, das heißt eine executive order, gegen Diversity Training zu erlassen. Rufo fungiere als konservativer Aktivist; in Zeiten deutlicher Sprache hätte man ihn wohl einen Fanatiker genannt, getrieben von einer Obsession mit der Critical Race Theory und erfolgreich darin, diese Besessenheit politisch zu bewirtschaften. (Ob er glaubt, was er sagt, oder in erster Linie ein geschickter Stratege ist, der weiß, was funktioniert, ist eine müßige Frage.) Für Rufo ist Critical Race Theory nicht jene in den Rechtswissenschaften der 1970er-Jahre aufgekommene Rede vom strukturellen Rassismus – strukturell im Gegensatz zum bloß individuellen Vorurteil. Bargheer zufolge verschreit er die Theorie als Tarnkappe, unter der Marxisten und Linke versuchen, mittels race – statt mittels class – einen revolutionären Diskurs hervorzubringen und die kulturelle Hegemonie zu erlangen. Damit gefährden sie, so Rufo, die US-amerikanische Kultur, den American Way of Life.
Er nutze dieses Argument zur Fabrikation eines Gegners, den er erklärtermaßen konfrontieren und dazu veranlassen wolle, sich, andere und anderes zu verteidigen, auch das Nicht-zu-Verteidigende (to defend the indefensible). Viele Leute, so Bargheer, fielen darauf rein, gingen in die Polarisierungsfalle. Rufo hat an die tausend Fälle zusammengetragen, die er der Critical Race Theory zur Last legt und skandalisiert; indessen werden Tausende von Büchern verboten; PEN America informiert laufend.
Drei Bücher, die „besonders gern verboten werden“ und sehr erfolgreich waren, charakterisierte Bargheer näher: Ibram X. Kendis How to Be an Antiracist (2019), Isabel Wilkersons Caste (2020) und Heather McGhees The Sum of Us (2021). Die drei haben unterschiedliche Begriffe von Rassismus, berufen sich auf verschiedene Beispiele, empfehlen divergente Lösungen. Sie behaupten Unvereinbares oder widersprechen einander. So sei, das legte Stefan Bargheer nahe, der antirassistische Diskurs insgesamt beschaffen. Er folge einer kasuistischen Logik, ordne also einzelne Fälle nicht allgemeinen, abstrakt formulierten Grundsätzen zu, sondern setze auf Augenmaß, auch auf das Eigenrecht von Ausnahmen. Konfligierende Interpretationen und Widersprüche gehören dazu; will sagen: Der antirassistische Diskurs ist nicht so kohärent und in sich geschlossen, wie seine Gegner unterstellen. Es handele sich keineswegs um ein ideologisches Bollwerk. Um der Polarisierungsfalle zu entgehen, sollte diese Pluralität und Widersprüchlichkeit anerkannt werden. Auf diese Weise sei man nicht gezwungen, das Nicht-zu-Verteidigende zu verteidigen. Es gehe darum, den Gegnern nicht auch noch Munition zu liefern.
Selbstverständlich kam in der Diskussion die Frage, ob man nicht auch mit den eigentlich Nicht-zu-Verteidigenden solidarisch sein solle, wenn sie von Anti-Antirassisten angegriffen werden. Bargheer argumentierte überzeugend dafür, dass die Verteidigung unterstellte Einhelligkeit ablehnen und Differenzen nicht verschweigen oder zudecken, sondern annehmen und offensiv darstellen solle. Aber ist dies eine Frage der politischen Taktik, eine des wissenschaftlichen Selbstverständnisses oder eine der Science Wars? Und in welcher Arena der Auseinandersetzung verspräche diese Taktik Erfolg?
Lisa Gaupp (Wien) sprach über „Science Wars als symbolische Auseinandersetzungen um soziale Institutionen“. In rascher Folge resümierte sie Forschungen, ließ Schlagwort auf Schlagwort folgen, um die Machtasymmetrien – immer wieder reproduzierte Hierarchien – im Wissenschaftsbetrieb zu charakterisieren, Wege zu deren Kritik und Überwindung aufzuzeigen sowie auf dabei unvermeidliche Konflikte und mögliche Sackgassen hinzuweisen. Sie verteidigte die Autonomie der Wissenschaften, weil dank ihr Experimente – das Herausfordern von Hierarchien – möglich werden und neue Räume der Zugehörigkeit entstehen können. Der Solidarität sprach sie besondere Bedeutung zu, ohne Brüche zuzukleistern. Leider wurde sie selten konkret. Für das Thema des Nachmittags war ihr Vortrag interessant, weil er sich den vielfachen Auseinandersetzungen innerhalb der Kulturwissenschaften um Selbstverständnis und Praktiken widmete. Diskussionen über das Wechselspiel von innerwissenschaftlichen Kämpfen und von außen kommenden Angriffen auf die Wissenschaften wären aufschlussreich. Die geistesträge Leitartikelempfehlung, die Wissenschaften seien dann über alle Attacken erhaben, wenn sie so betrieben werden wie vor dreißig Jahren, wenn Streit um Machtverhältnisse und Praktiken vermieden wird, sollten wir gelassen zurückweisen. Stattdessen wäre genauer zu untersuchen, wie innere Konflikte und der Streit um die Sozialwissenschaften überhaupt einander beeinflussen. Möglicherweise prägen politische Debatten wissenschaftliche Praktiken vor allem in den Vorstellungen, die Wissenschaftspolitiker:innen und -manager:innen von zu erwartenden öffentlichen Reaktionen entwickeln.
Binnenverhältnisse und Außenbeziehungen zusammenzudenken, war das Ziel von Peter Fischer (Dresden) in seiner Skizze zur „Politisierung der Sozialwissenschaften als Reaktion auf gesellschaftliche Kulturkämpfe und als wissenschaftstheoretisches Problem“. Er sprach darüber, wie Wissenschaft im politischen Feld agiert, Wissenschaftler:innen zu politischen Akteuren, zu Aktivist:innen werden. Beispiele waren der March for Science im April 2017, die Referenzen sogenannter Klimaaktivist:innen auf Wissenschaft, die Verteidigung der Autonomie gegen politische An- und Eingriffe oder soziologische Studiengänge wie „Nachhaltigkeit und Innovation“. Nach einigen Nebenbemerkungen zu Robert Merton und der Norm der Disinterestedness kam er zu dem Fazit, dass die Sozialwissenschaften nicht länger Teil der Lösung des Kulturkampfproblems, sondern Teil des Problems selbst geworden seien. Mir ging die Argumentation zu schnell, zumal ja, historisch gesehen, politischer Aktivismus von Soziolog:innen keineswegs selten gewesen ist. Man denke nur an den großen Theodor Geiger und seine Analysen der deutschen Gesellschaft in den letzten Jahren der Weimarer Republik.
Wer sich in Kulturkämpfe einmische, statt sie zu analysieren, habe die Nerven verloren, sagte Stefan Hirschauer in der Diskussion. Zugleich verteidigte er die Wertegebundenheit der Wissenschaften. Seien denn nicht Wahrheit, Neugier, Intellektualität auch Werte? Gewiss. Gern würde man zurückfragen, ob nicht auch jede Analyse von Kulturkämpfen notwendig Teil derselben werde, da doch sich selbst beobachtende Gesellschaften ihre Stichworte und Selbstbeschreibungen dankbar auch der Soziologie entlehnen, die dann wieder deutet, was die Leute in soziologischen Termini so sagen – über sich und das Ganze.
Rubén Kaiser (Jena) sprach abschließend über „Öffentliche Alltagsverständnisse von Wissenschaft und die Rolle der Sozialwissenschaften“. Sein Titel „Fakten sind keine Meinungen“ lautet im gedruckten Programm „Meinungen sind keine Fakten“. Kaiser untersucht empirisch die Aktionen von Scientist Rebellion Germany, die in ihren Aktionen gegen die Fossil-Industrie und für eine angemessene Klimaschutzpolitik Inszenierungen wissenschaftlicher Autorität nutzen. Wenn sie fragen: „Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig – warum ignorieren wir sie?“, möchte man gern antworten: Weil Wissenschaft und Politik verschiedenen Logiken folgen, und Individuen wieder anderen. Dass Zigarettenrauchen der Gesundheit schadet, bestreiten noch weniger Leute, als es wissenschaftlich satisfaktionsfähige Leugner des Klimawandels gibt. Dennoch rauchen viele.
Doch die Entpolitisierung mittels „Follow the Science“ war nicht das Thema des Vortrags. Rubén Kaiser nahm die Behauptung des Titels Science Wars ernst und stellte drei davon nebeneinander: den Positivismusstreit, die klassischen Fälle aus den 1990er-Jahren, Sokal und so, und die Science Wars von heute. In den 1960er-Jahren hatte Kaiser zufolge die Wissenschaftstheorie das Primat, es ging um die Logik der Sozialwissenschaften. Danach sei es zu einer epistemischen Demokratisierung gekommen, verhandelt wurde in den Neunzigern der Status von Fach- und Laienwissen. Manche hätten damals gefürchtet, dass der Gesellschaft die Fähigkeit abhandenkommen könnte, Wissenschaft auf intelligente, also angemessene Weise zu verstehen. Und heute? 2016 wurde „postfaktisch“ zum Wort des Jahres erklärt. Seitdem gehe es, so Kaiser, um „öffentliche Epistemologie“ und „Politiken der Gewissheit“. Wir beobachteten Aushandlungen des öffentlichen Alltagsverständnisses von Wissenschaft. Er empfahl, sowohl die „Positivismus-Falle“ als auch die „Besserwisser-Falle“ zu vermeiden, also auf ein nostalgisch-positivistisches Wissenschaftsverständnis ebenso zu verzichten wie auf die Überlegenheitspose, man müsse den Laien jetzt mal sagen, was Wissenschaft eigentlich ist. Es sei nicht gut, ihnen ein Wissensdefizit zu unterstellen und darauf didaktisch zu reagieren.
Die drei Fälle hätten doch nichts miteinander zu tun, meinte wiederum Stefan Hirschauer in der Diskussion. In der Sokal-Affäre ging es um die Unterschiede zwischen science und humanities und deren widerstreitende Geltungsansprüche. Heute agiere Politik in den Vereinigten Staaten übergriffig, arbeite an der Errichtung autoritärer Herrschaft. So endete der Nachmittag der Science Wars mit vielen offenen Fragen, die unbedingt weiter behandelt werden sollten. Möglicherweise empfiehlt sich dabei eine Umkehr der Blickrichtung: Die Autorität der Wissenschaften scheint unangefochten, was angesichts der Geschichte nur erstaunen kann. Auch Querdenker, Klimaleugner oder Christopher Rufo argumentieren wissenschaftsförmig. Aktivist:innen wiederum versuchen, mit Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungsprozesse zu entpolitisieren. Die Science Wars der Gegenwart toben unter Wissenschaftsgläubigen oder werden von den neuen Autoritären geführt. In letzterem Fall gilt: Wer politisch angegriffen wird, muss sich politisch verteidigen.
(Jens Bisky)
Hyper Hyper
„Alles ist politisch“, ist ein Satz, der meist betont abgeklärt daherkommen soll und oft ziemlich dämliche Folgesätze nach sich zieht. Die Organisator:innen des Panels der Sektion Politische Soziologie – Ulf Bohmann (Chemnitz), Jenni Brichzin (München), Thomas Laux (Chemnitz), Jasmin Siri (Erfurt) und Jan-Peter Voß (Aachen) – taten daher gut daran, hinter die leere Phrase ein Fragezeichen zu setzen und so bereits im Titel der Veranstaltung deutlich zu machen, dass die derzeit zu beobachtende Ausweitung der Kategorie des Politischen auf alles Mögliche selbst kritisch hinterfragt werden sollte. In seiner Einleitung zeichnete Jan-Peter Voß daher zunächst nach, wie die diversen turns in den Sozial- und Kulturwissenschaften den Gegenstand der politischen Soziologie im Verlauf der letzten Jahrzehnte bis zu einem gewissen Grad haben verschwimmen lassen. Die stärkere Einbeziehung des Materiellen und der Körper sowie die Konfrontation mit zunehmend geopolitischen beziehungsweise geosozialen Herausforderungen habe unweigerlich auch das Politikverständnis der Soziologie verändert. Das schlage sich auch auf dem Publikationsmarkt nieder, wo derzeit in verschiedenen Büchern von Politics of Nature, Politics of Affect, Politics of Emotions, Politics of Infrastructure, Politics of Hair etc. die Rede sei.
Diese Entwicklung nahmen die Vortragenden der Veranstaltung zum Anlass, um grundsätzlich über den Gegenstand der politischen Soziologie und seine zunehmend unscharfen Grenzen nachzudenken. Den Anfang machte Nina Sökefeld (Hamburg), die spannende Einblicke in das „Feld reflexiver Körpergefühle“ bot. In ihrer ethnografischen Forschung setzt sie sich mit diversen Coachingformaten und Workshops auseinander, die darauf abzielen, „gute Gefühle“ für den eigenen Körper herzustellen. Die entsprechenden Schlagworte sind „Body Positivity“, „Selbstliebe“ und „Körperakzeptanz“. Dabei vermischten sich nicht nur Praktiken aus therapeutischen, kommerziellen und aktivistischen Kontexten, es lasse sich an derartigen Workshops und Selbsttechniken auch eine Politisierung körperbezogener Emotionen beobachten. Sökefeld rekonstruierte anhand ihres Materials, wie es dabei bisweilen zum Einsatz „rudimentären soziologischen Wissens“ komme, wenn etwa offensiv die Bewertung von Körpern durch die Gesellschaft oder gesellschaftliche Schönheitsideale und falsche Optimierungserwartungen thematisiert werden. Die Gesellschaft, von der in diesem Feld die Rede ist, erscheine dabei zumeist als negative und einschränkende Größe; die Kritik an ihr und die daraus resultierende Dekonstruktion von Schönheitsidealen wiederum werde als ein politischer Akt gewertet, durch den, mit C. Wright Mills gesprochen, „personal troubles“ zu vermeintlichen „public issues“ geraten.
Im anschließenden Vortrag von Conrad Lluis (Kassel) ging es dann stärker um theoretische Fragen. Im Mittelpunkt standen postfundamentalistische Theorien des Politischen, die mit einer strikten Unterscheidung zwischen den Sphären des Sozialen und des Politischen hantieren. Gegen Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, vor allem aber gegen den „Hyperlaclauianer“ Oliver Marchart erhob Lluis den Vorwurf einer einseitigen Privilegierung des Politischen. Das Soziale bleibe in diesen Theorien lediglich eine Residualkategorie. Gegenüber dieser verkürzten Darstellung gelte es, das – paradox gesprochen – politische Potenzial des Sozialen in den Blick zu nehmen. Darunter wollte Lluis gewissermaßen ‚kleine‘ Praktiken jenseits ‚großer‘ Antagonismen verstanden wissen. Zur Plausibilisierung verwies Lluis auf das Beispiel der öffentlichen Kritik an den prekären Arbeitsverhältnissen im Bereich der Pflege während der Corona-Pandemie und an entsprechenden Veränderungen der Anstellungsverhältnisse in Krankenhäusern. Der Zusammenhang zwischen dem diskutierten Beispiel und der theoretischen Herleitung blieb dabei jedoch unklar.
Leider war dies auch schon der letzte Beitrag in diesem Panel, denn die angekündigten Vorträge von Marlene Müller-Brandeck (Potsdam) über die spezifische Problematik der Identitätspolitik und von Frieder Vogelmann (Freiburg) über die Politik der Wissenschaften mussten leider entfallen. So blieb es an diesem Nachmittag bei lediglich zwei Fallbeispielen, wodurch das „Alles“ im Titel der Veranstaltung konterkariert wurde. Insgesamt vermisste man in der Veranstaltung jedoch nicht nur weitere vergleichende Fälle, man hätte sich auch gewünscht, dass die diagnostizierte „Inflationierung des Politikbegriffs“ (Voß) ihrerseits auch auf ihre politischen Implikationen befragt worden wäre. Anton Jäger, dessen Formel der Hyperpolitik erstaunlicherweise unerwähnt blieb, hat zuletzt die These einer auffälligen Gleichzeitigkeit von Über- und Entpolitisierung in der Gegenwart vertreten. Man muss seiner Argumentation nicht folgen, aber der von ihm beschriebene Problemzusammenhang hätte es verdient gehabt, diskutiert zu werden. So blieb die Veranstaltung am Ende unvollständig, litt dabei aber auch an kurzfristigen Absagen von Vorträgen, die sicherlich zu einer vielstimmigeren Diskussion des Themas geführt hätten.
(Julian Müller)
Raus aus dem Abseits
Das SG-Gebäude der Uni Duisburg liegt ziemlich abseits auf dem Campus. Wollte man die Veranstaltung der Ad-hoc-Gruppe 42 zum Thema Gesellschaftliche Aushandlungen um Infrastrukturen und Commons besuchen, hatte man zunächst einige Minuten Fußmarsch zu absolvieren. Im richtigen Gebäude angekommen, galt es, ins Untergeschoss hinabzusteigen, wo sich am Ende eines langen, kahlen Flures endlich der kleine Seminarraum befand.

Dessen periphere Lage bezeichnete Helge Schwiertz (Hamburg), seines Zeichens Moderator der Veranstaltung, in seiner Einführung sogleich als sinnbildlich dafür, welche Rolle Infrastrukturen lange Zeit in deutschen Debatten zugekommen sei, nämlich eine alles andere als zentrale. Als „Antwort auf den material turn“ in den Sozialwissenschaften und weil krisenhafte Zustände wie die Corona-Pandemie die existenzielle Bedeutung und Prekarität von Infrastrukturen offenbart hätten, sei das Thema zunehmend in den Fokus gerückt. Deshalb verfolgten er und die heute Vortragenden mit der Veranstaltung das Ziel, Infrastrukturen stärker in der deutschen Soziologie sichtbar zu machen, zumal dies im englischsprachigen Raum schon länger diskutiert würde. In der Ad-hoc-Gruppe solle es jedoch nicht um technische Aspekte etwa der Wasserversorgung gehen; im Fokus stünde die soziale Komponente, mithin die Frage: Welche Rolle spielen Infrastrukturen für das Soziale? Dazu habe jede Vortragende – außer Schwiertz war das Podium in der Tat ausschließlich weiblich besetzt – 15 Minuten Zeit.
Den Aufschlag machte Cordula Kropp (Stuttgart) mit ihrem Vortrag, in dem sie aus infrastruktureller Perspektive auf „Innovationen der Wohnungsversorgung in verfestigten Machtstrukturen“ blickte. Um die Bedingungen für Innovationen in der Wohnungsversorgung zu untersuchen, hatten Kropp und ihr Team unter anderem Interviews mit etablierten Akteuren im Feld, etwa aus der Bauwirtschaft, und sogenannten Nischenakteuren wie beispielsweise Bauinitiativen und -bewegungen geführt. Auf diese Weise konnten die Forscher:innen verschiedene Innovationsmodi herausarbeiten und die kollektive Handlungsfähigkeit der Akteure für transformative Innovationen analysieren. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen wurden schon beim Problemfokus deutlich: Während die etablierten Akteure aus Bauwirtschaft und -industrie an Verbesserungsinnovationen interessiert seien, mit denen sich Neubauprojekte effizienter umsetzen und Fehler vermeiden lassen („die Hälfte aller Bauvorhaben landet vor Gericht“), strebten Bauinitiativen und -bewegungen nicht weniger als einen Systemwandel zur Erfüllung sozialer Bedürfnisse bei gleichzeitiger Vermeidung von Umweltschäden an. Die infrastrukturelle Macht liege, so das Ergebnis der Untersuchung, eindeutig bei den etablierten Akteuren, denn diese könnten Standards und Normen der Baupraxis definieren, während Nischenakteure stets an dieses Regelwerk gebunden seien. Das schränke den Möglichkeitsraum für Innovationen stark ein, etwa weil Bauinitiativen stets mit Architekt:innen und Handerwerker:innen konfrontiert seien, von denen der Großteil immer noch „so bauen will wie vor 20 Jahren“.
Daran anschließend eröffnete Lisa Vollmer (Erkner) dem Publikum zunächst die Modifikation des Titels ihrer Präsentation. Von „Wohnraumversorgung als Infrastruktur: theoretische Implikationen“ hatte sie diesen geändert in „Wohnraumversorgung als Infrastruktur: Zum Stand der Debatte“, um die verschiedenen Strömungen der Diskussion zu erläutern und, wie sie sympathisch offenbarte, gleichwohl etwas tiefer zu stapeln. Lange Zeit sei Wohnen nicht als Infrastruktur angesehen worden, weil zwei zentrale Kriterien dafür nicht erfüllt seien: Erstens können Infrastrukturen von Personen genutzt werden, ohne dass diese einen finanziellen Beitrag dazu leisten, und zweitens schließt die Nutzung der Infrastruktur durch eine Person die gleichzeitige Nutzung durch weitere Personen nicht aus. Beides ist etwa bei Straßen, Schulen oder Parks der Fall. Zugleich erfüllt Wohnen aber viele der auf Infrastrukturen angewandten Kriterien, etwa die räumliche Gebundenheit und lange Lebensdauer von Wohngebäuden sowie die Notwendigkeit einer zentralen Planung. So existiere schon seit einiger Zeit eine breite Debatte über die Konzeptualisierung von Wohnen als Infrastruktur, deren zwei Hauptstränge laut Vollmer einerseits eine analytische, andererseits eine normative Perspektive einnehmen. Letztere fordere mit ihrem Konzept der Sozialen Infrastruktur (Holm 2022) insbesondere, „eine öffentlich organisierte und über Steuern finanzierte Gewährleistung von existenznotwendigen Leistungen für alle“. Die analytische Strömung diskutiere unter anderem die Frage, ob auch der private Mietmarkt als Infrastruktur gefasst werden könne. Vollmer und ihre Kolleginnen machen vier Dimensionen eines Wohnungsregimes aus – Governance, räumliche Materialisierung, soziale Praktiken und Ökonomie –, die aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven erforscht werden. Da diese Dimensionen sich gegenseitig bedingen, plädieren Vollmer & Co. dafür, Brücken zwischen den Fachrichtungen zu bauen und interdisziplinär zu arbeiten.
Von aus Beton gegossenen Wohngebäuden ging es mit Nina Schuster (Dortmund) zur Abwechselung raus ins Grüne. Auf Basis ihrer ethnografischen Forschung zu Kleingartenvereinen in einer ost- und einer westdeutschen Großstadt konzeptualisierte sie „Kleingärten als soziale Infrastrukturen“ und fragte: Wie kommen Menschen, die im sonstigen Alltag nichts miteinander zu tun haben, im Kleingarten miteinander aus? Überwinden sie Vorurteile und soziale Distanz? Ja, lautete Schusters klare Antwortet. Im Folgenden beschrieb sie Schrebergärten anschaulich als Orte der Begegnung, an denen soziale Differenzen in Praktiken ausgehandelt und überwunden werden, etwa in Gesprächen über das „korrekte gärtnerische Tun und Lassen“ oder bei einem Schnäpschen am Gartenzaun im Gegenzug für eine nachbarschaftliche Hilfsleistung.
Nach einer kurzen Pause war erneut Helge Schwiertz an der Reihe. Seine Forschung ging der Frage nach, inwiefern Infrastrukturen soziale Transformationen in Gang bringen und organisieren können, die bei Sozialen Bewegungen ansetzen, und wie durch Infrastrukturen Konflikte ausgetragen und Alternativen erprobt werden. Im Rahmen einer Fallstudie untersuchte Schwiertz die vor gut zehn Jahren gegründete Initiative „Wilhelmsburg solidarisch“ (WISO) auf der gleichnamigen Hamburger Elbhalbinsel und arbeitete „Infrastrukturen der Entfremdung“ sowie „Infrastrukturen der Solidarität“ heraus. WISO hatte sich von Anfang an vorgenommen, soziale Probleme der Menschen vor Ort zu adressieren, also mehr praktische Alltagshilfe anzubieten, statt politisch abstrakte Forderungen zu formulieren. Ein zentraler Akteur, mit dem die WISO-Mitarbeiter:innen regelmäßig konfrontiert seien, ist das Jobcenter. Dieses fasst Schwiertz als Infrastruktur der Entfremdung, weil hier sowohl Sachbearbeiter:innen als auch Kund:innen entpersonalisiert und in ein hierarchisiertes Verhältnis zu einander gesetzt werden. Die Kund:innen werden zu Sachverhalten und bloßen Bestandteilen von Datensätzen degradiert, auf abstrakte Prozesse reduziert, auf die sie keinen Einfluss nehmen können. In der ständigen Auseinandersetzung mit dem Jobcenter sei bei WISO ein kollektives Wissen über die dortigen Abläufe und Prozeduren entstanden, das wiederum bei WISO als Gegen-Infrastruktur, als „Infrastruktur der Solidarität“, genutzt werde. Als weitere solidarische Infrastrukturen bei WISO stellte Schwiertz den „Bürotag“ und den „Anlaufpunkt“ vor, beides Maßnahmen, bei denen es nicht nur darum gehe, gemeinsam Formulare des Jobcenters oder anderer Akteure korrekt auszufüllen, es gehe immer und insbesondere darum, „zusammenzukommen und [sich] gegen die prekäre Scheiße zu wehren“, also individuell erfahrene Probleme zu de-privatisieren und kollektiv Lösungsansätze zu entwickeln.
Als Letzte im Bunde verortete Silke van Dyk (Jena) „Kollektive Infrastrukturen im Spannungsfeld von Commoning und Community-Kapitalismus“. Sie griff dabei auf das von Tine Haubner und ihr entwickelte Konzept zurück, bei dem öffentliche Aufgaben oder professionelle Tätigkeiten – häufig in Form von ehrenamtlichem Engagement – an die Zivilgesellschaft, beispielsweise Vereine oder Nachbarschaften, delegiert und auf diese Weise Sorgelücken des Sozialstaates geschlossen werden. Van Dyk machte es sich zur Aufgabe, auf die Kehrseiten und Fallstricke von Commons hinzuweisen, weil Letztere häufig idealisiert würden. Ein Problem sei beispielsweise, dass Initiativen das auf Dauer mögliche zivile Engagement, das Einzelne leisten können, vielfach radikal überschätzen würden. Auch gerieten viele in eine Art „Mitmachfalle“, weil damit geworben werde, dass jede:r sich engagieren könne. Es führe häufig zu Frustration, wenn klar werde, dass am Ende eben doch nicht alle „ordinary people“, sondern jene mit höherem Bildungsabschluss bestimmte Arbeiten übernehmen. Während Commons ja „so hip“ seien und sich jede:r gern dieses Label anheften würde, plädierte van Dyk für ein kritisches Hinterfragen, ob es sich bei der Kollektivierung von Infrastrukturen um echte Demokratisierung und Partizipation oder doch um Ausbeutung handelt, mithin also eine „Verzivilgesellschaftlichung statt Vergesellschaftlichung“ von statten geht.
(Stephanie Kappacher)
Reden und reden lassen
Es mangelt dem Wissenschaftsbetrieb an vielem, vor allem natürlich am lieben Geld. An einem aber mangelt es ihm nicht: an kontrovers diskutierten Themen. Ganz gleich, worum es geht, um Klimawandel oder Digitalisierung, Migration oder Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz oder soziale Ungleichheit, Geschlechtergerechtigkeit oder Energiewende – zuverlässig bilden sich zu jedem Thema unterschiedliche Meinungen heraus, die von den Beteiligten vehement und mitunter auch polemisch vertreten werden. So weit, so bekannt. Seit einigen Jahren jedoch – Seit wann genau eigentlich? – wird in diesen Debatten immer öfter der schwerwiegende Vorwurf einer Einschränkung der Meinungs- und Redefreiheit laut. Egal, wie viel schon geredet und geschrieben wurde, früher oder später findet sich einer – seltener ist es eine –, der behauptet, dass man zu dem Thema nicht (mehr) alles sagen oder schreiben dürfe, und der diese Behauptung dann öffentlich macht, was für gewöhnlich weitere, zumeist erregte Debatten insbesondere in den Sozialen Medien nach sich zieht. Doch was ist dran an diesen Vorwürfen, die nicht selten von Personen erhoben werden, denen Kritiker:innen attestieren, damit eine eigene politische Agenda zu verfolgen? Wie frei ist die akademische Diskussion an Universitäten und Hochschulen? Wie frei und unabhängig sind Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen in der Gestaltung von Forschung und Lehre? Ist die vielbeschworene Cancel Culture bereits Realität in Academia?
Für eine empirisch fundierte Beantwortung dieser häufig gestellten, aber bislang nur auf der schwachen Grundlage subjektiver Eindrücke und zugetragener Schilderungen verhandelten Fragen fehlte es bislang an belastbaren Daten. Dieses Datenmaterial bereitzustellen ist das hehre Ziel einer vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) durchgeführten und von der Zeit Stiftung Bucerius ermöglichten Studie, deren Ergebnisse im Oktober des vergangenen Jahres in Form eines Kurzberichts veröffentlicht wurden. Betraut mit der Konzeption und Umsetzung dieser deutschlandweit ersten repräsentativen Studie ihrer Art war ein bewusst heterogen zusammengesetztes Team von Wissenschaftler:innen und Journalist:innen um Gregor Fabian (Berlin), Mirjam Fischer (Berlin und Frankfurt am Main), Julian Hamann (Berlin), Uwe Schimank (Bremen), Christiane Thompson (Frankfurt am Main), Richard Traunmüller (Mannheim) und Paula-Irene Villa Braslavsky (München). Zusammen mit Stephan Lessenich (Frankfurt am Main) nutzte ein Teil der Verantwortlichen den Kongress, um das Design und die wesentlichen Befunde der Studie im Rahmen der Ad-hoc-Gruppe Akademische Redefreiheit – Eine empirische Studie in der Diskussion zunächst vorzustellen und sodann kritisch kommentieren zu lassen – und stieß damit bei dem im gut gefüllten Seminarraum versammelten Publikum auf reges Interesse.
Ausgehend von der konflikthaften und affektbesetzten Diskussion um Cancel Culture und die Grenzen des Sagbaren, so Villa Braslavsky & Co., habe man sich bewusst dafür entschieden, anstelle des juridischen Grundsatzes der Wissenschaftsfreiheit den Aspekt der akademischen Redefreiheit ins Zentrum zu stellen, um die persönlichen Erfahrungen, Erwartungen und Deutungen der Befragten im Zusammenhang mit den Regeln und Grenzen des Wissenschaftssystems in den Blick zu bekommen. Zu diesem Zweck habe man im Zuge einer Onlinebefragung eine repräsentative Zufallsauswahl von nicht weniger als 54.690 hauptberuflich an deutschen Hochschulen mit Promotionsberechtigung lehrenden wissenschaftlichen Beschäftigten angeschrieben, von denen immerhin 9.083 Personen die ihnen zugeschickten Fragen vollständig beantwortet hätten. Gefragt worden sei nach selbst erlebten wie auch nach berichteten Beeinträchtigungen in Lehre und Forschung infolge der Äußerung von Wertungen und Meinungen oder der Behandlung von Themen, aber auch nach den als angemessen erachteten Reaktionen auf hypothetische Konfliktszenarien, etwa im Zusammenhang mit der negativen Bewertung des Gebrauchs gendergerechter Sprache im Kontext von Prüfungen.
Die Ergebnisse der Befragung förderten nach Ansicht der Forschenden einen durchaus positiven Befund zutage. Demnach würde eine deutliche Mehrheit von 79 Prozent der Befragten die Autonomie und Freiheit des deutschen Wissenschaftssystems als „sehr gut“ (18 Prozent) beziehungsweise „eher gut“ (61 Prozent) beurteilen, wobei die Statusgruppe der Professor:innen insgesamt zu einer positiveren Einschätzung tendiere als die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen und Männer das System häufiger mit „sehr gut“ bewerteten als Frauen. Auffällig sei zudem, dass der Anteil berichteter negativer Erfahrungen in Form von inhaltlicher Kritik (42 Prozent), moralischer Abwertung (14 Prozent) oder beruflicher Probleme (12 Prozent) in Forschung und Lehre jeweils signifikant höher liege als der entsprechende Anteil eigener Erfahrungen (27 Prozent, 6 Prozent und 6 Prozent).
Was die Grenzen des Sagbaren und Erlaubten betrifft, sähe eine überwältigende Mehrheit von 90 Prozent diese dort überschritten, wo die Inhalte und Werte des Grundgesetzes abgelehnt werden. Als unzulässig im akademischen Diskurs erachte eine Mehrheit der Befragten zudem die verweigerte Anerkennung des staatlichen Existenzrechts Israels (69 Prozent), die Leugnung des Klimawandels (64 Prozent) oder die verpflichtende Einführung gendergerechter Sprache (62 Prozent). Der letztgenannte Punkt werde jedoch durchaus kontrovers beurteilt, was sich daran zeige, dass immerhin 29 Prozent der Befragten ihrerseits die Verweigerung gendergerechter Sprache im akademischen Diskurs für unzulässig erachteten.
Hinsichtlich des Umgangs mit Konflikten zeigten die Antworten auf die zur Beurteilung vorgelegten hypothetischen Fallbeispiele (Vignetten), dass eine stabile Mehrheit von knapp 60 Prozent der Befragten dazu tendiert, entsprechende Streitfälle an die zuständigen Gremien zu überweisen, wobei offenblieb, ob dies als Ausdruck von Vertrauen oder von Arbeitsvermeidung zu werten ist. Insgesamt, so die Verantwortlichen, belegten die Ergebnisse der Studie keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Angehörigen der Statusgruppen hinsichtlich der Erfahrung von Einschränkungen der akademischen Redefreiheit. Diese seien, entgegen ihren ursprünglichen Erwartungen, in der Gruppe der befristet Beschäftigten nicht größer als in derjenigen der verbeamteten Professor:innen. Signifikante Unterschiede bestünden allerdings hinsichtlich der Erwartung und Wahrnehmung negativer Auswirkungen auf die eigene Lehre und Forschung. Entsprechende Eindrücke seien in der Gruppe der befristet Beschäftigten deutlich stärker ausgeprägt, und zwar insbesondere im Umgang mit gesellschaftlich kontrovers diskutierten Themen.
Überraschender als diese bei näherem Hinsehen erwartbare Feststellung waren zwei weitere Befunde, mit denen die Forscher:innen um Villa Braslavsky am Ende ihrer Präsentation aufwarteten. So legten die Ergebnisse der Befragung zum einen nahe, dass die fachliche Zugehörigkeit der befragten Wissenschaftler:innen so gut wie keinen Einfluss auf die Erfahrung, Erwartung oder Wahrnehmung von Einschränkungen der akademischen Redefreiheit hat, Sozial- und Geisteswissenschaftler:innen von diesen also nicht stärker betroffen sind als Angehörige anderer Disziplinen. Und zum anderen deuteten die Befunde darauf hin, dass auch Geschlechterunterschiede seitens der befragten Wissenschaftler:innen für das Ergebnis der Studie keine Rolle spielten. Alles gut also in Academia?
Nicht ganz. In ihren Anmerkungen machten die zur kritischen Diskussion der Studie eingeladenen Kommentator:innen auf eine Reihe problematischer oder zumindest diskussionswürdiger Punkte aufmerksam. Den Auftakt machte – „kernig-kritisch, sachlich-fachlich“ – Stephan Lessenich, der den Aspekt der Performativität in den Blick nahm. Während die Studie mittels empirischer Befunde zur Versachlichung der Diskussion beitragen und Vereinfachungen verhindern wolle, positioniere sie sich doch auch in einem politisierten Feld und sei daher seit ihrer Veröffentlichung nicht zufällig selbst zum Gegenstand von Politisierung geworden. So habe das Politmagazin Cicero der Studie unterstellt, „akademische Cancel Culture wegzaubern“ zu wollen, während man ihr bei Focus Online attestierte, endlich „die Wahrheit über ,Cancel Culture‘“ zu verkünden. Als einen wesentlichen Grund für die Politisierung der Studie und ihre versuchte Vereinnahmung nannte Lessenich die Entscheidung der Verantwortlichen, die Befunde der Studie in einem Kurzbericht zu veröffentlichen. Damit habe man sich bewusst von einem innerakademischen in einen breiteren öffentlichen Diskurs begeben und einer entsprechenden Rezeption Vorschub geleistet. Zudem, so Lessenich weiter, seien zentrale Begriffe der Studie unklar. So werde unter anderem nicht hinreichend deutlich, was in der Befragung als „Einschränkung der Autonomie und Freiheit“ verstanden werde. Je nach subjektiver Wahrnehmung der Lehrenden und Forschenden könnten darunter auch „Drittmitteldruck, Exzellenzwahn und Bolognisierung“ verstanden werden – relevante Kriterien, die jedoch nichts mit der infrage stehenden Beschränkung von Redefreiheit zu tun hätten.
Einen etwas anderen Akzent setzte Tilman Reitz (Jena), der zwar die Kritik an der Ambiguität der Studie teilte, im Gegensatz zu Lessenich aber den Begriff der akademischen Redefreiheit und dessen Operationalisierung ausdrücklich lobte, weil er auch der spezifischen Form des Wissens aus Erzählungen Rechnung trage. Irritiert zeigte sich Reitz von der für sein Empfinden ausgeprägten Verbotsneigung, mit der etliche Wissenschaftler:innen auf abweichende Meinungen zu kontroversen Themen reagierten. Dies nahm er zum Anlass, um noch einmal die Frage zur Diskussion zu stellen, ob es am Ende nicht womöglich die eigentlich moderaten Forderungen nach der Durchsetzung bestimmter sprachlicher Regulierungen gewesen seien, die den Rechten „eine Steilvorlage“ geliefert hätten.
Den dritten und letzten kritischen Kommentar steuerte Dagmar Simon (Berlin) bei, die in ihren Ausführungen einen schon von Lessenich benannten, aber nicht näher ausgeführten Punkt hervorhob, nämlich die Frage nach den gesellschaftlichen wie institutionellen Bedingungen, unter denen akademische Forschung und Lehre in Deutschland betrieben wird. Unter Rekurs auf die Ergebnisse eigener empirischer Erhebungen wies Simon darauf hin, dass Wissenschaftler:innen nicht nur durch aufgeheizte öffentliche Debatten – wie etwa gegenwärtig über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Gaza – verunsichert würden, sondern dass auch die Modi der Vergabe von Forschungsmitteln geeignet seien, einem gewissen Konformitätsdruck Vorschub zu leisten, der wirklich innovatives Denken und die Suche nach radikal neuen, von bestehenden Ansätzen abweichenden Lösungen verhindere. Um beidem zu begegnen, so Simon, brauche es veränderte Verfahren und institutionelle Reformen.
Damit hatten die Veranstalter:innen der Ad-hoc-Gruppe und die von ihnen geladenen Kommentator:innen einen weiten Bogen an Themen und Fragestellungen gespannt, der Stoff für eine lebhafte Diskussion bot, an der sich in der verbleibenden Stunde auch weite Teile des Publikums aktiv beteiligten, die dabei auch mit methodischer Kritik nicht hinter dem Berg hielten. Zumindest im Rahmen dieser Veranstaltung war es um die akademische Redefreiheit bestens bestellt.
(Karsten Malowitz)

Migration als Zeiterfahrung
Die Veranstaltung Transitions and Temporalities in Migration zeigte: An thematischer Anziehungskraft mangelt es der Sektion Migration und ethnische Minderheiten nicht. Der um die vierzig Personen fassende Raum hinter der Duisburger Universitätsbibliothek war am frühen Nachmittag so gut besucht, dass manche Nachzügler:innen direkt kehrtmachten – und wohl in eine andere Veranstaltung weiterzogen. Doch bevor an dieser Stelle allzu voreilige Schlüsse hinsichtlich der Pull-Faktoren migrationssoziologischer Veranstaltungen auf dem DGS gezogen werden, sei gewarnt: Die Zeit der Push-and-Pull-Analysen ist vorbei. Das sozialwissenschaftliche Verständnis von Migration ist längst komplexer. Die Sektion ergänzte daher für ihren Call den prozesshaften Charakter von transition um eine zweite Dimension – der temporality, Migration als Zeiterfahrung.
Zum Auftakt der sechs eng getakteten Vorträge präsentierte Pınar Gümüş Mantu (Gießen) unter dem Titel „Postmigrant Times: Remembering Migration History, Envisioning Critical Futures“ ihre Erkenntnisse zur biografischen Dimension individueller Migrationserfahrungen. Anhand von vier Interviews mit jungen, deutschen Frauen mit türkischer Migrationsgeschichte zeigte sie, wie eine kritische Auseinandersetzung mit der familiären Migrationserfahrung Scham in Identifikation verwandeln kann. Mantu will damit das transformative Potenzial von Erinnerungspraktiken in postmigrantischen Zeiten betonen: Identifikation mit der eigenen Geschichte kann die individuelle Wahrnehmung gegenwärtiger und zukünftiger Chancen maßgeblich prägen.
Die Einbeziehung subjektiver Wahrnehmungen in die Migrationsforschung bedeutet jedoch nicht, institutionelle Strukturen auszublenden. Dem Vortrag von Anne Lisa Carstensens und Maren Kirchhoffs (beide Kassel) „The Relevance of Time in Struggles over Labour, Migration and Life“ zufolge befinden sich beide vielmehr in einem konstitutiven Verhältnis. Ihre These: Temporale Logiken der Migrations-, Arbeits- und Sozialpolitik – wie zeitliche Begrenzungen von Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen, Sozialversicherungsansprüchen und Arbeitsverhältnissen – bedingen Konflikte zwischen Arbeit und Leben bei Personen mit Migrationserfahrung. Empirische Fallstudien aus dem Reinigungsgewerbe und der landwirtschaftlichen Saisonarbeit zeigten, wie migrantische Arbeiter:innen als Reaktion auf zeitbezogene Migrationsinstitutionen Strategien entwickeln. So arbeiten Saisonarbeiter:innen etwa bewusst besonders intensiv, um in der begrenzten Aufenthaltszeit möglichst viel zu verdienen; ist der Aufenthaltstitel jedoch an die Beschäftigung gekoppelt, werden Arbeitsprozesse gezielt in die Länge gezogen.
An die Themen Arbeit und Migration knüpfte der Vortrag „Convivial Moments in In-Between Spaces: Exploring Experiences of Romanian and Polish Mobile Workers in Brandenburg“ an. Im Gegensatz zu den vorherigen Präsentationen legten Iepke M. Rijcken und Kyoko Shinozaki (beide Salzburg) jedoch den Schwerpunkt auf räumliche Aspekte. Ihr Forschungsprojekt untersucht die transnationale Bewegung mobiler Leiharbeiter:innen aus peripheren Regionen Polens und Rumäniens nach Brandenburg. Die Mobilität dieser Arbeitskräfte eröffne dabei die Möglichkeit, Konvivialität jenseits fester Orte – also zwischen verschiedenen Räumen – zu beobachten: als solidarisches Zusammenleben bei gleichzeitiger Wahrung von Unterschieden. Die Ergebnisse zeigten etwa, dass mobile Arbeiter:innen unterschiedlicher Herkunft, die sich in Deutschland niederlassen wollen, häufig engere Verbindungen untereinander aufbauen als zu Landsleuten ohne solche Pläne.
Emmanuel Ndahayo und Karin Schittenhelm (beide Siegen) sprachen über „Refugee Family Reunification: The Temporality and Precarity of a Transitional Phase“. Mit einer thematischen Rückbesinnung auf die Wirkung von temporality auf institutionelle Migrationsprozesse zeigten sie anhand eines Vergleichs von Familienzusammenführungen in Deutschland und Frankreich: Je länger ein Verfahren dauert, desto prekärer wirkt es sich auf die betroffene flüchtende Familie aus. Besonders deutlich werde dies im deutschen Fall, wo strikte Fristen, die Nicht-Rückgabe von Personenstandsurkunden und restriktive Prüfungen von Dokumenten das Risiko erhöhen, ganz vom Verfahren ausgeschlossen zu werden.
Eine andere Erfahrung machten ukrainische Geflüchtete in Deutschland, zumindest zufolge des Vortrags „Uncertain Futures, Self-Made Presents: The Case of Ukrainian Protection Holders in Germany“. Wie Larissa Kokonowskyj (Berlin) erläuterte, wird „Uncertainty“ als Flüchtlingserfahrung in der Forschung meist als per se negativ verstanden – zu Unrecht: Unsicherheit könne auch Handlungsspielräume eröffnen. Voraussetzung dafür sei die Handlungs- und Bewegungsfreiheit von Migrant:innen im sozialen und räumlichen Kontext. Für ukrainische Geflüchtete in Deutschland ist beides durch die „EU Temporary Protection Directive“ gesichert: Sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen, erhalten Arbeitserlaubnisse und Zugang zu Sozialleistungen. Zudem handelt es sich demografisch überwiegend um hochqualifizierte Frauen mit Familienangehörigen. Gemeinsamen mit der abwesenden Katarina Mozetič (Malmö) führte Kokonowskyj fünfzig Interviews mit zehn ukrainischen Geflüchteten und fand heraus, dass die genannten institutionellen und persönlichen Voraussetzungen es ermöglichen, Unsicherheit produktiv zu nutzen, um verschiedene Zukunftsoptionen zu entwerfen. So entwickelte sich laut den empirischen Ergebnissen eine andere Wahrnehmung von Deutschland: von der temporären Ausnahmesituation hin zu einem dauerhaften Lebensmittelpunkt – ermöglicht durch die Kombination von „Uncertainty“ und „socio-spatial autonomy“.
Den Schlusspunkt setzte Fränzi Buser (Zürich) mit der Beobachtung, dass Unsicherheit und Zeiterfahrungen von Migrant:innen nicht ohne Berücksichtigung intergenerationaler Unterschiede verstanden werden können. In ihrem Vortrag „Between Bustling Play and Waiting ,Like a Stone‘: Doing Time of Children and Their Parents in Refugee Camps in Switzerland“ zeigte sie anhand ethnografischer Studien in Schweizer Flüchtlingsunterkünften, wie Eltern und Kinder auf unterschiedliche Weise mit den Wartesituationen des Camp-Alltags umgehen. Während Eltern das Leben dort häufig als monoton und passiv („wie ein Stein“) wahrnehmen, werden Kinder doppelt institutionalisiert: als Geflüchtete innerhalb der Unterkunft und als Kinder – im Sinne westlicher Vorstellungen von Kindheit – in Schule und Freizeit. Dadurch erleben sie Zeit grundlegend anders als ihre Eltern.
Auch wenn die Vorträge der ersten migrationssoziologischen Sektionsveranstaltung auf dem Duisburger Kongress unterschiedliche Regionen, Gruppen und Dimensionen von Migration beleuchteten, verband sie ein gemeinsames Anliegen: Migration nicht essenzialistisch zu verengen, sondern sie als dynamische, vielfältige und kontextabhängige Erfahrung zu verstehen. Transition und temporality erwiesen sich dabei schon mal als vielversprechende Ansätze.
(Noah Serve)
Doppelbewegung mal anders
Es gibt in Duisburg also doch Vortragssäle, in die alle Zuhörer:innen nicht nur hineingelassen werden, sondern auch einen Sitzplatz finden. Im eingängig nummerierten LX1205 wartete auf die zahlreich einströmenden Soziolog:innen zur Mittagsstunde dann eine Überraschung: Am Vorabend noch namentlich begrüßt, blickte Dipesh Chakrabarty, statt vom Rednerpult, von der Leinwand auf seine Zuhörerschaft hinab. Die unerwartete Liveübertragung tat dem Interesse an seinen Worten aber keinen Abbruch. Der prominente Historiker hatte schließlich ankündigt, zum zentralen Begriff des Kongresses zu sprechen. Schnell machte er klar, dass der Begriff die Geschichte einer doppelten Transition erfassen müsse: Die tief ineinander verschränkten Prozesse von Globalisierung und Planetarisierung seien jeweils und gemeinsam fatal, aber allen Warnzeichen zum Trotz zu lange voneinander isoliert behandelt worden. Die Soziologie habe, so ließ sich die These Chakrabartys zuspitzen, diese beiden Transitionen stets aufeinander zu beziehen, wolle sie ihr Projekt einlösen und die planetar-globale Welt begreifen.
An erster Stellte widmete sich der in Chicago lehrende Sozialhistoriker also den globalen Prozessen der Dekolonialisierung, die mit den Unabhängigkeitsbestrebungen lateinamerikanischer Republiken einsetzten und mit dem Ende der Apartheid in Südafrika abschlossen. Chakrabarty perspektivierte diese Transition subaltern, indem er an Debatten in Indien und andernorts erinnerte, die um die Bewertung des Kolonialismus entbrannt waren: Hatte dieser nicht wichtige, universelle Ideen hinterlassen und darüber hinaus einen Anschluss an Modernisierungsprozesse ermöglicht, die nun – ergo in den 1950er- und 1960er-Jahren – die gesamte Menschheit erfassten? Die Anschlussfrage, wer nach dem Ende europäischer Herrschaft jene omnipräsent-evidenten Prozesse steuern und weiterführen solle, sei in der Praxis divers beantwortet worden. Alle planten und akzelerierten, ob dies aber im Dienst der Freiheit, lokaler Machteliten oder der Komintern geschah und ob demokratische Verfahren, Militärdiktaturen, Kulturevolution oder Parteiapparate solche Vorhaben durchsetzen, war relativ offen und wechselte sich wie die Blockzugehörigkeit mitunter ab.
Der Vortragende erinnerte dabei ebenso an den Ausspruch Frantz Fanons, dass die europäische Denktradition zwar alle Zutaten für menschliche Emanzipation bereitgestellt habe, sie aber nicht verwirklicht hätte, wie an Aimé Césaire Bemerkung, die Europäer hätten selbst in infrastruktureller Hinsicht nicht geliefert: Geeignete Eisenbahntrassen, Universitäten und Straßen müsse man schon selber bauen. Dass dies dann überall – wenn auch zeitversetzt – und immer intensiver geschah („Great Acceleration“), führte, so Chakrabarty, ins Anthropozän. Die tiefschürenden Implikationen dieses zweiten Übergangs seien ebenfalls vielfach beobachtet und diskutiert worden. Er erinnerte an die Berichte an den US-amerikanischen Präsidenten zum Status der Atmosphäre und zum Fallout atomarer Tests oder an die Bemerkung Hannah Arendts, Sputnik könne das Überleben der menschlichen Spezies bei gleichzeitiger Gefahr ihrer kosmischen Entfremdung sichern. Ihm zufolge hing die Entdeckung des Klimawandels eng mit der Frage nach einer möglichen Kolonialisierung des Mars zusammen.
Die Pointe von Chakrabartys Vortrag lag nun darin, dass insbesondere die Geschichtswissenschaft an der Jahrtausendschwelle den ersten Prozess zwar detailliert beschrieben, den zweiten aber ignoriert und den Erdwissenschaften überlassen habe. Ihr Fokus auf die Verläufe und Effekte von Globalisierung und Modernisierung habe das Interesse an der Planetarisierung geradezu blockiert, die vom Sprecher in vielen Details dargelegten ökologischen Folgen menschlicher Prosperität wären geradezu verdrängt worden. Die Geschichte sinkender Kindersterblichkeit, längerer Lebenserwartung und breiten Massenkonsums sei ebenso die (vergessene) Geschichte steigender Meeresspiegel, drastisch fallender Biodiversität und häufigerer Umweltkatastrophen.
Chakrabarty schloss seinen sprunghaften Vortrag mit der kurzweiligen Diskussion einer 11-Punkte-Charakteristik ab, anhand derer er das Globale vom Planetaren unterschied. Damit unterstrich er, dass die Interdependenzen und Effekte beider Transitionen ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Soziologie und Geschichtswissenschaft rücken müssten. Zwar illustrierte er die Punkte anregend – etwa anhand der gezielten Tötung von Kamelen durch Militärhubschrauber während australischer Buschfeuer, da diese mit Menschen um Wasser konkurrierten. Dem Vernehmen nach beschlich einige Zuhörer:innen jedoch der Verdacht, vieles bereits an anderer Stelle, in anderer Reihung und wohl auch besser strukturiert gehört zu haben. Was das Gesagte aber weder weniger wichtig, noch weniger interessant machte.
(Lars Döpking)
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: SPLITTER
Teil von Dossier
Duisburger Splitter
Vorheriger Artikel aus Dossier:
Duisburger Splitter I: Montag
Nächster Artikel aus Dossier:
Duisburger Splitter III: Mittwoch
Empfehlungen
Aaron Sahr, Felix Hempe, Hannah Schmidt-Ott
Göttinger Splitter I: Montag
Bericht von der Eröffnungsveranstaltung des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen
Berliner Splitter III - Der Podcast
Stimmen vom dritten Tag der Konferenz "Emanzipation" am Sonntag den 27. Mai 2018
Berliner Splitter I - Der Podcast
Stimmen vom ersten Tag der Konferenz "Emanzipation" am Freitag den 25. Mai 2018