Friedrich Lenger | Literaturessay | 11.11.2025
Tatorte in aller Welt
Literaturessay zu „Kapitalismus. Geschichte einer Weltrevolution“ von Sven Beckert
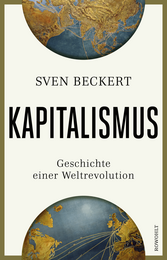
Sven Beckert ist sicherlich der hierzulande bekannteste Vertreter der in den USA seit gut zwei Jahrzehnten florierenden new history of capitalism. Am 11. November 2025 erscheint seine seit langer Zeit angekündigte Globalgeschichte des Kapitalismus in deutscher Übersetzung, auf die zwei Wochen später das englisch-amerikanische Original folgen soll. Wie geht Beckert das gewaltige Vorhaben an? Auf diese Frage geben Vorwort und Einleitung noch keine umfassenden Antworten.[1] Ersteres gibt vor allem Auskunft über die Motivation des Unterfangens, nämlich die „tiefe[] Frustration [...], dass so viele der Geschichten, die uns über den Kapitalismus dargeboten werden, unvollständig und manchmal schlichtweg falsch sind“ (S. 12). Ross und Reiter werden nicht genannt; stattdessen schließt sich das Versprechen an: „Um zu uns selbst zu finden, müssen wir eine Reise durch die tausendjährige Geschichte des Kapitalismus antreten.“ (ebd.) Obschon das Reiseprotokoll fast 1.300 Seiten umfasst, dürfte die angemahnte Vollständigkeit selbst hier ausgeschlossen sein. Wohin die Reise geht, macht die Einleitung dann aber mit einer Bestimmung des Untersuchungsgegenstands doch ein wenig klarer:
„Letztendlich lässt sich der Kapitalismus am besten als globaler Prozess definieren, in dem das Wirtschaftsleben hauptsächlich von der unaufhörlichen Anhäufung von privat kontrolliertem Kapital getragen und vom Staat strukturiert wird und seinerseits die ständig wachsende Kommodifizierung von Inputs und Outputs, einschließlich der Arbeit, vorantreibt, wodurch sich die Grenzen zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Systems ständig verschieben.“ (S. 36)
Dabei ist das Globale nicht Resultat einer allmählichen Ausdehnung, sondern Wesensmerkmal, war doch „der Kapitalismus immer und von Beginn an eine Weltwirtschaft“ (S. 26). Mit dem Begriff der Weltwirtschaft wird der von Beckert als für ihn zentral bezeichnete Einfluss aufgerufen: Fernand Braudel. Dieser hat den Terminus zwar nicht geprägt, ihn aber doch zur konzeptionellen Grundlage seiner Bände über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Frühen Neuzeit gemacht. Und ihm verdankt sich auch ein wichtiger Akzent des Beckert‘schen Werkes, nämlich die Hochschätzung des Handels. Eine Anmerkung ist aufschlussreich: „Vor mir betonte bereits Braudel die Bedeutung des Handels und der Kaufleute für die Geschichte des Kapitalismus, die Offenheit des historischen Prozesses und die Notwendigkeit, den Kapitalismus aus einer globalen Perspektive zu betrachten.“ (Anm. 49, S. 1073) Das ist zutreffend und irreführend zugleich; irreführend zum einen, weil so nicht deutlich wird, dass die Rolle des Handels schon vor Braudel Gegenstand intensiver Diskussionen war, und zum anderen, weil verschwiegen wird, dass nach Braudel und vor Beckert eine lange Reihe kleinerer und größerer Geister den Handelskapitalismus gleichfalls zentral gestellt hat – eine Reihe, die von Braudels Mitstreiter Immanuel Wallerstein bis zu den jüngeren Globalgeschichten des Kapitalismus von Pierre François und Claire Lemercier oder jener aus der Feder des Rezensenten reicht.[2] Letztere zitiert Beckert nicht, während Wallerstein immer wieder in den Fußnoten auftaucht, ohne dass eine Auseinandersetzung mit seinem Modell von Zentrum, Semiperipherien und Peripherien oder mit dem Konzept einer fortschreitenden Inkorporation in ein kapitalistisches Weltsystem stattfände.
Der Handel steht im Zentrum der ersten beiden Kapitel (S. 43 ff.), die so etwas wie eine breit angelegte Vorgeschichte bieten. Diese Vorgeschichte beginnt im frühen zweiten Jahrtausend, „weil sich […] damals der Handel intensivierte und die interkontinentalen Verbindungen stärker und dichter wurden“ (S. 53). Das zielt vor allem auf den Austausch zwischen Südasien und der arabischen Welt, den ja schon Janet Abu-Lughod als Fundament eines frühen, um 1300 hochentwickelten Weltsystems beschrieben hatte.[3] Für sie diente dessen Rekonstruktion primär der Kritik an Wallersteins Setzung eines europäischen Anfangs um 1500. Das wird von Beckert abgeblendet, dessen mit Hilfe von Quellenzitaten ungemein anschaulich gemachte Darstellung „Inseln des Kapitals“ in vielen Teilen der Welt vorfindet. Gleichwohl werden sowohl die Schlüsselrolle von Städten wie Kairo als auch die relative europäische Rückständigkeit deutlich; insbesondere wird der neueren Forschung folgend breit demonstriert, dass die selbst in jüngeren Darstellungen noch gern zu folgenreichen europäischen Innovationen hochstilisierten Handelsinstrumente wie Wechsel oder Kommenda oft genug Vorläufer oder Entsprechungen im arabischen wie asiatischen Raum hatten. Ob es sinnvoll ist – der Vollständigkeit halber? – auch aztekische Kaufmannsgemeinschaften in die Beschreibung einzubeziehen, sei dahingestellt. Wichtig ist dem Autor jedenfalls, die Grenzen der Entwicklung während der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends zu betonen, auch wenn seine Metaphorik das gelegentlich verwischt. Da können „dünne Rinnsale aus Kapital und Waren“ schon mal „zu großen Nebenflüssen“ anschwellen, ohne dass sich mehr als „kleine Tropfen im Meer des Wirtschaftslebens“ bilden (S. 84 und S. 96). Verantwortlich dafür war der Widerstand von Bauern und Handwerkern gegen die Logik des Marktes, der dafür sorgte, dass die detailliert porträtierten Kaufleute „Kapitalisten ohne Kapitalismus“ blieben. „Sie brauchten Verbündete, um die Grenzen zu durchbrechen, die sie einschlossen. Und der mit Abstand machtvollste Verbündete war der Staat.“ (S. 111)
Dementsprechend spielt der Staat eine wichtige Rolle im ersten, bis an den Vorabend der Industriellen Revolution reichenden Teil des Buches, ja er ist „die entscheidende Institution in der Geschichte des Kapitalismus“ (S. 151). Aber, das macht die Darstellung eher implizit klar, es ist nicht der Staat an sich, sondern es sind die frühneuzeitlichen Staaten Westeuropas mit ihren nicht zuletzt kriegsbedingten Finanznöten, die eine Schlüsselrolle spielen:
„Europa verdankte seine Entwicklung vielmehr einer Reihe staatlich geförderter und sich wechselseitig verstärkender Verbindungen zwischen den Kapitalinseln und dem oft gewaltsam vollzogenen Transfer von Ressourcen, zu denen auch versklavte Menschen zählten, aus vielen Teilen der Welt.“ (S. 133)
Die Voraussetzungen und Folgen des europäischen Kolonialismus werden indessen weniger streng vergleichend entwickelt, als vielmehr bildreich beschrieben: Immer neue Kapitalinseln entstehen, bilden längst einen Archipel und: „Der Archipel des Kapitals metastasierte während des gesamten langen 16. Jahrhunderts, eine Insel nach der anderen kam hinzu ...“ (ebd.) Vergleiche, das gilt es präzisierend hinzuzufügen, gibt es durchaus, aber sie dienen nur selten der Erklärung unterschiedlicher Entwicklungswege oder gar der Ausarbeitung von Typologien. Sehr viel häufiger folgen sie der Logik des „ebenfalls“: „Im Osten nahmen die japanischen Kaufleute ebenfalls am Wirtschaftswachstum teil. [...] Auch die afrikanischen Kaufleute intensivierten ihren Handel.“ (S. 121/122) Das führt gelegentlich zu Inkonsistenzen, etwa wenn auf die für die Zeit um 1700 getätigte Aussage – „China war möglicherweise stärker kommerzialisiert als jedes andere Land der Welt.“ – zehn Seiten später das zustimmend angeführte Marx-Zitat folgt, demzufolge die Niederländische Republik „die kapitalistische Musternation des 17. Jahrhunderts“ gewesen sei (S. 121/131). Jenseits solcher Widersprüche gilt, dass Beckert, wenn er überhaupt vergleicht, den „lumpers“ zuzurechnen ist, die den Ähnlichkeiten ihrer Vergleichsfälle ungleich mehr Bedeutung beimessen als den von den „splittists“ betonten Unterschieden. Anders als auf dem Gebiet der biologischen Taxonomie, wo diese Begriffe schon vor Darwin geprägt wurden, geht im Bereich der historischen Sozialwissenschaften mit der Vorliebe für die eine oder die andere Form des Vergleichs aber meist zugleich das Interesse oder Desinteresse an kausalen Erklärungen einher. Es wird also weniger erklärt als erzählt. Und Beckert erzählt reich illustriert zunächst die Geschichte der sogenannten europäischen Expansion, aber auch jene des Auf- und Ausbaus von Institutionen wie der Ostindien-Kompanien, der Börse oder der bürgerlichen Familie, die für die Expansion wichtig waren. Die bekannte Gewaltsamkeit dieses Gesamtprozesses wird angemessen hervorgehoben und rechtfertigt aus der Sicht des Autors einen eigenen, von ihm schon in seiner Geschichte der Baumwolle eingeführten Epochenbegriff:[4]
„Der Kriegskapitalismus beruhte auf einer spezifischen Struktur staatlicher Macht. Er war [...] errichtet auf imperialer Expansion und bewaffnetem Handel, auf der Gewaltherrschaft über Arbeitskräfte und einer gewaltigen Enteignung kollektiver Ressourcen.“ (S. 172)
Das kann in der Sache nicht strittig sein, wirft aber die Frage auf, ob die durch die Begriffsbildung implizierte Friedfertigkeit des späteren Kapitalismus eine adäquate Diagnose darstellt.
Ein weiteres Charakteristikum des Kriegskapitalismus besteht für Beckert darin, dass er „etwas Unwahrscheinliches ermöglichte: Wirtschaftswachstum ohne einen bedeutenden technischen Wandel oder eine Steigerung der Produktivität“ (S. 172). Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, sich zunächst der Landwirtschaft zuzuwenden, dem weltweit mit Abstand wichtigsten Wirtschaftssektor. Das einschlägige Kapitel 4 (S. 183 ff.) eröffnet, wie die meisten anderen auch, eine mikrohistorische Fallstudie – eine überzeugende darstellerische Strategie, die sich durchweg bewährt. In diesem Fall stellt der Autor die Londoner Kaufmannsbrüder Noell ins Zentrum, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Zuckerplantagen auf Barbados investierten. Ihr Beispiel stellt indessen sowohl den Begriff des Kriegskapitalismus als auch die These von einem Wachstum ohne Produktivitätssteigerung in Frage. Denn zum einen steht der benutzte Begriff der „Kriegsunternehmer“ quer zu der Beschreibung der Insel als „unbesiedelt und aufgrund seiner Lage sicher vor äußeren Bedrohungen“ (S. 185/186). Hier war also weder etwas kriegerisch zu erobern noch zu verteidigen und die im Begriff der Plantagensklaverei implizierte extreme Gewaltsamkeit der Sklavenarbeit bedarf keines neuen Namens. Zum anderen hatte schon die klassische Studie von Sidney Mintz die auch auf den Einsatz von Maschinen zurückzuführenden Produktivitätssprünge in der karibischen Zuckerproduktion eindrücklich vorgeführt (die später im Buch auch durchaus deutlich gemacht werden).[5] Wie dem auch sei! Beckert ordnet die karibische Zuckerproduktion jedenfalls ein in den sich „zusehends entwickelnde[n] Transfer des städtischen Kapitals in ländliche Gebiete“, den er auch für den toskanischen Olivenanbau, die ostafrikanische Weizen- oder die chinesische Teeproduktion konstatiert (S. 191). Diese und zahllose weitere Beispiele sollen die folgende These belegen: „Die Händler wurden zur revolutionären Avantgarde des Kapitalismus.“ (S. 187) Dass sie dies vor allem bei Investitionen „in die ländlichen Gebiete Amerikas“ wurden, macht die Darstellung durchaus deutlich, verzichtet aber auf die naheliegende Frage, ob und inwiefern die Plantagensklaverei und die Möglichkeit zur häufig gewaltsamen Aneignung riesiger Landflächen Besonderheiten darstellen, die sich gegen die Einordnung „als eine weitere Form des Übergangs zum Agrarkapitalismus“ sperren (S. 198, 202). Das gilt auch mit Blick auf Widerstandsbewegungen, die der Autor in seine thematisch breit angelegte Kapitalismusgeschichte immer wieder einbezieht und bei deren Beschreibung er Bauernproteste und Sklavenaufstände ungeachtet ihrer unterschiedlichen materiellen und kulturellen Voraussetzungen nebeneinanderstellt.
Das Folgekapitel (Kapitel 5, S. 247 ff.) behandelt die „Intensivierung der industriellen Produktion“, zunächst im ländlichen Raum. Denn im Zentrum steht die sogenannte Protoindustrie, für die einmal mehr gilt: „Weit voneinander entfernte Orte wiesen erstaunliche Ähnlichkeiten auf.“ (S. 265) Diese Feststellung übergeht die unter anderem von Jan de Vries und Kenneth Pomeranz kontrovers diskutierte Frage, ob die in der intensivierten heimgewerblichen Tätigkeit zum Ausdruck kommende industrious revolution (Akira Hayami) in Nordwesteuropa und Ostasien denselben Charakter hatte. Genauso vernachlässigt Beckert die Überlegungen, die Jean-Laurent Rosenthal und Roy Bin Wong zu den langfristigen Wirkungen einer in Europa stärkeren Konzentration der gewerblichen Produktion in Städten angestellt haben.[6] Noch frappierender als die (Über-)Betonung weltweiter Ähnlichkeiten scheint für eine Globalgeschichte die Abblendung globaler Zusammenhänge. Dass die von den Leinenwebern Mitteleuropas produzierten Stoffe für die Arbeitskleidung der in die Neue Welt verschleppten Afrikaner:innen benötigt wurden, macht Beckert noch deutlich (S. 283 ff.). Die völlig zu Recht herausgestellte „Quantität und Qualität der indischen Textilproduktion“ erscheint dagegen seltsam losgelöst von der direkten wie vermittelten Nachfrage in Europa, wo indische Baumwollstoffe sowohl für den Konsum vor Ort als auch als zentrales Tauschmittel für den Sklavenhandel an der afrikanischen Westküste heiß begehrt waren (S. 259). Das ändert sich erst im sechsten Kapitel (S. 282 ff.), das den ersten Teil des umfangreichen Buches beschließt. Denn der die Überschrift liefernde „perfekte Sturm“ hat seinen Ursprung im nordwesteuropäischen Raum, dessen Wirtschaft „eng mit dem transatlantischen Sklavenkomplex“ verbunden war (S. 300). Das zwingt zur Qualifizierung zuvor getroffener Aussagen. So erscheint die „Transformation der ländlichen Gebiete außerhalb der ausgebeuteten Territorien der Sklaverei“ nun „eher schrittweise“ (S. 295). Aber insgesamt wird die Dynamik des atlantischen Dreieckshandels gut ersichtlich, in dem von der Plantagensklaverei starke Nachfrageimpulse für gewerbliche Güter aus Nordwesteuropa ausgingen – sowohl direkte (wie im Falle der für die Zuckerproduktion unerlässlichen Kessel aus Kupfer) als auch indirekte (wie bei den für die Bezahlung der verschleppten Afrikaner:innen benötigten Waffen oder „indischen“ Baumwollstoffen). „Die Baumwollproduktion war das Auge im Sturm der Industrialisierung – sie war der große Sprung nach vorn.“ (S. 315) Von daher kommt dem 6. Kapitel eine Scharnierfunktion zum zweiten Teil des Buches zu, der zunächst den Aufstieg des Industriekapitalismus beschreibt: „Der mäandernde Fluss wurde plötzlich zu einem reißenden Strom.“ (S. 323)
Im Anschluss an Joseph Inikori und andere beschreibt Beckert die Industrielle Revolution im Kern als Importsubstitution, deren technologischer Kern die Maschinisierung der Baumwollgarnproduktion war. Anderenorts ist klarer herausgearbeitet, dass diese nur vor dem Hintergrund britischer Protektionspolitik zugunsten der Wolltuchherstellung zu verstehen ist und hinsichtlich ihres dauerhaften Erfolgs an die explosionsartige Ausweitung des Baumwollanbaus gebunden war, die ihrerseits die schier unbegrenzte Verfügbarkeit von verschleppten Afrikaner:innen einerseits und die gen Westen grenzenlos scheinende Ausweitung der Anbauflächen im amerikanischen Süden zur Voraussetzung hatte.[7] Aber insgesamt schildert der Autor den Aufstieg der britischen Baumwollproduktion ebenso schlüssig wie das Ineinandergreifen der Entwicklung anderer Industriezweige zunächst im Vereinigten Königreich und dann auch, gleichfalls staatlicherseits unterstützt, in anderen Teilen Europas sowie die Ansätze zu einer solchen Entwicklung von Ägypten bis Mexiko. Zusammenfassend identifiziert Beckert die Fertigung in Fabriken, die Durchsetzung der Lohnarbeit und die zunehmende Nutzung fossiler Brennstoffe als Grundvoraussetzungen zuvor ungekannter Produktivitätszuwächse. Zu den Folgeschäden dieser Entwicklung zählt er mit guten Gründen nicht nur die unmittelbaren Umweltbelastungen, die vor allem aus der Kohlenutzung resultierten, sondern die oft genug gewaltsame Aneignung von Land, für dessen Produkte eine ganz neue Nachfrage bestand. So sei den indigenen Völkern „im Zuge der industriellen Revolution mehr Land als in den drei Jahrhunderten vor 1800 zusammen“ genommen worden (S. 382). Die Vereinigten Staaten gelten Beckert als Musterbeispiel und zugleich, gemeinsam mit Brasilien und Kuba, als Beleg für die anhaltende Expansion der Sklavenarbeit: „1860 waren es bereits nahezu sechs Millionen Versklavte, die in diesen drei Ländern etwa die Hälfte des weltweiten Kaffees, drei Viertel der weltweiten Baumwolle und ein Drittel des weltweiten Zuckers produzierten.“ (ebd.) Das war, wie der Verweis auf den Einsatz kapitalintensiver Technik in der Zuckerproduktion oder auf die Anlage von Eisenbahnlinien zur Erschließung immer größerer Flächen deutlich macht, kein bloßer Atavismus. Andererseits stand die Sklaverei etwa in der Reis- und Indigoproduktion zunehmend neben anderen Formen unfreier Arbeit wie der Vertragsknechtschaft oder der Teilpacht und Lohnarbeit. Pacht- und Familienwirtschaft fanden etwa beim kommerziellen Getreideanbau gleichfalls Verbreitung. Dagegen blendet Beckert jene Weltregionen aus, die mit sehr wenig Arbeitskräften – und sehr verschiedenen Strukturen des Landbesitzes – Exportlandwirtschaft in der Form der Weidewirtschaft betrieben, beispielsweise Argentinien, Australien oder Neuseeland.
Dass die zuletzt angesprochene „Eroberung des Hinterlandes“ gegenüber dem „Aufstieg des Industriekapitalismus“ zeitlich leicht versetzt erfolgte, leuchtet ein, ohne dass es hier für die chronologischen Grenzen der Kapitel eindeutige Kriterien geben könnte. Für die Jahrzehnte um die Mitte des 19. Jahrhunderts konstatiert der Autor „Eine kapitalistische Zivilisation“ und macht schon mit der Kapitelüberschrift deutlich, wie umfassend er seine Kapitalismusgeschichte angelegt hat. Im Zentrum dieser Zivilisation steht zunächst und vor allem die „bürgerliche Kultur“, die Beckert zufolge „planetare Ausmaße“ annahm (S. 464). Die zum Beleg dieser Aussage angeführten Fallbeispiele nähren indessen erneut den Verdacht einer übermäßigen Homogenisierung. Der in Kalkutta tätige Importeur John Palmer etwa pflegte (auch geschäftliche) Kontakte zu bengalischen Kaufleuten und integrierte lokale Einrichtungs- und Ernährungsstile partiell in seinen Alltag wie umgekehrt die „bengalische Elite [...] sich mit Insignien der europäischen bürgerlichen Kultur“ schmückte. Aber verlor darüber das Faktum an Bedeutung, dass Palmer eben auch Repräsentant der britischen Kolonialmacht war? Beckert scheint das so zu sehen, denn er schließt an: „Tausende solcher Geschichten könnte man über Kapitaleigner in der ganzen Welt erzählen.“ (S. 464) Die nächste dieser Geschichten, die er etwas ausführlicher vorstellt, ist die von Heinrich Witt, einem in Altona geborenen Kaufmann, Familienvater und regelmäßigem Operngänger, der regen Anteil am gesellschaftlichen Leben in Lima nahm. Rechtfertigt das den Schluss: „Auch in Lima folgte das bürgerliche Leben grundsätzlich den Sitten und Gebräuchen dieser Klasse in anderen Teilen der Welt“? (S. 465) – Nun sieht der Autor die kapitalistische Zivilisation nicht allein vom Bürgertum, sondern auch von der Arbeiterklasse bestimmt an. Allerdings scheint sich der Beitrag des Proletariats in der Funktion einer Projektionsfläche für bürgerliche Ängste zu erschöpfen. Jedenfalls beschränkt sich Beckerts Darstellung hier weitgehend auf Manchester ins Zentrum rückende Schreckensbilder aus bürgerlichen Federn (S. 472 f.). So lässt sie sich auch besser verbinden mit der darauffolgenden Behandlung prominenter Kapitalismuskritiker von Robert Owen bis Karl Marx, an die sich ein Durchgang durch die Thematisierung des Kapitalismus in der Wirtschaftswissenschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts anschließt.
Dem Widerstand gegen den Kapitalismus des (mittleren) 19. Jahrhunderts ist anschließend ein eigenes Kapitel (Kapitel 10, S. 501 ff.) gewidmet, das „einer globalen Perspektive“ das Verdienst zuspricht, „die Verbindungslinien deutlicher“ zu machen; oder wie es bildreich heißt: „Diese Revolten, die oft von den marginalisiertesten Menschen der Welt getragen wurden, speisten sich gegenseitig, sodass ein Feuer das nächste entzündete.“ (S. 504) Würde das nicht die wechselseitige Kenntnis der Aufständischen voneinander voraussetzen? Belegt wird sie nicht, aber ist sie wenigstens wahrscheinlich? Für die drei dem letzten Zitat vorangehenden Beispiele scheinen Zweifel erlaubt: Wussten die 1844 in Schlesien rebellierenden Weber vom kubanischen Sklavenaufstand des Vorjahres und konnten die wenig später auf Java revoltierenden Bauern auf die Erfahrungen der einen wie der anderen zurückgreifen? Derlei Nachfragen sollen weder den Reiz eines breit angelegten, wahrhaft globalen Panoramas von populären Aufständen im 19. Jahrhundert bestreiten, noch deren allgemeine Rückführung auf das zuvor geschilderte Vordringen des Kapitalismus in Zweifel ziehen. Aber eine grundlegende Unterscheidung zwischen Konstellationen, bei denen es zuvörderst um die persönliche Freiheit versklavter Menschen ging, solchen, bei denen wie in Indien eine Kolonialmacht im Spiel ist, die hilft, bäuerliche Produzenten zum Indigoanbau zu zwingen, oder einer, in der sich formal freie Heimarbeiter gegen Fabrikanten auflehnen, hätte die Orientierung und das Verständnis der „Dynamik der Aufstände“ sicherlich erleichtert (S. 519). Aufständisch sind Beckerts Ansicht nach aber auch so manche Kapitalbesitzer. Dass der Begriff keine sonderlich präzise Beschreibung der sozialen Trägergruppen liberaler, demokratischer oder nationaler Bewegungen des frühen 19. Jahrhunderts oder gar der sozialen Basis der europäischen Revolutionen von 1848 ist, liegt auf der Hand. Letztere sind Heinrich Witt in Lima Einträge in sein Tagebuch wert (S. 546 f.), womit – zusammen mit dem Verweis auf den irgendwie bürgerlichen Charakter der Meiji-Restauration (S. 671 ff.) – wohl die globale Dimension eingeholt werden soll. Den Ertrag dieses gegen Ende doch recht holprigen Kapitels fasst Beckert in der in späteren Teilen der Darstellung wiederkehrenden Denkfigur, der Kapitalismus sei „nicht weniger das Produkt von Aufständen wie das Produkt der Logik des Kapitals selbst“ (S. 551), zusammen.
Neben der Krise von 1873, deren globalen Charakter man zurückhaltender als Sven Beckert einschätzen kann, war es also der allgegenwärtige Widerstand gegen die kapitalistische Entwicklung, der eine Neuordnung erzwang. Selbst wenn man diese Auffassung nicht teilt, spricht vieles für eine Zäsur um 1870; die zu diesem Zeitpunkt beginnende Epoche ein ganzes Jahrhundert andauern zu lassen, ist schon problematischer, auch wenn die Begründung, dies sei die Zeit nordatlantischer Hegemonie, unbedingt zutrifft. Der Autor gesteht das implizit ein, indem er den dritten, mit „Globale Neuordnung“ überschriebenen Teil seines Buches (S. 555 ff.) mehrfach chronologisch untergliedert. So behandeln die ersten drei Kapitel dieses Abschnitts die fünf Jahrzehnte bis etwa 1920 und innerhalb dieses Rahmens die drei Hauptprotagonisten des Geschehens: Kapital, Arbeit und Staat. In das Kapitel 11 (S. 555 ff.) zum Kapital führt eine lesenswerte Skizze zu Carl Röchling und der von ihm erworbenen Völklinger Hütte ein – ein Musterbeispiel für die vertikal wie horizontal hochgradig integrierte und ungemein kapitalintensive Großindustrie der Zeit. Der Stahlindustrie werden andere zentrale Industriezweige wie die Ölindustrie sowie und vor allem die chemische und Elektroindustrie als wichtigste Vertreter der wissenschaftlichen Industrien zur Seite gestellt und hinsichtlich wichtiger Gemeinsamkeiten wie schierer Größe und Kapitalintensität, Monopolorientierung und (Finanz-)Planung beschrieben. Die für die Charakterisierung der Gesamtepoche als globaler Neuordnung wichtigste Aussage aber lautet:
„Die wirtschaftlichen und politischen Hierarchien zwischen dem sogenannten Kern und der sogenannten Peripherie hatten sich auf eine Weise verschärft, die ein Jahrhundert zuvor noch unvorstellbar gewesen wäre.“ (S. 593)
Was bedeutete das für den zweiten Hauptplayer, die Arbeit? Hier konstatiert Beckert weit weniger Homogenität als in Bezug auf die nordatlantische Großindustrie und präsentiert „eine Vielzahl ganz verschiedener Arbeitsregime“ (S. 598). Ihr Porträt beginnt der Autor mit den mannigfaltigen Versuchen von Plantagenbesitzern auf La Réunion und anderswo, die ehemaligen Sklaven an ihre Arbeitsorte und Arbeitgeber zu fesseln oder durch Vertragsknechte zu ersetzen. Beckerts auf Arbeiter in Assam gemünztes Resümee – „Das neue Regime war eine düstere Mischung aus Sklaverei und Lohnarbeit“ – hat über die dortigen Teeplantagen hinaus Gültigkeit (S. 614). Mittel der Wahl, ein hohes Maß an Abhängigkeit von Arbeitskräften zu garantieren, war oft die Verschuldung, aber auch Formen offener Zwangsarbeit blieben wie im belgischen Kongo oder beim Einsatz von Strafgefangenen im japanischen Bergbau erhalten. Zunächst auf unfreie Arbeit in der Peripherie zu schauen, hilft zu vermeiden, die europäisch-nordamerikanische Industriearbeit des späten 19. Jahrhunderts unterschwellig zum Normalfall werden zu lassen. Ob dagegen Beckerts nachstehend zitierte Verklammerung beider Arbeitswelten tragfähig ist, scheint weniger klar: „Die Neuordnung der Arbeit, die in den ländlichen Gebieten der Welt so deutlich zu beobachten war, griff auf die Industrie über, wobei beide Bereiche einander beeinflussten und befruchteten.“ (S. 640) Brauchten aber Unternehmer wie Andrew Carnegie oder Carl Ferdinand von Stumm-Halberg für ihren gewerkschaftsfeindlichen Herr-im-Hause-Standpunkt Plantagenbetreiber als Vorbilder? Und hatten die Werkswohnungen, die viele der größten Industrieunternehmen Nordwesteuropas ihren Beschäftigten anboten, wirklich ein Gegenstück „in den ländlichen Gebieten der Welt“? War William Levers Mustersiedlung Port Sunlight nicht vielleicht eher aus Profiten finanziert, die das Unternehmen den Arbeitern auf seinen riesigen Palmöl-Plantagen im belgischen Kongo abpresste?[8] Hier scheint die Rede von wechselseitiger Beeinflussung und Befruchtung wenig hilfreich. Eher schon dürfte Entsprechendes für die Organisationen und Kampfformen der Arbeiterschaft gegolten haben, wie ein abschließender Überblick über Streiks in Europa, Lateinamerika oder dem Osmanischen Reich nahelegt (S. 651–658).
Die Aufgabe des Staates in dem halben Jahrhundert nach 1870 benennt Beckert mit der Kapitelüberschrift „Einhegungen“ (Kapitel 13, S. 667 ff.). Gemeint ist die Erschließung immer weiter gespannter Landmassen durch die führenden Staaten des Industriekapitalismus. Als erstes Beispiel dient dem Autor die Integration und infrastrukturelle Entwicklung Hokkaidos – dem „Übungsgelände für den japanischen Kolonialismus“ (S. 670). Die ‚Übungen‘ wurden auf Kosten der indigenen Bevölkerung durchgeführt, deren Umsiedlung in Reservate hier wie in späteren Fällen dem amerikanischen Vorbild folgte. Die USA liefern mit ihrer Westexpansion das zweite und insofern wichtigste Beispiel, als die dadurch entstehende Rohstoffautarkie des riesigen Imperiums von den Kapitaleignern der europäischen Staaten als Vorbild und Bedrohung gleichermaßen wahrgenommen wurde (S. 677 ff.). Der vor allem den afrikanischen Kontinent ins Visier nehmende europäische Imperialismus war gleichsam die Antwort darauf und bildet das dritte Beispiel (S. 682 ff.). „Eine weitere folgerichtige Entwicklung begleitete die Einhegungen von Land, Arbeit, Kapital und Staatsmacht – die Einhegung der Vorstellungen zum Wirtschaftsleben.“ (S. 708) Die Tragfähigkeit dieses über die Mehrdeutigkeit des Begriffs der „Einhegung“ vorgenommenen Brückenschlags dürfte indessen begrenzt sein. Hier geht es schließlich nicht um die Einhegung und Einzäunung von territorial gebundenen Wirtschaftsressourcen, sondern um die Ausgrenzung aller Faktoren jenseits der allwissenden Marktakteure der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Die entsprechenden Ausführungen bleiben daher ein Fremdkörper, von dem es auch keine direkte Überleitung zum Ersten Weltkrieg gibt. „Der Krieg radikalisierte das Projekt der Einhegungen, indem er sich sämtlicher produktiver Fähigkeiten des restrukturierten Kapitals, der Arbeit und des Staates bediente.“ (S. 715 f.) Beckert beschreibt diese Radikalisierung aber nur auf der Ebene der imperialistischen Visionen und Kriegsziele konkreter, die Umstellung des Vorkriegskapitalismus auf Kriegswirtschaft lässt er hingegen außen vor.
Das ist bedauerlich, weil so zum einen die relative Wirkmächtigkeit von Krieg und Kapitalismus für die breit dargestellten weltweiten „Wellen von miteinander zusammenhängenden Aufständen“ gegen „das Imperium des Kapitals“ in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht gegeneinander abgewogen werden kann, als deren Höhepunkt die Russische Revolution erscheint. Zum anderen werden Korporatismus und expansive (Sozial-)Staatlichkeit als Charakteristika der Zwischenkriegszeit von ihren Ursprüngen im Ersten Weltkrieg abgeschnitten (S. 728). Und da im Falle des Zweiten Weltkriegs zwar der Einsatz von Zwangsarbeitern in deutschen und japanischen Großunternehmen deutlich herausgestellt wird, die Kriegswirtschaft ansonsten aber kaum in den Blick genommen wird, lässt sich nicht erkennen, welch immense Akkumulationschancen sich „Kriegsunternehmern“ (Tim Schanetzky) wie Friedrich Flick oder Henry Kaiser in der deutschen beziehungsweise amerikanischen Rüstungsindustrie, aber im Falle der USA auch schon bei Infrastrukturprojekten zuvor darboten. Ohnehin kommen Unternehmer in diesem Teil des Beckert‘schen Buches kaum vor; Henry Ford und Giovanni Agnelli sind als Repräsentanten des Fordismus der Zeit fast schon Einzelfälle. Weit mehr Raum nehmen Protestbewegungen einerseits und die umfassend in den Blick genommene Durchsetzung autoritärer Regime – von Portugal bis Brasilien, in Italien, Deutschland und Japan – andererseits in Anspruch, wodurch Fragen der Kapitalverwertung von der allgemeinen Politikgeschichte an den Rand gedrängt werden.
Die beiden Kapitel zum Vierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkriegs (Kapitel 15 und 16, S. 799 ff.) behandeln die etablierten Industriestaaten und den Rest der Welt weitgehend getrennt. Dabei sind die zunächst vorgestellten „Rebellen“ nicht mehr die Protestbewegungen der Zwischenkriegszeit, sondern die Verfechter der Dekolonisation. Der Verfasser leitet das entsprechende Kapitel mit einem Kurzporträt Naval Godrejs ein, dessen Name sich im unabhängig gewordenen Indien untrennbar mit der von seinem Unternehmen produzierten Schreibmaschine verband. Wenn für Beckert dieses Produkt „Indiens Eintritt in den Markt für komplexe Maschinen“ ankündigte und damit eine Entwicklung, „die schließlich dazu führte, dass Indien Raketen ins All schoss, dass China zur Werkbank der Welt wurde und Brasilien zu einem führenden Flugzeughersteller aufstieg“ (S. 802), dann ist damit der mittel- und langfristige Stellenwert des Themas klar markiert. Kurzfristig galt es erhebliche Probleme zu überwinden, wie die Einschätzung des führenden indischen Unternehmenshistorikers unterstreicht, der die Godrej-Schreibmaschine zu den Produkten zählt, die ohne die rigorose Schutzzollpolitik der indischen Regierung wohl gar nicht überlebt hätten.[9] Das war ein generelles Problem des Entwicklungsprogramms einer importsubstituierenden Industrialisierung, das Beckert mit großer Sympathie behandelt – eine Sympathie, die mehr als verständlich ist, sieht er in der industriellen Entwicklung der Länder des globalen Südens doch den „Grundstein für eine radikale Neuzentrierung der Weltwirtschaft“ (S. 854). Entsprechende Anläufe behandelt er für Lateinamerika, wo sie eine längere Vorgeschichte hatten, für einige afrikanische Staaten und insbesondere für Indien und andere asiatische Länder. Allerdings bleibt dabei ein wichtiger Machtfaktor unberücksichtigt. Denn während der Autor die Abhängigkeit der Kapitaleigner in den dekolonisierten Ländern von politischen Koalitionen mit anderen Befürwortern nationaler Unabhängigkeit sensibel auslotet, bleibt die wichtige und zeitlich bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Tätigkeit multinationaler Konzerne vor Ort unterbelichtet. Es ist aber für mehr als ein Land und für mehr als eine Branche gezeigt worden, dass diese sich zwar vor Ort notgedrungen der ein oder anderen regulatorischen Vorgabe des Gastlandes fügten, in aller Regel aber ihren technologischen Vorsprung zäh und unter Ausnutzung aller patentrechtlichen Möglichkeiten verteidigten.[10] Die unter anderem von Südafrika während der COVID-Pandemie laut vorgetragene Forderung, die in Europa und den USA entwickelten Impfstoffe zugänglich zu machen, hat das in Erinnerung gerufen. Die angestrebte Neue Internationale Wirtschaftsordnung kam nicht zustande und dazu trugen neben der Interessenpolitik wichtiger Industrienationen die wenig berücksichtigten internationalen Institutionen wie Weltbank und IWF indirekt bei, die mit ihrer Kreditvergabe den Spielraum einzelstaatlicher Entwicklungsprogramme massiv beeinflussten.
Der Zentralität des Staates für die Entwicklungsprogramme im Globalen Süden entsprach in den etablierten Industriestaaten seine Rolle beim Ausbau des Sozialstaats und beim Einzug der expertengestützten Wirtschaftssteuerung (mit deutlich gestiegener Staatsquote). Vor dem Hintergrund konstant hoher Wachstumsraten in den 1950er- und 1960er-Jahren näherten sich große Teile Europas sowie Japan an das ohnehin schon sehr hohe nordamerikanische Konsumniveau an. Beckert führt zu Recht kräftige Produktivitätszuwächse als Voraussetzung hierfür an, konstatiert dann aber etwas überraschend: „Die Schlüsselindustrien des Goldenen Zeitalters waren immer noch fast die gleichen wie die bei der Umgestaltung des Kapitalismus in den 1870er Jahren entstandenen: Kohle, Stahl, Chemie, Maschinen und Metallwaren.“ (S. 874) Das unterschätzt die Expansion des Automobilbaus, den Aufstieg der Unterhaltungselektronik und anderer Zweige der Konsumgüterindustrie. Da scheint es bezeichnend, dass der Autor die Verbindung zwischen gestiegenen Konsummöglichkeiten und industrieller Entwicklung primär über die Tourismusindustrie herstellt und deren Kunden mit „Fließbandarbeitern“ vergleicht (S. 906). Insgesamt konstatiert er:
„Die neue Wirtschaftsordnung war eine ‚gemischte Wirtschaft‘, in der das private Unternehmertum und mit ihm der Kapitalismus erhalten blieb, aber durch starke Regulierung, eine Erweiterung von Zuständigkeiten und Umfang der staatlichen Macht im Zaum gehalten wurde.“ (S. 886) Dass die so vorgenommene „Zähmung des Industriekapitalismus“ durchaus im Interesse von Teilen der Unternehmerschaft war, deutet Beckert allenfalls an. Die Frage, ob die langfristige Investition von immensen Kapitalbeträgen in riesige Produktionsanlagen nicht ein eher partnerschaftliches Verhältnis zu einer organisierten und disziplinierten Arbeiterschaft nahelegte, stellt der Autor nicht. Ohnehin ist „von der unaufhörlichen Anhäufung von privat kontrolliertem Kapital“ (S. 36) kaum noch die Rede. Kapitalisierung als wirkmächtiger Faktor wird ersetzt durch die Interessengruppe der Kapitaleigner als zentrale Partei im Gefüge korporatistischer Staatlichkeit. Wenn dergestalt Kapitalismusgeschichte zur Politikgeschichte wird, spiegelt das zwar einerseits den unbestreitbaren Bedeutungszuwachs des Staates wider, hat aber andererseits mindestens zwei zentrale Nachteile: Handels-, Industrie- und Finanzkapital werden, erstens, zu konturlosen Schatten, die mit dem Gesamtgeschehen nur noch lose verbunden sind; zugleich wird, zweitens, die Darstellung unter der Hand immer mehr zu einer Summe einzelstaatlicher Geschichten, die globale Verbindungen an den Rand rückt. Gerade dieser zweite Nachteil wiegt bei einer Globalgeschichte sehr viel schwerer als beispielsweise bei Jonathan Levys aus kapitalismushistorischer Perspektive erzählter Geschichte der USA.[11]
Die bereits angesprochene Entökonomisierung der Darstellung wird auch bei der Schilderung des Übergangs zu einem neoliberalen Zeitalter sichtbar, die es verdient, ausführlicher zitiert zu werden:
„Das so geschmiedete Bündnis zwischen Großunternehmern und Intellektuellen unternahm schließlich einen Frontalangriff auf den Kapitalismus des Goldenen Zeitalters. So machtvoll diese Angriffe der Elite auch waren, sie wären vermutlich gescheitert, wenn sie sich nicht mit anderen Rebellionen überschnitten hätten, die eine breitere soziale Basis hatten. Diese Rebellionen richteten sich gegen drei zentrale Merkmale des Goldenen Zeitalters: die geschlechtsbezogene Arbeitsteilung, nationale und globale rassistische Hierarchien und die ökologischen Auswirkungen des Industriekapitalismus.“ (S. 928 f.)
Nun leugnet Beckert keineswegs die Bedeutung anderer Kontexte wie den massiven Anstieg der Ölpreise oder das Ende des in Bretton Woods vereinbarten globalen Währungssystems für den in den frühen 1970er-Jahren beginnenden Umbruch. Aber da die konkreten Interessen der „Großunternehmer“ undeutlich bleiben, wird den „Intellektuellen“, also Hayek und Co., erstaunliche Wirkungsmacht zugeschrieben. Wie deren politischer Einfluss von der „breitere[n] soziale[n] Basis“ der genannten Bewegungen entscheidend gestützt wurde, erläutert Beckert nicht. Selbstverständlich behauptet der Autor keineswegs eine Übereinstimmung der Positionen, aber wie partielle Übereinstimmungen wie im Falle eines progressiven Neoliberalismus, „der ‚Diversität‘, Meritokratie und ‚Emanzipation‘ feiert“, die behauptete Wirkungskraft hätten entfalten sollen, bleibt unbestimmt.[12] Als Einstieg in das eine umfangreiche Kapitel (Kapitel 17, S. 939 ff.) über „ein neoliberales Zeitalter“ wählt Beckert die chilenischen Wirtschaftsreformen im Anschluss an den Putsch gegen Salvator Allende im Jahre 1973. Er betont: „Alle wichtigen Akteure waren Chilenen“ (S. 946). Das ist wichtig gegenüber dem gelegentlich entstehenden Eindruck, die dort wirkenden und häufig in Chicago ausgebildeten Wirtschaftswissenschaftler seien „ein gänzlich internationales Importprodukt“ gewesen (ebd.). Zur Einordnung wäre es indessen wichtiger gewesen, den Putsch und die auf ihn folgenden Reformen im Kontext des Zusammenspiels zwischen den Interessen einheimischer Kapitaleigner, multinationaler Konzerne und den vor Ort nicht zuletzt von der CIA repräsentierten Vereinigten Staaten zu verorten.
Was aber macht für Beckert das auf die 35 Jahre bis 2008 veranschlagte neoliberale Zeitalter aus? Zunächst sind es zwei Prozesse, die benannt werden, zum einen die als „die bedeutendste Entwicklung des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts“ bezeichnete „neue Raumordnung des Imperiums des Kapitals“ (S. 963) und zum anderen die Rückkehr des „mit der Finanzwirtschaft eng verflochtene[n] Handelskapital[s]“ (S. 951). Die Verflechtung beider Prozesse wird am ehesten deutlich, wenn einzelne Unternehmen wie Nike oder H & M analysiert werden. Sie bezogen „Arbeitskräfte und Produktionsausrüstung aus allen Teilen der Welt, um ein Endprodukt herzustellen, das ebenfalls weltweit verkauft wurde“ (S. 969). Zumeist aber verschwinden die damit aufgerufenen Waren- und Wertschöpfungsketten durch den Fokus auf „neue Kapitalagglomerationen“. „Anfangs waren die sogenannten Vier Tiger – Korea, Taiwan, Hongkong und Singapur – führend, doch andere Länder wie Indonesien, Malaysia, Thailand, Mexiko und Brasilien holten rasch auf.“ (S. 953) Das trifft zu, verschleiert aber, in welche Abhängigkeitsbeziehungen auch die später so erfolgreichen taiwanesischen oder koreanischen Unternehmen noch lange verstrickt waren und dass nicht wenige thailändische, brasilianische oder mexikanische Unternehmen in solche Abhängigkeitsbeziehungen verstrickt blieben. Nicht zuletzt der Blick auf das hinsichtlich seiner Bedeutung völlig zu Recht herausgestellte China hätte hier zahlreiche Lektionen über die Bedingungen der Möglichkeit des industriellen Aufstiegs bereitgehalten, dessen qualitative Seite, also die Überwindung eines technologischen und wissenschaftlichen Rückstands allzu sehr hinter der bloßen Standortverschiebung zurücktritt.
Ein dritter wichtiger Punkt ist die „institutionelle Regulierung des Kapitalismus“ (S. 947). Der Verfasser arbeitet diesbezüglich völlig zu Recht heraus, dass trotz diverser Privatisierungen, ubiquitärer Flexibilisierungen und der massiven Schwächung der Gewerkschaftsbewegung in vielen Ländern „der Sozialstaat [...] erstaunlich widerstandsfähig“ blieb und gemessen an der Höhe der Transferleistungen eher noch expandierte (S. 991). Den Einschnitt, den die Auflösung des sozialistischen Blocks mit der dadurch ermöglichten Integration zahlloser Arbeitskräfte in die kapitalistische Weltwirtschaft darstellte, benennt Beckert, die ökologischen Verheerungen, die der steigende Verbrauch fossiler Energien und die expandierende Rohstoffextraktion verursachten, erwähnt er zumindest. „Dann kam das Jahr 2008, in dem das weltweite Finanzsystem fast kollabierte.“ (S. 1017) Darauf sind die Leser:innen dieses Buches allerdings kaum besser vorbereitet als seinerzeit viele Banken auf das Geschehen selbst. Denn der zu Beginn des Kapitels beschworene erneute Bedeutungsgewinn von Handels- und Finanzkapitalismus ist nirgends genauer geschildert worden. Die kapitalmarktgetriebene Aufspaltung von Firmen und die zeittypischen feindlichen Übernahmen bleiben ebenso im Dunklen wie der immense Bedeutungsgewinn institutioneller Anleger. Wie Firmen wie Wal-Mart – vor der Finanzkrise immerhin der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten –oder Amazon funktionieren, wird ebenso wie die Monopolorientierung der datenabschöpfenden Plattformen überhaupt nirgends erörtert. Was es bedeutet, für solche Unternehmen oder für eine der vielen Plattformfirmen im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen zu arbeiten, bleibt in einem Buch, das ansonsten der Arbeit viel Raum gibt, unklar. Auch die enorme Expansion des Finanzsektors bleibt unverständlich. Und die aus den billionenschweren staatlichen Rettungsaktionen gezogene Schlussfolgerung, „dass die Voraussetzung für das Überleben des Kapitalismus eine immer stärkere Einmischung des Staates war“ (S. 1019), lässt weder erkennen, dass das Wesen dieser Einmischung die Sozialisierung privater Verluste war, noch dass schon mittelfristig die Einmischungen in Form erneuter Regulierungen des Finanzwesens weitgehend zurückgenommen wurden.
Die Finanzkrise setzt Beckert als chronologischen Schlusspunkt. Dass sie einen Einschnitt darstellt, kann nicht strittig sein. Aber hat dieser Einschnitt Zäsurcharakter, beginnt eine neue Epoche?[13] Im abschließenden Epilog (S. 1021 ff.) zitiert er die sicherlich zutreffende Einschätzung, der zufolge „die westliche Phase des Kapitalismus hinter uns“ liege (S. 1045) Aber reicht zum Verständnis der neu entstehenden Konstellation der Blick auf China? Den Eindruck könnte man nach der Lektüre des Epilogs gewinnen, setzt dieser doch mit einem Bericht aus Kambodscha ein, der auf Beobachtungen und Gesprächen des Autors aus dem Februar 2023 basiert. Das Porträt der oft weiblichen Beschäftigten in der Textil- und Sexindustrie ist überzeugend mit den materiellen Nöten ihrer ländlichen Herkunftsfamilien verwoben, und auch die Untersuchung von Glücksspielindustrie und Immobilienspekulation lässt Kambodscha als Satelliten der Volksrepublik erscheinen. Aber erschöpft sich das gegenwärtige Geschehen im unbestreitbaren und ungemein eindrucksvollen „Aufstieg Asiens“? Reicht es gerade in globalgeschichtlicher Perspektive zu sagen: „Das dynamische Zentrum des Kapitalismus hat sich verschoben, die neuen Akteure weben neue Netze aus Kapital, Arbeit und staatlicher Macht“? (S. 1043) Beckerts punktueller Blick auf seinen Arbeitgeber und seinen Pensionsfonds, die nach der Finanzkrise beide in die brasilianische Agroindustrie investierten, deutet auf komplexere und wohl auch fragilere Konstellationen hin. Denn die in Brasilien produzierten Sojabohnen gehen überwiegend nach China und bringen das lateinamerikanische Land in eine gewisse Abhängigkeit von China, die durch die gemeinsame Zugehörigkeit zu den BRICS-Staaten nicht aufgehoben wird. Letztere waren, wenn man auf die Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien und China schaut, ohnehin weit weniger durch gemeinsame positive Interessen als vielmehr durch die Frontstellung gegenüber den Vereinigten Staaten und die von diesen dominierten internationalen Organisationen wie etwa dem IWF und der Weltbank verbunden. Da scheint es nicht zuletzt angesichts des aktuellen Schwenks des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump vom hegemonialen Multilateralismus zu bilateraler Erpressung schwierig, die Konturen der im Entstehen begriffenen, neuen Weltwirtschaftsordnung zu prognostizieren. Aber für den Autor des hier besprochenen Werkes ist das vielleicht nicht so wichtig. Denn er ist sich sicher, „irgendwann wird der Kapitalismus ein Ende finden“ (S. 1055).[14]
Darüber soll hier nicht gestritten werden, zumal der kapitalistischen Form des Wirtschaftens die Zukunft zumindest insofern gleichgültig ist, als selbst die planetare Bedrohung durch den Klimawandel dem rücksichtslosen Rückgriff auf fossile Brennstoffe und andere natürliche Ressourcen keinen Einhalt gebietet. Sie steht gleichsam außerhalb der Bilanz. Wie aber fällt die Bilanz von Sven Beckerts fast 1.300 Seiten starkem Buch aus? Auf der Habenseite steht sicherlich, dass er die handelskapitalistischen Anfänge eines globalen Kapitalismus ernstnimmt und die Bedeutung staatlicher Gewalt für die frühneuzeitliche Herausbildung einer nordwesteuropäischen Dominanz betont, auch wenn beides weit weniger originell ist, als der Autor gelegentlich suggeriert. Ähnliches gilt für die Einbettung der Industriellen Revolution in den Zusammenhang des atlantischen Dreieckshandels, ohne den diese nicht angemessen zu begreifen ist. Für diese zeitlich frühen Teile bewährt sich auch der Ansatz am besten, den Blick konsequent auf Kapital, Arbeit und Staat zu richten – am besten deshalb, weil der Autor hier nachvollziehbar macht, wie staatliche Unterstützung unverzichtbar für den Erfolg konkreter Kapitalinvestitionen war und welche Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen der arbeitenden und nicht selten unfreien Bevölkerung daraus erwuchsen. Diese Zusammenhänge zerfasern leider im weiteren Verlauf der Darstellung zusehends. Sie bezieht zwar weiterhin in bewundernswerter Weise Tatorte in aller Welt ein, doch sind diese – auf der Ebene der Darstellung – immer weniger durch konkrete Kapitalinvestitionen oder staatliche Interventionen miteinander verknüpft. So sind etwa die Impulse, die vom Kleidungsbedarf karibischer Zuckerplantagen auf das Leinengewerbe im Osnabrückischen ausgehen, noch gut nachvollziehbar, während die Protoindustrie überall sonst auf der Welt oft gleichsam in der Luft hängt. Und mit dem Aufstieg des Interventionsstaates verlieren Kapital und Arbeit immer mehr den Charakter von Akteuren, die etwa auf der Ebene des Unternehmens täglich interagieren, und werden zunehmend zu Kollektivakteuren, die auf der politischen Ebene um die Ausgestaltung von (Sozial-)Staatlichkeit ringen. So wird zwar beispielsweise deutlich, wie das Unternehmen, das die besonders hell ausgeleuchtete Godrey-Schreibmaschine herstellte, von seiner Nähe zu den politischen Eliten des endlich selbständigen Indien profitierte, seine Belegschaft dagegen bleibt im Dunklen. Dieses allmähliche Verschwinden konkret investierender Kapitaleigner und ihrer Beschäftigten reflektiert nicht einfach den Bedeutungszuwachs des Staates. Und insoweit diese Investitionen Auslandsinvestitionen waren, vermögen Leser:innen kaum nachzuvollziehen, wie durch sie globale Zusammenhänge konstituiert wurden, in welche die Einzelstaaten am Investitionsort, internationale Handelsorganisationen und nicht zuletzt die Heimatstaaten der Investoren (auch gewaltsam) eingriffen. So verliert sowohl der kapitalismus- als auch der globalgeschichtliche Grundansatz des Buches von Kapitel zu Kapitel an Schärfe, obwohl doch eine Welt beschrieben wird, die der Tendenz nach immer stärker von einem globalen Kapitalismus geprägt wurde. – Dem Erfolg des Buches werden diese Schwächen keinen Abbruch tun. Die von einem Erfolgsautor wie Thomas Piketty oder einem Nobelpreisträger wie Amartya Sen stammenden Lobeshymnen, mit denen der Verlag wirbt, garantieren einen Welterfolg.
Fußnoten
- Der Autor war wie der Rezensent sowie Jürgen Kocka und Werner Plumpe schon vor einer ganzen Reihe von Jahren eingeladen, an einem Themenheft mit dem Titel „How to Write the History of Capitalism?“ mitzuwirken, schlug die Einladung indessen aus; vgl. deshalb nur Friedrich Lenger, Challenges and Promises of a History of Capitalism, in: Journal of Modern European History XV (2017), 4, S. 470–479.
- Vgl. Pierre François / Claire Lemercier, Sociologie historique du capitalisme, Paris 2021 sowie Friedrich Lenger, Der Preis der Welt. Eine Globalgeschichte des Kapitalismus, München 2023.
- Vgl. Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony. The World System A.D. 1250–1350, New York 1989.
- Vgl. Sven Beckert, King Cotton. Eine Geschichte des globalen Kapitalismus, München 2014.
- Vgl. Sidney W. Mintz, Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, New York 1986.
- Vgl. Jan de Vries, The Industrious Revolutions in East and West, in: Gareth Austin / Kaoru Sugihara (Hg.), Labour-Intensive Industrialization in Global History, London 2013, S. 65–84; Kenneth Pomeranz, The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, NJ 2000, insbesondere S. 161 f.; und Jean-Laurent Rosenthal / Roy Bin Wong, Before and Beyond Divergence. The Politics of Economic Change in China and Europe, Cambridge, MA 2011 sowie zusammenfassend und mit weiterer Literatur Lenger, Der Preis, S. 151–155.
- Vgl. vor allem Joseph E. Inikori, Africans and the Industrial Revolution in England. A Study in International Trade and Economic Development, Cambridge 2002; Ronald Findlay / Kevin H. O`Rourke, Power and Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millenium, Princeton, NJ 2007, insbesondere S. 339–343; Maxine Berg / Pat Hudson, Slavery, Capitalism and the Industrial Revolution, Cambridge 2023 sowie Lenger, Der Preis, S. 158–168.
- Vgl. zum letzten Beispiel knapp Friedrich Lenger, Dialektik der Teilhabe. Fluchtpunkte einer Globalgeschichte des Kapitalismus, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung XX (2023), 2, S. 49–63, hier S. 53 f.
- Vgl. Tirthankar Roy, A Business History of India. Enterprise and the Emergence of Capitalism from 1700, Cambridge 2018, S. 156/159.
- Vgl. zusammenfassend und mit weiterer Literatur Lenger, Der Preis, S. 394–429.
- Vgl. Jonathan Levy, Ages of American Capitalism. A History of the United States, New York 2021.
- Nancy, Fraser, Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt, Berlin 2023, S. 121.
- Für eine spätere Datierung des Epochenumbruchs plädiert das knappe Preface zu Friedrich Lenger, The Price of the World. A Global History of Capitalism, Cambridge 2026 (forthcoming).
- Vgl. zu dieser schon sehr lange gegenwärtigen Überzeugung knapp Friedrich Lenger, Das Ende des Kapitalismus – vor, bei und nach Marx, in: Merkur 831 (2018), S. 34–49.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Arbeit / Industrie Geld / Finanzen Geschichte Globalisierung / Weltgesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Kolonialismus / Postkolonialismus Rassismus / Diskriminierung Staat / Nation Wirtschaft
Empfehlungen
Kritische Theorie oder empirieferne Deduktion?
Rezension zu „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ von Nancy Fraser
Prototyp der wirtschaftswissenschaftlichen Großforschung
Rezension zu „Primat der Praxis. Bernhard Harms und das Institut für Weltwirtschaft 1913–1933“ von Lisa Eiling
Die Häutungen des Leviathan
Rezension zu „The Project-State and Its Rivals. A New History of the Twentieth and Twenty-First Centuries“ von Charles S. Maier
