Christoph Deutschmann | Rezension | 22.05.2025
Von der Hölle ins Kaffeehaus
Rezension zu „Brennende Erde. Eine Geschichte der letzten 500 Jahre“ von Sunil Amrith
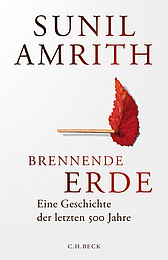
Der Autor – er stammt aus Singapur und ist Professor für Geschichte an der Yale University – erzählt in einer Anmerkung, dass er ursprünglich erwog, eine allgemeine Geschichte Südasiens zu schreiben. Aber er konnte sich für dieses Projekt nicht recht erwärmen. Einer seiner Lektoren überredete ihn daraufhin, eine „globale Umweltgeschichte“ zu schreiben; so entstand Brennende Erde. Eine Geschichte der letzten 500 Jahre. Nicht nur die Zeitspanne, die das Buch behandelt, ist außerordentlich und noch deutlich größer als die im Titel anvisierten 500 Jahre, denn die Darstellung setzt bereits mit den Eroberungsfeldzügen Dschingis Khans im 12./13. Jahrhundert ein. Auch in der Auswahl der untersuchten Schauplätze bemüht Amrith sich dezidiert um eine breite, globale Perspektive, die den noch immer weit verbreiteten Eurozentrismus überwindet. Bei einem zeitlich und räumlich so weit gespannten Projekt kann man nicht mit einer kohärenten historiografischen Untersuchung rechnen. Stattdessen präsentiert der Autor eine Zusammenstellung zeitlich und geografisch breit gestreuter Einzelepisoden, die den in der Einleitung skizzierten Leitgedanken immer neu beleuchten: Es geht um die „Kollateralschäden“ menschlicher Freiheit, um die noch immer unterschätzten ökologischen wie sozialen Verwüstungen, die der nun schon seit Jahrhunderten anhaltende „technische Fortschritt“ als Nebenfolge hervorgebracht hat.
Freiheit sei, wie Amrith betont, nicht allein als politisches Projekt im Sinn der europäischen Aufklärung zu verstehen. Sie fuße vielmehr auf einem umfassenderen, auf die natürliche Umwelt wie die Menschen selbst zielenden Impetus der Naturbeherrschung, dessen Spuren sich bis auf die Eroberungsfeldzüge Dschingis Khans sowie die mittelalterliche Expansion der chinesischen Reisbaukultur und der europäischen Feudalgesellschaften zurückverfolgen lassen. Es waren dann der europäische Kolonialismus und schließlich der ebenfalls von Europa ausgehende industrielle Kapitalismus, die die technische Beherrschung der Natur im zivilen wie im militärischen Bereich zu zuvor nie erreichter Perfektion trieben. Das brachte nicht nur Profite für eine kleine Elite, sondern auch eine enorme Erweiterung der menschlichen Lebensmöglichkeiten insgesamt; es schuf die Basis für das Anwachsen der Weltbevölkerung und den Anstieg der Lebenserwartung. Aber die Kehrseite des Fortschritts war die „brennende Erde“: Die Zerstörung von Wald in unvorstellbarem Umfang, die Vergiftung der Böden, der Luft und des Wassers, die Vernichtung der Biodiversität, die Klimaerwärmung aufgrund steigender CO2-Emissionen. Weitere Folgen waren die Ausbeutung und Versklavung der Arbeitenden sowie die mit höchster technischer Effizienz durchgeführten modernen Massenvernichtungskriege. So zielt das Buch darauf, dem Leser/der Leserin auch noch die letzte Arglosigkeit gegenüber in den Sozialwissenschaften noch immer verbreiteten Begriffen wie „Modernisierung“, „Naturbeherrschung“ oder „technischer Fortschritt“ auszutreiben. Die Natur, zu der auch der menschliche Körper gehört, lässt sich nicht einfach kolonisieren und „beherrschen“. Sie schlägt vielmehr zurück, und sie schlägt umso vernichtender zurück, je weitreichender die menschlichen Kolonialisierungsversuche werden.
Das Zurückschlagen der Natur spielt in den ersten, von Amrith nur knapp gestreiften historischen Szenarien eine zentrale Rolle: In den mongolischen Eroberungsfeldzügen des 12. und 13. Jahrhunderts und dem damaligen Aufblühen der Agrarkulturen in Europa und in China, das in den Jahren zwischen 900 und 1200 zu einem beträchtlichen Bevölkerungswachstum in beiden Regionen führte. Mit dem Wachstum der Produktion weitete sich auch der überregionale Handel aus. Dies wiederum begünstigte die Verbreitung des ursprünglich nur in der zentralasiatischen Steppe beheimateten Pestbakteriums, die ihren Höhepunkt in der Mitte des 14. Jahrhunderts erreichte; mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa, dem Nahen Osten und Asien fiel dem damals grassierenden „Schwarzen Tod“ zum Opfer. Eine systematische und besonders brutale Form nahm das Streben nach Naturbeherrschung in den portugiesischen und spanischen Kolonialisierungsfeldzügen des 15. und 16. Jahrhunderts an, die im zweiten Kapitel behandelt werden. Anders als die chinesischen Expeditionen, die gleichfalls im 15. Jahrhundert begannen, dann jedoch wieder eingestellt wurden, beschränkten sich die iberischen Kolonisatoren nicht darauf, Luxusgüter und Tribute aus fernen Ländern herbeizuschaffen. Angetrieben durch die Gier nach Gold, nahmen sie das Land in Besitz und versklavten die Bevölkerung. Die spanischen Eroberungen in Lateinamerika brachten der einheimischen Bevölkerung millionenfachen Tod durch Gewalt, Versklavung, Hunger, aber auch durch eingeschleppte Bakterien; die ökologischen Verwüstungen durch die Zerstörung der heimischen Landwirtschaft und durch den Silberbergbau waren katastrophal.
Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über die Expansion der russischen und osmanischen Reiche, des chinesischen Imperiums und der indischen Mogul-Dynastie im Zeitraum von etwa 1500 bis 1800. Große Landflächen wurden durch Siedler für die Landwirtschaft und Viehzucht urbar gemacht, was den jeweiligen Herrschern einen stetigen Zufluss neuer Steuereinnahmen sicherte. Die Kehrseite war nicht nur die Vernichtung großer Waldflächen, sondern auch die Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Gleichzeitig weitete sich der chinesische Handel mit Luxusgütern aus und der sich damals schon entwickelnde, durch die Portugiesen kontrollierte transpazifische Handel half China, die durch Klimaschwankungen bedingten Hungersnöte durch den Import der Süßkartoffel zu überwinden.
Im vierten Kapitel geht es zunächst um die als „Vororte der Hölle“ bezeichneten Zuckerrohr-Plantagenwirtschaften, wie sie seit dem 16. Jahrhundert zunächst in Madeira, dann in der Karibik und in Brasilien entstanden. Betrieben durch millionenfach aus Afrika importierte Sklaven, waren die Plantagen nicht nur Orte menschenverachtender und für die Betroffenen vielfach tödlicher Zwangsarbeit, sondern auch Ausgangspunkt nachhaltiger ökologischer Zerstörungen. In einem Szenenwechsel werden dann die seit dem 17. Jahrhundert in London und Amsterdam entstandenen Kaffeehäuser in den Blick genommen, in denen die Endprodukte der höllischen Plantagen konsumiert wurden: Eine wohlhabende Kundschaft traf sich mit Geschäftsfreunden, um bei einer Tasse Kaffee Geschäfte abzuwickeln. Hintergrund dieser Entwicklung war das bereits damals zu verzeichnende Wachstum der Städte in England und den Niederlanden. Sie hatte ihrerseits erhebliche Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft zur Voraussetzung, die durch weitreichende Umgestaltungen der Natur mittels Entwaldung, Deichen und Trockenlegung von Sumpfgebieten ermöglicht worden waren. Mit dem Vorstoß der Europäer nach Nordamerika entstand dann eine noch weit größere und folgenreichere, ideologisch durch die Verheißungen von Land und Freiheit verklärte Kolonisierungsbewegung – die wiederum großflächige ökologische Zerstörungen und die Vertreibung und Vernichtung der indigenen Bevölkerung nach sich zog.
Der zweite, ebenfalls in vier Kapitel gegliederte Hauptteil des Buches wendet sich der Entstehung des industriellen Kapitalismus und seiner Entwicklung bis 1945 zu. Bedingung für die Entstehung war nicht nur die Erfindung der Dampfmaschine, sondern vor allem die Ausweitung privater Eigentumsrechte über die Produktion, mit der Folge der Ausbreitung von Fabriken und Lohnarbeit im ganzen Land. Das löste erneut umfangreiche Migrationsbewegungen aus, die ebenso beleuchtet werden wie die durch die Vergiftung von Luft und Wasser bedingten ökologischen Zerstörungen. Der Eisenbahnbau gab nicht nur der Migration der Arbeitskräfte weltweit einen zusätzlichen Schub, sondern auch der Kolonisierungsbewegung der Siedler in Nord- wie Südamerika. Auch die Plantagenwirtschaft wuchs weiter und mit ihr auch die Sklaverei, trotz ihres formellen Verbots im britischen Weltreich im Jahr 1834. Die amerikanischen Prärien wurden in Weizenfelder verwandelt, die ihre ursprüngliche Fruchtbarkeit bald einbüßten und nur noch Staubwüsten zurückließen. Die ursprünglich die Prärien bevölkernden Büffel wurden nahezu ausgerottet und durch Rinder ersetzt. Die Techniken der Fabrikproduktion hielten auch in der Schlachtindustrie Einzug. Der Einsatz der neu erfundenen Maschinenwaffen gab der imperialen Eroberungswelle rund um die Welt einen weiteren entscheidenden Schub. Die Märkte für Weizen wie für Reis weiteten sich dank der Eisenbahnen und Dampfschiffe überall in der Welt aus. Das konnte katastrophale Hungersnöte, wie zwischen 1876 und 1879 in Indien, nicht verhindern. Gleichwohl bestand das Ergebnis der industriellen Revolution nicht nur in einem nie dagewesenen Wachstum der Weltbevölkerung, sondern auch, dank der hygienischen Verbesserungen und medizinischen Fortschritte, in einem allmählichen Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung.
Das sechste Kapitel schildert „unmögliche Städte“, die durch den Industrialisierungs-Boom groß geworden waren: Als „Leuchtturm“ präsentierte sich Paris mit der Weltausstellung von 1900, die nicht weniger als 40 Millionen Besucher zählte. Johannesburg, als Zentrum des südafrikanischen Goldbergbaus, war das dunkle Pendant zu Paris. Die meist schwarzen Arbeiter dort wurden aus weiten Teilen Afrikas angeworben; die Arbeitsbedingungen waren mörderisch, die ökologischen Zerstörungen durch die Goldminen verheerend. Der stete Zustrom von südafrikanischem Gold bildete die Voraussetzung dafür, die britische Währung und mit ihr schließlich das gesamte Weltwährungssystem auf den Goldstandard umzustellen. Die dritte „unmögliche Stadt“ war das russische Baku, das sich vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Zentrum der Erdölindustrie entwickelte; schon damals war das Erdöl dabei, die Kohle als Energieträger zu verdrängen. Das folgende, siebente Kapital beschreibt den Ersten Weltkrieg als eine technologische Zeitenwende, in der Deutschland mit seiner Chemischen Industrie die Führung übernahm. Maßgeblich waren dabei militärische Interessen und so wurde die Ammoniaksynthese nicht nur für die Herstellung künstlichen Düngers, sondern vor allem großer Mengen von Sprengstoff genutzt, später kam noch Giftgas hinzu. Die Einführung benzinbetriebener Automobile steigerte die Effizienz der Militärapparate, die Entwicklung von Flugzeugen machte den Luftkrieg möglich. Der forderte nicht nur millionenfache menschliche Opfer, sondern zog auch die Verwüstung großer Landstriche durch Bombenteppiche, Giftgas und Flächenbrände nach sich. Die geopolitischen Spannungen der Zwischenkriegszeit und der darauffolgende Zweite Weltkrieg sorgten dafür, dass die militärtechnologische Konkurrenz zwischen den Großmächten mit ihren verheerenden Folgewirkungen sich auf höherer Stufe fortsetzte. Diese im achten Kapitel geschilderte Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt mit den amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki – Angriffe, die auch den durch die USA im Zweiten Weltkrieg errungenen hegemonialen Status in der ökonomisch-militärischen Konkurrenz symbolisierten.
Gleichwohl waren es nicht allein militärische Interessen, die den technologischen Kampf um die Unterwerfung der Natur vorantrieben, sondern auch die politischen und ökonomischen Freiheitsversprechen, die nach dem Zweiten Weltkrieg rund um die Welt an Einfluss gewannen. Das ist Thema des dritten und abschließenden Hauptteils. Die Vereinten Nationen, die westlichen Demokratien, aber auch die aus kolonialer Herrschaft entlassenen Entwicklungsländer proklamierten Freiheit, Menschenrechte, Demokratie und soziale Rechte als Fundamente ihrer Verfassungen. Aber: „Weder in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 [….] noch in irgendeiner der nationalen Verfassungen, die in jenen Jahren erarbeitet wurden, gab es eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den ökologischen Voraussetzungen der Freiheit“ (S. 278). In den Entwicklungsländern – Mexiko, Ägypten, Indien, Singapur, China, Iran – wurden großangelegte Infrastrukturprojekte vorangetrieben, die die Nationen aus Armut und Rückständigkeit befreien sollten: Staudämme, Straßen, Eisenbahnlinien oder die Erschließung von Erdölquellen. Weder auf die ökologische Verträglichkeit der Projekte, noch auf die Gesundheit der ausführenden Arbeiter wurde dabei Rücksicht genommen. Besonders willkürlich und brutal war der chinesische „Große Sprung nach vorn“ unter Mao Tse-tung, der nicht nur Millionen menschlicher Opfer forderte, sondern auch mit einer absurden Kampagne zur Tötung von Spatzen einherging (S. 295 f.). In den entwickelten Ländern Westeuropas und Amerikas nährte der Erdölboom eine um das Automobil arrangierte Konsumkultur, zu der auch gigantische Straßen- und Autobahnprojekte gehörten. Plastikprodukte aller Art durchdrangen den Alltag und vermüllten die Umwelt. Auch die Sowjetunion und die ihr angeschlossenen realsozialistischen Länder versuchten, diesen Entwicklungen mit planwirtschaftlichen Mitteln nachzueifern. Die Klimaforschung, die in den 1950er-Jahren mit der systematischen Sammlung von Daten über die globalen Klimaveränderungen begann, diagnostizierte für die Zeit nach 1945 eine „große Beschleunigung“: Produktion und Handel vervielfachten sich weltweit, auch wenn der steigende Wohlstand überproportional den entwickelten Industrieländern zugutekam. Bevölkerung und Lebenserwartung nahmen signifikant zu, während die Kindersterblichkeit sank. All das bedeutete freilich auch einen steilen Anstieg der Emissionen von Kohlenstoff und Methan; Klimaforscher sprachen schon damals von einem „großangelegten geophysikalischen Experiment“, dessen Ausgang ungewiss sei (S. 314).
Die selbstzerstörerischen Aspekte des wirtschaftlichen Wachstums und militärischer Technologien fanden zunehmend auch Eingang in wissenschaftliche Debatten und umweltpolitische Bewegungen. Der wachsende öffentliche Einfluss ökologischer Argumente wird im zehnten Kapitel anhand der Beiträge dreier Autorinnen rekonstruiert, deren Auswahl freilich etwas willkürlich wirkt: Die Philosophin Hannah Arendt, die Meeresbiologin Rachel Carson sowie die indische Premierministerin Indira Gandhi, deren Auftritte auf verschiedenen internationalen Tagungen gewürdigt werden. Auch der Zusammenhang zwischen dem starken Wachstum der Bevölkerung nach 1950 und der sich zuspitzenden ökologischen Krise wurde damals thematisiert (S. 343 f.); in der Folge führten etwa Indien und China Maßnahmen zur Geburtenbeschränkung ein, die von Amrith kritisch kommentiert werden. Das elfte Kapitel greift den Titel des Buches leicht abgewandelt auf und schildert unter der Überschrift „Brennende Wälder“ die in den 1970er-Jahren einsetzende großflächige Vernichtung der Regenwälder Brasiliens und Indonesiens, die Platz für Weideflächen, Sojabohnen- oder Palmöl-Plantagen im Interesse der Exportindustrie schaffen sollte – ein Kampf, der mit brutalen Mitteln ausgetragen wurde, wie der Autor am Fall des durch Kettensägen-Trupps ermordeten brasilianischen Umweltaktivisten Chico Mendes verdeutlicht. Die steigende Produktivität der Landwirtschaft verband sich mit einem rasanten Wachstum der Großstädte in den Entwicklungsländern. Der gnadenlose Kampf um Markterfolg und sozialen Aufstieg prägte die Lebensbedingungen einer immer größeren Zahl von Menschen. „Es stimmt, was sie sagen – nicht wir kontrollieren das Geld, das Geld kontrolliert uns“ – so schildert es ein von Amrith zitierter indischer Erzähler (S. 371).
Die beiden resümierenden Kapitel zur Gegenwart (12 und 13) zeichnen ein widersprüchliches Bild: Auf der einen Seite erlebten soziale und politische Bewegungen für den Umweltschutz seit 1990 überall in der Welt einen ungeahnten Aufschwung, nicht nur in Europa, sondern auch in Brasilien, Nigeria, Kenia, Indien und vielen weiteren Ländern. Es gelang diesen Bewegungen auch, sich national und international zu vernetzen und ihren Argumenten auf einer Reihe internationaler Konferenzen – beginnend mit der UNO-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 – Gehör zu verschaffen, oft gegen den erbitterten Widerstand der fossilen Industrien und der Regierungen der entwickelten Industrieländer. Auf der anderen Seite nahmen seit 1990 auch die Verwüstungen der Umwelt und die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase in nie gekanntem Ausmaß zu; die Folgen des dadurch ausgelösten Klimawandels in Form von Extremwetterlagen, abschmelzender Gletscher und Polkappen, ansteigender Meeresspiegel sind heute unübersehbar. Die Natur – so müsste man aus Amriths vorherigen Betrachtungen folgern – ist bereits dabei, zurückzuschlagen, und der Gegenschlag verspricht, vernichtend zu werden. Wie der Autor angesichts dieser Lage seinen gedämpften umweltpolitischen Optimismus rechtfertigen will, für den er am Ende gleichwohl wirbt, erschließt sich dem Leser nicht recht. Die Stärke von Amriths Buch liegt zweifellos in den „dichten Beschreibungen“, die es über weite Strecken hinweg bietet. Hinsichtlich seiner analytischen Kraft fällt es demgegenüber deutlich ab und das macht sich insbesondere in den letzten Kapiteln enttäuschend bemerkbar. Zweifellos – da ist Amrith Recht zu geben – muss die Menschheit Wege finden, ihre aus dem Okzident stammenden Freiheitsideen, die jedoch längst weltweit Resonanz gefunden haben, in eine ökologisch verträgliche Form zu bringen. Aber wie könnte man sich – abgesehen von symbolträchtigen politischen Einzelaktionen, so wichtig diese zweifellos sind – diesem Ziel wirklich nähern? Dazu bietet das Buch leider kaum neue Antworten oder auch nur Anregungen. Man kommt mit den analytischen Schwächen des Buches vielleicht am ehesten zurecht, wenn man sie als kaum zu vermeidendes Gegenstück seiner Stärken in Kauf nimmt. Sein Reichtum an lebendigen Szenarien, die die Abgründe des Mensch-Natur-Verhältnisses empirisch und historisch auf den Punkt bringen, macht das Buch zu einer lohnenden Lektüre.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Geschichte Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Moderne / Postmoderne Ökologie / Nachhaltigkeit
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
Freiheit neu erfinden
Rezension zu „Überfluss und Freiheit. Eine ökologische Geschichte der politischen Ideen“ von Pierre Charbonnier
Eine andere Geschichte des Kapitalismus
Rezension zu „Stoffwechselpolitik. Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten“ von Simon Schaupp
