Conrad Lluis | Rezension | 05.03.2025
Eine andere Geschichte des Kapitalismus
Rezension zu „Stoffwechselpolitik. Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten“ von Simon Schaupp
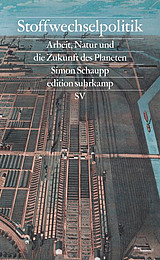
„Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert.“[1] Was Karl Marx auf einer abstrakt philosophischen Ebene beschreibt, macht sich der Soziologe Simon Schaupp – derzeit Vertretungsprofessor an der TU Berlin – in seiner Monografie Stoffwechselpolitik zum Auftrag für eine breit angelegte historische Rekonstruktion. Schaupp geht der Frage nach, wie Mensch und Natur seit dem Beginn der Neuzeit, genauer: seit der Entstehung des Kapitalismus, miteinander interagieren, ja beständig aufeinander einwirken. Die 400-seitige Studie besteht aus neun Kapiteln und ist – bis auf die konzeptuell angelegte Einleitung (Kap. 1) – chronologisch aufgebaut: von den Sklavenplantagen der Karibik im 17. Jahrhundert (Kap. 2) über die frühen Fleischfabriken in den USA (Kap. 4) und die deutschen Automobilwerke der Nachkriegszeit (Kap. 5) bis hin zur schweizerischen Baubranche der Gegenwart (Kap. 8). Auch wenn manche Kapitel argumentativ etwas zerfasert wirken, präsentiert die insgesamt flüssig formulierte und erfreulich jargonfreie Monografie eine auch für fachfremde Lai:innen verständliche revisionist history of capitalism. Hier nicht im pejorativen Sinne als eine politisch getriebene Verdrehung historischer Fakten zu verstehen, sondern im analytischen Sinne als eine neuartige Deutung, die sich explorativ als Alternative zu tradierten grand narratives artikuliert. Sie ist eine überaus anregende Neulektüre von Arbeit und Natur im Kapitalismus, freilich nicht ohne an einigen Stellen Widerspruch zu provozieren.
Der Titel Stoffwechselpolitik fungiert zugleich als Leitbegriff der Untersuchung, darin verdichten sich die drei analytischen Register des Autors, die ich im Folgenden etwas ausführlicher darstellen werde. Erstens interagieren Mensch und Natur nach Schaupp, der sich explizit in die Tradition von Marx und der materialistischen Arbeitssoziologie einschreibt, vermittelt über Arbeit miteinander – vor allem, aber nicht nur, über kapitalistische Lohnarbeit. Im Grunde sei jede Arbeit eine „ökologische Arbeit“, als sie „der Natur ihre Form“ gibt (S. 23), um das Natürliche für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Diese transformative Dimension ist besonders evident für die industrielle Arbeit, die unmittelbar in die Natur eingreift. In Kapitel 3 beschreibt Schaupp am Beispiel des Kohlebergbaus und der Eisenhütten im Ruhrgebiet die Geburt eines fossilen Stoffwechselregimes, schließlich ging es dabei um den „rekursive[n] Einsatz von Kohle zur Gewinnung von mehr Kohle“ (S. 112). In den zitierten Aussagen der Bergarbeiter erscheint der Stoffwechsel als die zutiefst mühevolle, ja lebensbedrohliche und -verkürzende Bearbeitung einer Natur, die sich aktiv widersetzt. Schaupp verwendet hierbei einen breiten Naturbegriff: Auch „reproduktive Tätigkeiten in Gesundheitswesen, Erziehung oder Bildung“ (ebd.) verändern die Natur in spezifischer Weise, denn sie machen den menschlichen Körper für Verwertungsprozesse nutzbar. Die Studie beschäftigt sich also sowohl mit der industriellen Produktion als auch mit der humanen Reproduktion, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur aufzuschlüsseln – wobei der Schwerpunkt klar auf Ersterer liegt.[2]
Im Leitbegriff Stoffwechsel steckt, zweitens und angelehnt an Michael Burawoys Konzept der Produktionspolitik (S. 14 f.), auch ein politisches Moment: Wie der Mensch auf die Natur einwirkt, ist nach Schaupp eben nicht naturgegeben, sondern Ergebnis historischer Prozesse und politischer Aushandlungen. Entsprechend kartiert die Studie mehr als nur die Präsenz und Bearbeitung der Natur von der früh- über die hoch- bis hin zur spätkapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Der Autor entwirft eine geradezu antagonistische Dreiecksbeziehung zwischen Kapitalismus, Natur und ökologischem Eigensinn. Der Begriff des ökologischen Eigensinns geht auf den Sozialhistoriker Alf Lüdtke zurück, der unter „Eigen-Sinn“ das Schaffen individueller oder kollektiver Freiräume innerhalb herrschaftsförmiger Settings (vom Arbeitsalltag in kapitalistischen Betrieben bis hin zum Leben in autoritären Regimen) verstand.[3] Schaupp geht noch einen Schritt weiter, wenn er Widerständigkeiten in der Triade aus ausgebeuteten Arbeitskräften, Natur und kapitalistischem Extraktivismus sucht. Kurzum: Ökologischer Eigensinn meint eine Form der potenziell widerständigen Arbeitspraxis, die sich quasi mit der Natur verbündet, indem sie lernt, diese zu lesen und für sich zu nutzen, um sich Freiräume zu erkämpfen.
Kapitel 2 etwa beschreibt die Sklavenplantagen des 17. und 18. Jahrhunderts, die „zerstörerische Nutzbarmachung der karibischen Ökosysteme“ (S. 79) durch Zuckerrohrmonokulturen. Im Sinne Lüdtkes, aber auch unbewusst in der Tradition von James C. Scotts Weapons of the Weak[4] und vielleicht gar der (Sozial-)Romantik stehend, legt Schaupp dar: Die Arbeiter:innen entwickelten einen ökologischen Eigensinn, um (minimale) Freiräume zu schaffen oder sich gegen ihre Ausbeuter:innen aufzulehnen. Arbeit und Natur waren hier eng miteinander verflochten, um sich dem extraktivistischen, kapitalistischen Stoffwechsel zu entziehen oder ihn gar zu sabotieren. Im Wortlaut:
„Eine wichtige Strategie [der Sklav:innen] bestand darin, sich zwischen den hohen Zuckerrohren zu verstecken. Sobald das Zuckerrohr hoch genug war, bauten die Sklaven dort sogar Hütten von etwa eineinhalb Metern Höhe, indem sie mehrere Halme miteinander verflochten. Im Inneren wurde der Boden festgetreten und Feuerstellen errichtet. All dies setzte ein umfassendes Erfahrungswissen über die Beschaffenheit der Pflanzen voraus.“ (S. 85)
Dies führt uns zum dritten Aspekt, den die Studie zentral stellt: die Autonomie der Natur. Sie wird Schaupp zufolge derzeit meist auf „negative Weise erfahrbar […], insbesondere in Form von ‚Naturkatastrophen‘“ (S. 34). Denn wir können die Natur zwar systematisch bearbeiten, in letzter Instanz unterliegt sie aber nicht der menschlichen Herrschaft. Die Autonomie der Natur lässt sich für die Arbeitspraxis auch positiv wenden, nämlich als der eben skizzierte ökologische Eigensinn. „Beschäftigte eignen sich […] im Zuge ihrer Tätigkeit ein spezifisches Umweltwissen an. Dabei handelt es sich wesentlich um ein Wissen über die Autonomie der Natur, das heißt um ebenjene Aspekte, die sich der Kontrolle der Unternehmen entziehen.“ (S. 53) Dieses Wissen ist zum einen notwendig, um Arbeitsprozesse überhaupt effektiv durchführen zu können. Ein Bauarbeiter weiß, dass bei 35 Grad Außentemperatur – ein Umstand, an dem er nichts ändern kann – sein Körper schneller dehydriert und dass der Beton rascher erhärtet. Zum anderen lassen sich diese Formen des „verkörperten Umweltwissens“ (S. 317) aber auch für eine explizite Kritik an der Naturausbeutung nutzen – freilich nicht im Sinne eines wissenschaftlichen, sondern eines in Erfahrung gegründeten, aus der konkreten Arbeitspraxis hervorgehenden Umweltbewusstseins (S. 321–328). Die Bauarbeiter wissen etwas, das sich immer nur unvollständig in Arbeitsverträgen, Bauplänen oder formellen Arbeitsschutzmaßnahmen explizieren lässt: Schaupp zufolge lernen sie im Laufe ihres Erwerbslebens , dass die Natur ihre eigenen Rhythmen und Gesetzmäßigkeiten besitzt, ja dass sie sich als eine eigene, dem Menschen gegenüberstehende Realität erweist.
So überzeugend die Konzepte der Autonomie der Natur und des ökologischen Eigensinns – verstanden als Praxis der subtilen Anpassung der Arbeitenden an die Natur – sind, so problematisch finde ich beide auf einer grundsätzlichen Ebene. Es lohnt sich, an dieser Stelle das eingangs angebrachte Marx-Zitat wieder aufzunehmen:
„Er [der Mensch] tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel der Kräfte seiner eignen Botmäßigkeit.“[5]
Marx beschreibt hier den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur im emphatischen Sinne als Aneignung, die Objekt (die Natur) und Subjekt (der Mensch) der Aneignung verändert. Beides, der arbeitende Mensch und die bearbeitete Natur, stehen sich eben nicht einfach gegenüber (wie bei Schaupps Bauarbeitern), sondern verbinden sich miteinander. Die Natur wird in Gestalt der aus ihr gewonnenen Ressourcen zum Teil der menschlich gemachten Welt. Demgegenüber geht Schaupp – meines Erachtens fälschlicherweise – davon aus, dass Gesellschaft und Natur in einem Verhältnis der Ko-Konstitution stehen, jedoch „gerade in ihrer Wechselwirkung zu getrennten Einheiten“ werden (S. 35).
Entsprechend beschäftigt sich Stoffwechselpolitik nicht mit der eigentlich spannenden Frage, wie der Prozess der Vereinigung von Mensch und Natur in der kapitalistischen Moderne vonstattengeht. Und das, obwohl Schaupp die Nutzbarmachung und Aneignung der Natur von der Neuzeit bis zur Spätmoderne akribisch illustriert. Ihm zufolge folgt daraus immer wieder – und in immer stärkerer Weise – die Wiederkehr des Verdrängten, namentlich der Autonomie der Natur: „Paradoxerweise ist es gerade die zunehmende Nutzbarmachung der Natur, die deren Autonomie in den Vordergrund rückt.“ (S. 46) Klimawandel, Pandemien, Biodiversitätsverlust usw. verursachen nach Schaupp aufseiten des Menschen eine „reaktive Expansion“ (S. 46 f.), einen sich stetig verstärkenden Zugriff auf die Natur – etwa die geplante Ausbeutung der Bodenschätze Grönlands nach der (endgültigen) arktischen Eisschmelze. Dadurch komme es aber nur zu weiteren unvorhersehbaren Naturereignissen. Die jüngsten, zusehends katastrophaler werdenden Klimaereignisse scheinen Schaupps Argument zu bestätigen: Den Kapitalismus zeichnet eine destruktive Dialektik von kapitalistischer Nutzbarmachung und (strafender) Autonomie der Natur aus. Die Natur bleibt dabei ein konstitutives Außen der kapitalistischen Gesellschaft, das sich in letzter Instanz niemals aneignen und unterwerfen lässt.
Streng genommen ist bei Schaupp nicht nur die Natur, sondern auch die Arbeit eigensinnig. Die Autonomie der Arbeit steht ebenfalls für die Widerständigkeit gegen die (kapitalistische) Produktivkraftentwicklung, denn wie die Natur lassen sich auch die konkreten Arbeitspraktiken niemals vollends aneignen (S. 45). So ist menschliche Arbeit zwangsläufig von Fehlern und Ungenauigkeiten durchzogen, außerdem wehren sich die Arbeitenden in Arbeitskämpfen gegen ihre kapitalistische Vernutzung und Ausbeutung (man denke an die Bauarbeiter). Besonders auf diese Kämpfe geht Schaupp gerne und in so gut wie jedem der neun Kapitel ein, etwa wenn er in Kapitel 6 den gewerkschaftlichen Kampf gegen die Auswirkungen der Privatisierung des Gesundheitswesens in Kanada im Zuge der COVID-19-Pandemie darstellt (S. 245 ff.). Derartige Kämpfe schaffen dem Autor zufolge (kleine) Freiheitsräume in Arbeitsabläufen, sie führen aber auch zu politischen Reformen. Zugleich löst die Autonomie der Arbeit eine Dynamik aus, die sich analog zu jener zwischen Natur und Kapitalismus gestaltet (siehe oben). Hier wie dort gibt es eine reaktive Expansion mit teils fatalen Folgen – die allerdings weder die Autonomie der Arbeit noch die der Natur auslöschen kann, denn weder Arbeit noch Natur lassen vollumfänglich kontrollieren und beherrschen. Schaupp ist sogar der hier zugespitzten Meinung: Der (moderne) Mensch könnte in einem harmonischen, nicht auf Ausbeutung basierenden Verhältnis zur Natur leben, wenn er den Kapitalismus überwinden würde.
Am Ende bleiben Zweifel. Womöglich stehen Arbeit, Natur und Kapitalismus in einem wesentlich innigeren Verhältnis, als es bei Schaupp scheint. Das Anthropozän macht uns mehr denn je darauf aufmerksam, dass die Natur kein Gegenüber ist.[6] Im Sinne der Marx’schen Rede vom Stoffwechsel müssen wir Natur und Mensch/Kultur als verzahnt denken. Der Mensch wirkt seit Jahrhunderten auf die Natur ein, er hat sie genauso wie sich selbst verändert, indem er die moderne Gesellschaft hervorbrachte.
Der dezidiert unmoderne Zugang des Autors (S. 11) ist im Kern modernistisch, weil er den Glauben daran aufrechterhält, dass eine „Überwindung“ der ökologischen Krise (ebd.) möglich sei, und zwar dann, wenn –plakativ formuliert – der Kapitalismus zurückgedrängt würde und die doppelte Autonomie von Arbeit und Natur im Zentrum stünde. Doch die Zerstörung der Ökosysteme kommt nicht von einer der Gesellschaft äußerlich bleibenden kapitalistischen Logik, sie basiert vielmehr konstitutiv auf unserer aller Lebensform. „Drill, baby, drill“, der US-Präsident Donald Trump spricht die hässliche Wahrheit unserer modernen Conditio aus.
Fußnoten
- Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 23, Berlin 1962, S. 192.
- Der Autor bemüht sich hiermit um die Synthese von klassisch marxistischen mit materialistisch-feministischen Perspektiven, weshalb er auch von „Re/produktivkräften“ spricht (S. 41–46).
- Vgl. Alf Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus [1993], Münster 2015. Siehe hierzu Heiner Heiland / Simon Schaupp (Hg.), Widerstand im Arbeitsprozess. Eine arbeitssoziologische Einführung, Bielefeld 2022.
- James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven, CT 1987.
- Marx, Das Kapital, S. 195.
- Vgl. zur Kritik am Dualismus zwischen Natur und Kultur anstelle vieler Philippe Descola, Jenseits von Natur und Kultur, Berlin 2011.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Arbeit / Industrie Geschichte Kapitalismus / Postkapitalismus Kolonialismus / Postkolonialismus Moderne / Postmoderne Ökologie / Nachhaltigkeit Politik
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Prototyp der wirtschaftswissenschaftlichen Großforschung
Rezension zu „Primat der Praxis. Bernhard Harms und das Institut für Weltwirtschaft 1913–1933“ von Lisa Eiling
Kritische Theorie oder empirieferne Deduktion?
Rezension zu „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ von Nancy Fraser
Freiheit neu erfinden
Rezension zu „Überfluss und Freiheit. Eine ökologische Geschichte der politischen Ideen“ von Pierre Charbonnier
