Ole Bogner | Rezension | 11.09.2025
Von der Naturdichtung zur Naturphilosophie
Rezension zu „Die Revolte der Erde. Karl Marx und die Ökologie“ von Heinrich Detering
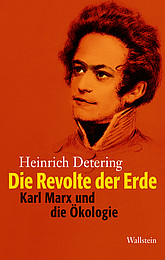
Mit Die Revolte der Erde. Karl Marx und die Ökologie schließt Heinrich Detering an die seit einigen Jahren wieder intensiv geführte Diskussion um das ökologische Denken von Karl Marx an, die sich insbesondere um dessen Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften und nicht modernen Lebensformen dreht. Detering folgt der von Kohei Saito populär vertretenen Lesart, Marx’ Geschichtsphilosophie dürfe weder als linear (eurozentristisch) noch als produktivistisch (antiökologisch) missverstanden werden. Marx sei gerade nicht der Philosoph der stalinistischen Naturausbeutung, sondern ein Stichwortgeber für die ökologischen Konflikte der Gegenwart.[1] Als Literaturwissenschaftler entfaltet Detering in seiner Schrift nun die These, Marx habe seine ökologische Position nicht erst in den 1860er-Jahren entwickelt, wie von Saito angenommen. Bereits die frühen Texte seien von einem Interesse an der organischen Einheit von Mensch und Natur durchzogen, worin sich wiederum der Einfluss der romantischen Dichtung zeige, die mit ihren Motiven und ihrer Bildsprache die Naturphilosophie des jungen Marx informiere. Damit will Detering einen korrigierenden Beitrag zur Genese und Gestalt des ökologischen Denkens im Marx’schen Werk leisten, das er hierfür einer literaturwissenschaftlichen Analyse unterzieht.
Detering beginnt seine Analyse (Kap. 2) mit dem 1842 in der Rheinischen Zeitung publizierten Text „Die Debatten über das Holzdiebstahl-Gesetz“. Marx bespricht darin einen Gesetzesentwurf, der in den rheinischen Provinziallandtag eingebracht wurde und der vorsah, das Sammeln von Totholz im Forst als Diebstahl zu deklarieren. Der darin zum Ausdruck kommende Nutzungskonflikt zwischen den Grundherren und der Landbevölkerung ereignete sich vor dem Hintergrund der neuen ökonomischen Bedeutung, die den Ressourcen des Waldes für die sich beschleunigende Industrialisierung zukam. Marx behandelt in diesem Artikel, so arbeitet Detering heraus, nicht nur einen ökonomischen Konflikt, er legt darin auch die ökologischen Verwerfungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung frei. Dabei bewege sich Marx’ Darstellung innerhalb der „animistische[n] Metaphorik des romantischen Naturempfindens“ (S. 32), insofern er Natur und Bäume als aktive Agenten personifiziere, die der Landbevölkerung ihr Totholz bereitwillig geben, während sich die Gesetzgebung des Kapitals gegen das organische Verhältnis zwischen Bevölkerung und Natur richtet.
Daran anschließend skizziert Detering im dritten Kapitel die Konturen einer „romantischen Ökologie“ (S. 35), die – etwa in den Schriften eines Ludwig Tiecks oder Johann Wolfgang von Goethes – das Verhältnis zwischen Mensch und Natur als Koexistenz konzipiert. Kennzeichnend für die literarisch-lyrischen Darstellungen ist eine animistische Personifizierung der Natur in Form von Naturgeistern. Die Bildsprache der romantischen Ökologie habe die Naturphilosophie des jungen Marx stark beeinflusst. Als Gymnasiast und Student setzte sich Marx nicht nur lesend intensiv mit den Motiven und Ideen der Romantik auseinander, er schrieb auch selbst Gedichte, die stilistisch und inhaltlich an die romantische Naturdichtung anschlossen. So inszenierte der 18-jährige Marx die Natur in Form vielfältiger Fabelwesen. In seinem „Gnomenlied“ nahm beispielsweise der Boden die Gestalt von Erdgeistern mit Handlungsfähigkeit an; vergleichbar mit der belebten Natur in dem schon erwähnten Text über den Holzdiebstahl, den er nur wenige Jahre später publizierte. „Zuerst kommt die Naturdichtung“, schließt Detering sein drittes Kapitel, „dann die Naturphilosophie“ (S. 48), eine Beobachtung, die er mit Auszügen aus der der Marx’schen Dichtung veranschaulicht:
Wir pochen, wir hämmern,
Im Morgen und Dämmern,
Mit Kunst und Macht;
Und ziehen geschäftig,
Betriebsam und kräftig
Die Werke der Nacht
Ihr Elfen mögt prangen
Mit Wind und Verlangen
Ihr kennt nicht das Land,
Das tiefverschlossen
Glanzübergossen
Vor allem stand.[2]
Im vierten Kapitel wendet sich Detering Marx’ Leitmetaphern zu, mit denen dieser bereits in den Pariser Manuskripten ökologische Verhältnisse thematisiere. Als ein wesentliches Bild identifiziert Detering hier das familiäre Verhältnis zwischen Vater Arbeit und Mutter Natur, dem zufolge nicht der Mensch qua Arbeit die Natur forme, stattdessen biete die Natur hilfsbereit und solidarisch ihre Früchte an. Darüber hinaus beschreibe Marx den Menschen als Teil der Natur und die Natur als Leib des Menschen; beide zusammen seien Teil eines übergreifenden organischen Zusammenhangs. Detering bespricht im Zuge dessen auch die Figur des Stoffwechsels, in dem die Menschen mit den Pflanzen und Tieren einen gemeinsamen Kreislauf bilden. Zuletzt geht Detering auf Marx’ Theorie der Hominisation ein, laut der der Mensch nur „mithilfe des von der Erde bereitgestellten Proviants und unterstützt von den Naturkräften sich selbst und seine Umwelt planend verändern kann“ (S. 70). In seiner im Anschluss an romantische Naturdarstellungen entwickelten Anthropologie zeige sich, dass Marx die Natur nicht als auszubeutende Ressource betrachte und „genuin ökologische Verhältnisse“ als „Grundlage aller politischen Ökonomie“ (S. 60) verstehe.
Marx analysiere im Kapital nicht nur die Ausbeutung des Menschen, sondern die der Natur überhaupt.
In den Kapiteln fünf und sechs widmet sich Detering der Marx’schen Rezeption der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit. Dabei bestätigt er die Analysen Saitos und betont die Kontinuitäten zu und die Impulse aus Marx’ romantischem Frühwerk. In Charles Darwins The Origin of Species habe Marx seine romantisch imprägnierte Intuition bestärkt gesehen, die Geschichte der Menschheit als Naturgeschichte zu begreifen. Auch wenn Marx Darwin in einigen Punkten kritisch gegenübersteht, so erkennt er doch in der evolutionären Entwicklung tierischer und pflanzlicher Organe Parallelen zu seiner Theorie der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. „In dieser Kontinuität von industrieller und ‚natürlicher Technologie‘, von Naturwissenschaft, Anthropologie und Geschichtsdenken kommen im Kapital Spinnen und Bienen ebenso in den Blick wie Menschen und Maschinen.“ (S. 87) Marx analysiere im Kapital nicht nur die Ausbeutung des Menschen, sondern die der Natur überhaupt. Der Stellung des Tiers im Produktionsprozess habe Marx dabei verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt – was Detering in Zusammenhang mit gegenwärtigen Debatten um interspecies solidarity setzt (vgl. S. 98).
Das Motiv der ursprünglichen Akkumulation ist Gegenstand des darauffolgenden Kapitels (Kap. 6). Marx begreife die historische Herausbildung des Kapitalismus zum einen als Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln, zum anderen als Riss zwischen Mensch und Natur. Die hier zugrunde liegende ökologische Frage verhandle Marx stilistisch innerhalb der Genrekonventionen der Romantik, insbesondere in Rückgriff auf das aus der Antike und Bibel tradierte Motive der Idylle. Im Rahmen dieser Sprache artikuliere Marx ein ökologisches Denken, das das Verhältnis zwischen der organischen und der unorganischen Natur – soll heißen: die Beziehungen zwischen den Menschen, den Tieren und dem Boden – anhand der sich historisch transformierenden Eigentumsverhältnisse analysiert. So kontrastiere er die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse mit einem idyllischen Idealzustand, der sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft projiziert werden kann und in dem der Mensch in einem harmonischen Wechselverhältnis mit der Natur lebt und sie planend nutzt. Zwar distanziere sich Marx von der politischen Sehnsucht der Idylledichtung, in seinen Analysen lasse sich dennoch eine romantische, spezifisch moderne Verlustwahrnehmung erkennen.
In den späten 1860er-Jahren beschäftigte sich Marx intensiv mit der Agrarökonomie, wie Detering in Kapitel 7 rekonstruiert. Marx’ Aufmerksamkeit richtete sich dabei auf die Kontroverse zwischen Justus Liebig und dessen akademischem Widersacher Carl Fraas. Die beiden Gelehrten stritten um die Frage, wie die Fruchtbarkeit des Bodens mittels Dünger gesichert werden kann: Während Liebig allein auf Mineralstoffe setzte und der Meinung war, zivilisatorische Agrarkatastrophen könnten durch gesteuerten Düngereinsatz abgewendet werden, propagierte Fraas organische Verbindungen wie Stickstoff. Diese interdisziplinäre Debatte berührte nicht nur die Disziplinen Physik, Chemie und Biologie, sondern wurde auch in den Fächern Archäologie und Naturgeschichte ausgetragen. Marx war insbesondere von Fraas’ „Beschreibung dynamischer und offener Wechselbeziehungen zwischen Bodennutzung und Klima“ (S. 146) fasziniert und erkannte in dessen Texten Belege für die ökologischen Verwerfungen, die spezifische Produktionsverhältnisse mit sich bringen. Die Agrarökonomie bot Marx eine Grundlage für die von ihm angestrebte Welt- und Naturgeschichte, die „Menschen und Tiere, Pflanzen und Mineralien, Boden, Wasser und Klima gleichermaßen umfasst“ (S. 147). Diese theoretische Position vertrat Marx auch in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ der deutschen Sozialdemokratie, wie Detering erklärt. Das sozialdemokratische Programm rief prominent die Arbeit als Quelle allen Reichtums aus, woraufhin Marx antwortete, dass damit doch gerade die Natur als Bedingung des Sozialismus vergessen werde. Indem Detering dies herausstellt, widerspricht er dem etwa von Bruno Latour und Nikolaj Schultz erhobenen Vorwurf, Marx sei in seiner politischen Philosophie zu sehr auf Produktivität fixiert und insofern nicht in der Lage, die Erde als Bedingung des Zusammenlebens zu begreifen. Laut Detering bedeutet der Marx’sche Kommunismus neben der Emanzipation des Proletariats auch die Befreiung des Planeten Erde aus einem eigentumsförmigen Ausbeutungsverhältnis.
Marx rhetorische Varianz müsse in ihren vielfältigen Bezügen zur, Querverweisen auf die und Zitaten aus der Weltliteratur verstanden werden.
Im abschließenden Kapitel präsentiert Detering Marx nicht primär als Soziologen, Philosophen oder Ökonomen, sondern als einen Kritiker, der aus all diesen Wissensgebieten schöpfend sowie in Auseinandersetzung mit der Literatur und Kunst ein Werk von einer „bemerkenswerten Stimmenvielfalt“ (S. 160) hinterlassen habe. Seine Analyse des Kapitalismus sei „wuchtig und zart, phantasievoll und ruppig, leidenschaftlich, empört und emphatisch“ (ebd.). Marx rhetorische Varianz müsse in ihren vielfältigen Bezügen zur, Querverweisen auf die und Zitaten aus der Weltliteratur verstanden werden, die von Dante über Goethe bis zu Shakespeare reichen. Die poetische Qualität der Marx’schen Texte – mit ihren vielfachen Referenzen auf Szenen, Stilmittel und Gedichte – sei für deren affektive, involvierende und überzeugende Kraft entscheidend. Diese literarischen Redeweisen „bringen zur Anschauung, konkretisieren und machen fühlbar, was die analytische Denkarbeit nicht freilegen kann. Sie machen das, was als abstrakte, regelhafte Prozessualität erschien, als individuelles Geschehen erfahrbar.“ (S. 170)
Detering verfolgt in seiner Lektüre die vielfältigen Fäden, die in Marx’ Schriften unter anderem die Frühromantik mit der Politischen Ökonomie oder die Agrargeschichte mit der Philosophie verbinden, um so zu analysieren, wie der Schriftsteller Marx sein Werk komponierte. Das ökologische Denken im Werk des Kapitalismuskritikers von der Poetik und Ästhetik der Romantik her zu erschließen, überzeugt gerade dort, wo Detering Marx’ Texte selbst zum Gegenstand nimmt und zeigt, wie in ihnen vielfältige Genres, Bilder und Zitate in den Dienst einer Naturgeschichte des Kapitalismus gestellt werden. Indem Detering die Romantik mit einem protoökologischen Denken gleichsetzt, dehnt er den Begriff der Ökologie jedoch sehr weit aus. Diese – heuristisch nachvollziehbare – Entscheidung sorgt für Unklarheit darüber, was das ökologische Denken konkret ausmacht: Handelt es sich um eine empirische Wissenschaft, eine organizistische Naturphilosophie der Wechselwirkungen, eine ästhetische Sensibilität oder doch eine Weltsicht? Detering erschließt Marx einem gegenwärtigen, ökologisch sensibilisierten Publikum, indem er dessen Nachdenken über kapitalistische Widersprüche als genuin ökologisch begreift. Dadurch provoziert er die – in seinem Buch vernachlässigte – Rückfrage nach der Distanz und Diskrepanz zwischen der Marx’schen und unserer Gegenwart. Ein differenzierender Blick auf die Diskontinuitäten in der Wissens- und Begriffsgeschichte der Ökologie, der die spezifische Repräsentation des Mensch-Natur-Verhältnisses in Marx’ Texten historisch situiert und damit auch zu heutigen Konzeptualisierungen abgrenzt, hätte die vorliegende Studie weiter angereichert.
Diese Kritik lässt sich an einer der Hauptargumentationen der Studie exemplifizieren: der Charakterisierung der Marx’schen Ökologie als familiärer Konstellation, also das bereits erwähnte Bild von Mutter Natur als Proviantgeberin im harmonischen Bund mit Vater Arbeit. Dieses aufschlussreiche Ergebnis seiner Analyse führt Detering unter anderem als Nachweis dafür an, dass es sich bei Marx eben nicht um einen Apologeten stalinistischer Naturausbeutung handelt. Allerdings endet Deterings literaturwissenschaftliche, auf Metaphern abgestellte Rekonstruktion der Marx’schen Naturphilosophie an dieser Stelle, anstatt die in dieser Bilderwelt angelegte geschlechterspezifische Arbeitsteilung und Rollenverteilung weiter auszuleuchten. Das ist nicht leicht nachzuvollziehen, gelten Mutterschaft und Care doch seit nun geraumer Zeit als zentrale Achsen kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse. Hier wäre sowohl ein produktiver Anschluss an postmarxistische[3] oder wissenschaftshistorische Debattenstränge[4] möglich gewesen als auch ein Beitrag zur heute mehr denn je notwendigen Analyse der dem ökologischen Denken inhärenten Macht- und Herrschaftsverhältnisse.[5]
Im Gesamteindruck liegt nichtsdestoweniger ein Werk vor, das souverän durch die gegenwärtige Debatte um die ökologischen Referenzen und Tendenzen im Werk von Karl Marx führt. Diese Diskussion ergänzt Detering um seine Betrachtung des romantischen Impulses und trägt so dazu bei, die Komplexität der Geschichte des ökologischen Denkens weiter zu ergründen, in der die Entwicklung der Produktionsverhältnisse, die Beschaffenheit natürlicher Systeme, politische Kämpfe sowie ästhetische Ausdrucksformen ineinander verschlungen sind. Die Kombination aus wissenschaftshistorischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive erweist sich dabei als produktiv und zeigt Marx als undogmatischen Kritiker. Damit lädt Detering dazu ein, Marx (erneut) zu lesen – und ihn neu zu interpretieren.
Fußnoten
- Vgl. Kohei Saito, Natur gegen Kapital. Marx’ Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus, Frankfurt am Main / New York 2016.
- „Gnomenlied“ von Karl Marx, zit. nach Detering S.45.
- Vgl. Silvia Federici, Aufstand aus der Küche. Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution, übers. von Max Henninger, Münster 2020.
- Vgl. Susanne Schmidt / Lisa Malich, Cocooning. Umwelt und Geschlecht. Einleitung, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 29 (2021), 1, S. 1–10.
- Vgl. Florian Sprenger, Epistemologien des Umgebens. Zur Geschichte, Ökologie und Biopolitik künstlicher environments, Bielefeld 2019.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Wibke Liebhart.
Kategorien: Arbeit / Industrie Kapitalismus / Postkapitalismus Ökologie / Nachhaltigkeit Philosophie Politische Ökonomie
Empfehlungen
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
Eine andere Geschichte des Kapitalismus
Rezension zu „Stoffwechselpolitik. Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten“ von Simon Schaupp
Freiheit neu erfinden
Rezension zu „Überfluss und Freiheit. Eine ökologische Geschichte der politischen Ideen“ von Pierre Charbonnier
