Stefan C. Aykut | Rezension | 18.07.2024
Wie Problemverschiebungen in die Klimakrise führten
Rezension zu „Carbon Societies. The Social Logic of Fossil Fuels” von Peter Wagner
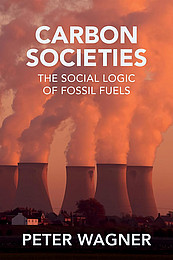
Die Klimakrise wurde in den letzten Jahren sozialwissenschaftlich ausgiebig beforscht. Dabei standen zuletzt vor allem die systemischen Ursachen der Krise sowie die strukturellen Hindernisse effektiver Problemlösungsversuche im Vordergrund. So erschien in diesem Jahr im deutschsprachigen Raum etwa Ingolfur Blühdorns Abgesang auf das ökoemanzipatorische Projekt als Verschleierung einer fundamentalen Nicht-Nachhaltigkeit kapitalistischer Demokratien sowie jüngst Jens Beckerts Absage an die Aussicht auf effektive Klimapolitik in ausdifferenzierten modernen Gesellschaften – jeweils bei weitestgehender Ausblendung real existierender klimapolitischer Fortschritte.
Anders als diese stark theoriegeleiteten und gegenwartsbezogenen Arbeiten nähert sich Peter Wagners Carbon Societies dem Klimaproblem aus der Perspektive der historischen Soziologie. Die Analyse ist erfrischend gegenstandsnah und empiriegesättigt, da sie mehr auf die Entstehung und Entwicklung der Klimakrise abhebt denn auf die Identifizierung von gleichbleibenden Systemlogiken. Dabei lautet die Leitfrage der Untersuchung: Welches Problem hat die zunehmende Nutzung fossiler Energien in jeweils spezifischen historischen Kontexten gelöst? Diese Frage führt wie ein roter Faden durch die vier Teile, elf Kapitel und 266 Seiten der Monografie.
Wie also sind zunächst Gesellschaften im Globalen Norden, später auch im Globalen Süden, in die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen geraten? Existierende sozial- und geschichtswissenschaftliche Ansätze hierzu kritisiert Wagner als größtenteils monokausal, da sie jeweils eine klar abgrenzbare und historisch gleichbleibende Logik – etwa Bevölkerungsentwicklung, Modernisierungsdynamik oder kapitalistische Akkumulation – identifizieren, die in die Abhängigkeit von fossilen Energien führte. Gegenüber diesen Perspektiven betont Wagner Handlungsträgerschaft und Kontingenz, um den Klimawandel als soziales und historisches Phänomen begreifbar zu machen.
Das Projekt des Buches ist dementsprechend geradezu wahnwitzig ambitioniert: Wagner geht es um nichts weniger als eine Langzeitperspektive auf welthistorische Transformationen sozialer Ordnungen und gesellschaftlicher Naturverhältnisse seit Beginn des Holozäns, also vor etwa 12.000 Jahren (S. 43). Glücklicherweise kann er dabei auf eine ganze Reihe von Arbeiten zurückgreifen, die hierzu in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Dazu gehören Andreas Malms und Jason Moores Untersuchungen zu Kapitalozän und Weltökologie,[1] Timothy Mitchells und Victor Seows Arbeiten zu Carbon Democracy und Carbon Technocracy,[2] Ulrich Brandt und Markus Wissens politökonomische Analyse der imperialen Lebensweisen,[3] Stephan Lessenichs soziologische These der Externalisierungsgesellschaft[4] sowie Pierre Charbonniers philosophische Rekonstruktion der materiellen Voraussetzungen für liberale Vorstellungen von Freiheit und Demokratie.[5] Wagner trägt diese Arbeiten zusammen und interpretiert sie neu. Dabei kommt ein begriffliches Instrumentarium zum Einsatz, das die Kontingenz historischer Entwicklung sichtbar macht, indem es Wendepunkte und nicht intendierte Nebenfolgen, gesellschaftliche Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung und Imagination sowie den Wandel gesellschaftlicher Selbstverständnisse ins Zentrum der Analyse rückt. Wichtig erscheint außerdem die Unterscheidung zwischen zwei Vorstellungen von Grenzen (S. 32–36): einmal als unveränderliche, materielle Begrenzungen („limits“), zum anderen als gesellschaftlich konstruierte, überwindbare Herausforderungen („frontiers“), und das Zusammenspiel dieser beiden Vorstellungen in verschiedenen historischen Perioden.
Wagners historische Analyse beginnt mit der Entstehung der ersten Stadtstaaten im Mesopotamien des 3. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung. Davon ausgehend behandelt er aufeinanderfolgende geschichtliche Sequenzen bis heute, die durch ein je spezifisches Zusammenspiel von materiellen Begrenzungen, sozialen Hierarchien und gesellschaftlichen Selbstverständnissen gekennzeichnet sind. Der Autor zeichnet nach, wie Begrenzungen immer wieder in Herausforderungen umgedeutet wurden, die man glaubte, durch wissenschaftlichen Fortschritt, koloniale Landnahme oder wirtschaftliche Expansion überwinden zu können. So markiert etwa die Überquerung der Weltmeere als „horizontale Grenze“ ab 1500 einen Bruch mit der lange vorherrschenden, landbasierten Ordnung, in der die physische Begrenztheit von fruchtbarem Land ein Grundproblem darstellte (S. 57 ff.). Die daran anschließende Ausbildung des trilateralen atlantischen Handelsregimes bedeutet daher den Übergang zu einer neuen globalen ökonomisch-ökologischen Konstellation. Diese zeichnet sich aus durch ein neues Produktionsregime – die Plantagenökonomie – und durch das gesellschaftliche Selbstverständnis eines handelsbasierten Republikanismus, der individuelle Freiheiten für wohlhabende Bürger, eine vertragsbasierte gesellschaftliche Ordnung und den weltweiten Zugriff auf erneuerbare organische Ressourcen ins Zentrum stellt (S. 77), zugleich aber die koloniale Gewalt und auch die fortdauernde Ungleichheit in den kolonialen Zentren ausblendet.
Der prägende Akteur dieser historischen Sequenz ist Großbritannien. Trotz der immensen kolonialen Ausdehnung erscheint den britischen Eliten die begrenzte Verfügbarkeit von Land und Holz als potenziell existenzielle Bedrohung für das seefahrende Imperium. Diese Sorge führt ab dem 16. Jahrhundert dazu, dass schrittweise immer größere Mengen Kohle abgebaut werden. Damit ist eine erste „vertikale Grenze“ überwunden; nach Holz wird Kohle zur wichtigsten Energiequelle (S. 83 ff.). Jedoch widerspricht Wagner in Teilen Pierre Charbonniers These, nach der die Ausweitung der Kohleförderung in direkter Verbindung steht mit dem Aufkommen neuer politischer Forderungen, dass also die Verbindung von „Überfluss und Freiheit“ gleichsam den zentralen Motor der Revolutionen des 18. Jahrhunderts darstellt. Vielmehr führt die Überwindung der ersten vertikalen Grenze nicht unmittelbar zum Durchbruch von Ansprüchen auf wirtschaftliche und politische Teilhabe. Gesellschaftlich mehrheitsfähig werden Forderungen nach „kollektiver Freiheit“ erst mit dem Übergang von handelsbasierten zu industriellen Gesellschaften und mit dem Aufkommen der Arbeiterbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts (S. 99–104). Zu dieser Zeit kennzeichnet die soziopolitische Konstellation in Europa eine doppelte Spannung: Die Zunahme von Produktionskapazitäten und materiellem Wohlstand führt nicht automatisch zu einer allgemeinen Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle, sie hat vielmehr Pauperisierung und Massenemigration zur Folge. Und das demokratische Ideal lässt sich immer weniger mit der massiven Einschränkung politischer Partizipation durch restriktive Wahlgesetze in Einklang bringen. Erst vor diesem Hintergrund entfalten Forderungen nach einer inklusiveren Demokratie und gerechteren Wohlstandsverteilung größere Durchschlagskraft. Die daraus resultierenden Spannungen können zwar zeitweise durch eine Intensivierung der Ausbeutung der Kolonien abgeschwächt werden, befeuern aber mittelfristig den Aufstieg von Kommunismus und Faschismus und letztlich die imperiale Konfrontation des Ersten Weltkriegs.
Die USA erscheinen dabei als Spezialfall (S. 104 ff.), da die historischen Umstände der Gründung der noch jungen Nation sowie die größere Verfügbarkeit von Land und Rohstoffen dort zunächst die Bedingungen für eine vergleichsweise inklusivere Sozialstruktur geschaffen hatten. Turners Frontier Thesis markiert ein gesellschaftliches Selbstverständnis, in dem soziale Konflikte nicht durch Sozialreformen oder Revolutionen befriedet werden, sondern durch die Erschließung neuer Reichtumsquellen. Zunächst werden diese bis ins späte 19. Jahrhundert durch die gewaltsame geographische Expansion gen Westen erschlossen, ab dem 20. Jahrhundert dann mittels der Überwindung metaphorischer Grenzen des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. Parallel vollzieht sich der globale Aufstieg der USA aber insbesondere vor dem Hintergrund der Überwindung einer „zweiten vertikalen Grenze“ durch die Förderung von Erdöl und Erdgas (S. 109 ff.). Der damit in Verbindung stehende Siegeszug des Automobils, die Etablierung des Fordismus als Gesellschaftsmodell und die Reformen des New Deal konsolidieren das amerikanische Modell einer sozialen Inklusion durch Massenproduktion und -konsum, allerdings zunächst unter Ausschluss großer Teile der amerikanischen Ureinwohner:innen und der afroamerikanischen Bevölkerung. Begleitet wird diese Entwicklung von einem rasant zunehmenden Ressourcenhunger: Schon 1917 übersteigen die amerikanischen CO2-Emissionen die Summe jener in allen europäischen Staaten.
Anschließend zeigt Wagner, wie die Übernahme des amerikanischen Modells in anderen westlichen kapitalistischen Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg den Ausgangspunkt für die nächste globale Zäsur bildet. Insbesondere in Europa hatten Kämpfe um ökonomische und politische Teilhabe zu einer Phase der Stagnation und zu zwei Weltkriegen geführt. Die Ausweitung der Nutzung fossiler Energien ermöglichte es, die Stagnation zu überwinden, ohne die bestehende soziale Ordnung oder die Macht der Eliten infrage zu stellen. Die „westliche große Beschleunigung“ (S. 125), befeuert durch den Wiederaufbau und die Blockkonfrontation, erscheint daher zunächst als Antwort auf die interne soziale Frage im Westen. Der Preis für diese Strategie ist eine doppelte Problemverschiebung: Während der Lebensstandard im Westen steigt, wird die Kluft zur sogenannten Dritten Welt zunehmend tiefer; zudem werden die ökologischen Folgewirkungen immer massiver. Seit den 1970er-Jahren ist sowohl die globale soziale als auch die ökologische Frage immer häufiger Gegenstand weltpolitischer Debatten. Es ist jedoch zunächst wiederum eine Ausweitung der Ressourcennutzung, diesmal vor allem in Asien, die eine Zäsur und eine neuerliche Problemverschiebung einläutet: Die „asiatische große Beschleunigung“ (S. 219–223) führt zu einer teilweisen Angleichung globaler Lebensrealitäten, lässt zugleich aber die globale Emissionsentwicklung explodieren und verschärft somit das Risiko einer Überschreitung planetarer Belastungsgrenzen drastisch.
Insgesamt macht Wagner die globale Ausbreitung des „Kohlenstoffregime[s] des demokratischen Kapitalismus“ in den Nachkriegsjahrzehnten als zentralen historischen Wendepunkt auf dem Weg in die Klimakrise aus (S. 203). Dennoch ist der weitere Verlauf der Geschichte zu keinem Zeitpunkt vorgezeichnet. Als Grundkonstante der historischen Trajektorie, die ab da immer tiefer in die Klimakrise führt, identifiziert Wagner vielmehr ein Muster der Problemverschiebung. Damit spricht er in Anlehnung an Niklas Luhmann und neuere historische Arbeiten einen Prozess an, durch den Probleme neu interpretiert und regierbar gemacht werden, indem ihre Auswirkungen in sozialer Hinsicht auf andere Menschen, zeitlich in die Zukunft oder in die natürliche Umwelt verschoben werden. Was folgt aus dieser Diagnose für die aktuelle Situation? Wagner betont zwar die Bedeutung von Pfadabhängigkeiten, verneint aber zugleich den deterministischen Verweis auf Systemzwänge. Stattdessen stellt er die Veränderbarkeit sozialer Ordnung und die Kraft menschlicher Imagination in den Mittelpunkt der letzten Kapitel seines Buches. Um Handlungsmacht über die Klimakrise zu gewinnen, müsse zunächst der Kampf um die öffentliche Deutungshoheit aufgenommen werden, um Interpretationen der Klimakrise als unausweichlich oder systemisch determiniert zurückzuweisen, und technischen Lösungsansätzen konkrete politische Strategien entgegenzusetzen. Zugleich müssten politische Gestaltungskapazitäten, die in den letzten Jahrzehnten immer stärker privatisiert wurden, wieder in die Reichweite demokratischer Institutionen zurückgeholt werden:
„To combat climate change, there is a need to re-concentrate legitimate power, an effort that has an interpretative and an institutional dimension. As to the former, the potential positive effect of purposeful collective action needs to be underlined and contrasted with the potential negative effects of the mere aggregate of individual actions. As to the latter, the capacity for agency of the democratic state needs to be enhanced, underlining institutionalized collective responsibility and renewing confidence in laws and public policies over vague ‘governance’ and supposed ‘best practices’.” (S. 264)
Auch wenn der gegen Ende skizzierte Lösungsweg letztlich eher angedeutet bleibt, ist dieses Buch in der aktuellen Debatte notwendig und enorm wichtig. Es wird die Forschung zur Klimakrise nachhaltig verändern, unter anderem weil es eine ganze Reihe von Arbeiten der letzten Jahre zusammenführt und neu interpretiert. Es bringt die Perspektive der historischen Soziologie ein in eine Debatte, die in Deutschland dominiert ist von politökonomischen und differenzierungstheoretischen Ansätzen, die jeweils wichtige Teilaspekte der Klimakrise beleuchten, der Komplexität des Problems aber aufgrund ihrer theoretischen Festlegung und der daraus resultierenden Verengung letztlich nicht gerecht werden können. Demgegenüber besticht Carbon Societies durch seine historische Langzeitperspektive und empirische Tiefenschärfe sowie durch eine durchweg klare und schnörkellose Argumentation. Veränderungen in der Ressourcennutzung erscheinen als je historisch situierte Antworten auf gesellschaftliche Probleme, die wiederum selbst Folgeprobleme schaffen.
Wagners Analyse versteht die Klimakrise also nicht als unausweichliche Konsequenz einer sich unerbittlich entfaltenden historischen Logik, sondern als nicht intendierte – aber wohlgemerkt nicht ungesehene – Folge historischer Entscheidungen. Die Krise ist historisch geworden, also Resultat von gesellschaftlichen Prozessen und Auseinandersetzungen, die ebenso anders hätten gestaltet werden können – und damit veränderbar sind. Auch der Zusammenhang zwischen der Nutzung fossiler Energieträger und Kapitalismus, industrieller Moderne oder Demokratie ist weder historisch zwingend noch funktional notwendig. Wagner widerspricht etwa Timothy Mitchells These einer engen Verbindung zwischen Formen fossiler Energiegewinnung und politischer Organisation. So weisen Kohle, Öl und Gas zwar materiell-stoffliche Unterschiede auf, die verschiedene politische und soziale Institutionen begünstigen können. Dennoch überwiegen ihre gemeinsamen Merkmale, wie etwa die hohe Energiedichte, Speicherfähigkeit und Transportierbarkeit. Diese Eigenschaften machten sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Kontexten zum Teil von Problemlösungsstrategien, die darauf abzielten, gesellschaftliche Spannungen aufzulösen und Konflikte zu befrieden.
Eine kritische Auseinandersetzung mit Wagners Thesen könnte an verschiedenen im Buch behandelten historischen Sequenzen und Analysen ansetzen. Am interessantesten erscheint im Rahmen dieser Rezension aber eine eingehendere Betrachtung des zentralen analytischen Begriffs der Problemverschiebung. Diese bilde, so der Untertitel, die „soziale Logik fossiler Energien“. Inwiefern aber lässt sich Problemverschiebung tatsächlich als übergeordnete soziale Logik verstehen, die sich noch dazu primär auf die Nutzung fossiler Energien bezieht? Ließe sich diese nicht besser als ein viel weiter verbreiteter sozialer Mechanismus fassen, der nicht nur die fossile Energienutzung antreibt, sondern darüber hinaus verschiedenste soziale Prozesse und Phänomene kennzeichnet? Genannt seien hier etwa große Staudammprojekte mit ihren ökologischen, sozialen und politischen Nebenfolgen oder die (auch von Wagner diskutierte) Entwicklung der zivilen Nutzung von Atomenergie. Anschließend an ein solches Verständnis des Begriffs ließe sich dann die interessante Frage stellen, unter welchen sozialen und politischen Umständen es denn genau zu Problemverschiebungen kommt und unter welchen nicht.
Einem solchen Vorhaben steht allerdings der Umstand im Weg, dass die Abgrenzung von Problemlösung und Problemverschiebung bei Wagner letztlich unklar bleibt. Wenig hilfreich erscheint in diesem Zusammenhang auch der Verweis des Autors auf Luhmann (S. 208), da Letzterer Problemlösung weitgehend gleichsetzt damit, Probleme durch Verschiebung handhabbar zu machen. Inwiefern aber lassen sich Problemverschiebungen vielleicht doch vermeiden, oder zumindest abmildern oder entschärfen? Gibt es eine verstärkte Tendenz zur Problemverschiebung im Kapitalismus oder in demokratischen Systemen? Und: Zeigt sich in der historischen Dynamik ein Trend zur ‚Eskalation‘ von Problemverschiebungen, infolge dessen immer schwerer wiegende Nebenfolgen in Kauf genommen werden? Wie ließe sich in dem Fall eine weitere katastrophale Problemverschiebung zur Lösung der Klimakrise vermeiden? Um diese Fragen zu adressieren, wäre eine Schärfung des Begriffs nötig, die Wagner zwar andeutet, hier aber noch nicht leistet. Carbon Societies liefert nichtsdestotrotz reichlich Material für die weitere Diskussion und einen sehr produktiven Ausgangspunkt für zukünftige Forschungen. Viel mehr kann man von einem Buch zu einem der aktuell wichtigsten Menschheitsprobleme wohl kaum erwarten. Fazit: Wagners Neuerscheinung sollte unbedingt von allen gelesen werden, die sich mit der Klimakrise beschäftigen.
Fußnoten
- Andreas Malm, Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, London 2016; Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, London 2015.
- Timothy Mitchell, Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil, London 2011; Victor Seow, Carbon Technocracy. Energy Regimes in Modern East Asia, Chicago 2022.
- Ulrich Brand / Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017.
- Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, Berlin 2016.
- Pierre Charbonnier, Überfluss und Freiheit. Eine ökologische Geschichte der politischen Ideen, Frankfurt am Main 2022.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Demokratie Geschichte Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Kolonialismus / Postkolonialismus Ökologie / Nachhaltigkeit Politik Soziale Ungleichheit
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Geschichte einer enttäuschten Liebe
Rezension zu „Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden“ von Ulrike Herrmann
Kritische Theorie oder empirieferne Deduktion?
Rezension zu „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ von Nancy Fraser
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
