Hans-Peter Müller | Rezension | 27.11.2025
Georg Simmel und die geistige Welt
Rezension zu „Les enfants de Georg Simmel“ von Denis Thouard (Hg.)
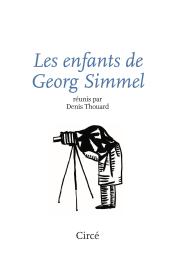
Der Fotograf, der das Cover des Buches ziert, steht augenscheinlich vor keiner leichten Aufgabe, hat er es sich doch zum Ziel gesetzt, ein Gruppenporträt von Simmels Kindern zu machen, die er eigens zu diesem Zweck versammelt hat. Auch wenn wir die Personen nicht sehen können, ahnen wir, dass es viele sind, und dass er seine liebe Mühe hat, alle Anwesenden auf dem Bild unterzubringen. Wir können uns ausmalen, wie er seine Kamera immer wieder neu ausrichtet, justiert und korrigiert, bis er am Ende alle ,im Kasten hat‘. Irritierend an der Vorstellung ist nur die große Zahl der zum Fototermin geladenen Kinder. Die Forschung kennt derer schließlich nur zwei, eines „legitim“, das andere „illegitim“, wie es im Sprachgebrauch der damaligen Zeit hieß: Seinen aus der Ehe mit Gertrud Simmel, geborene Kinel, hervorgegangenen Sohn Hans und seine der Liaison mit Gertrud Kantorowicz entstammende Tochter Angela, die Simmel bewusst niemals zu sehen bekommen wollte. Angela war und blieb das große Geheimnis in Simmels Leben.
Die Rede von Simmels Kindern und vom Gruppenporträt ist freilich metaphorischer Natur. Der Herausgeber Denis Thouard referiert damit auf alle Personen, die durch den Kontakt mit dem Berliner Philosophen, Soziologen und Ästheten geprägt wurden, und deren Geschichten er in dem vorliegenden Band erzählt. Um diesen formativen Einfluss zu dokumentieren, versammelt der elegant gestaltete Band des kleinen, aber feinen Verlags Circé aus Belval eine Fülle kurzer und informativer Texte zu diesem großen Personenkreis. Da Simmel als unbezahlter Extraordinarius an der Berliner Universität die längste Zeit seines akademischen Wirkens ohne Promotionsrecht war, konnte er keine eigene wissenschaftliche Schule bilden. So brachte er in den vier Jahren, die ihm nach seiner späten Berufung auf eine ordentliche Professur an der Universität Straßburg im Jahr 1914 bis zu seinem frühen Tod 1918 blieben, lediglich einen einzigen Doktoranden hervor: Gottfried Salomon-Delatour. Und doch war Simmel nicht nur einer der beliebtesten und erfolgreichsten, sondern auch einer der einflussreichsten Lehrer der Berliner Universität – viele kamen, um ihn zu hören, und noch mehr lasen seine Schriften. Im akademischen Milieu Berlins war er ein Star – modern, locker und offen für das Studium von Frauen, die von ihm bereits vor der offiziellen Einführung des Frauenstudiums in Preußen im Jahr 1908 zu seinen Lehrveranstaltungen zugelassen wurden.
Wer gehört nun zum Kreis derjenigen, die „Kindstatus" für sich beanspruchen können? Alle diejenigen Angehörigen einer jüngeren Generation, so Thouard in seiner Einleitung, die „bestimmte Motive seines Denkens, bestimmte Begriffe oder ganz einfach eine Art und Weise zu fragen in eine andere Epoche“ (S. 18; meine Übers., HPM) übertragen haben. Die Schlichtheit der Formulierung ist geeignet, die Größe des mit ihr verbundenen Anspruchs zu überlesen. Tatsächlich handelt es sich um ein gigantisches Projekt, das eine enorm aufwendige Spurensuche und ein ebenso breites wie intensives Quellenstudium erfordert, um Begriffe, Motive oder Fragestellungen eines Personenkreises offenzulegen, von dessen zahlreichen Mitgliedern man etliche auf Anhieb vielleicht gar nicht mit Simmel in Verbindung bringen würde. Im Grunde genommen ist das eindrucksvolle Buch nichts Geringeres als der Versuch, den trotz zahlreicher Unterbrechungen immer wieder aufgenommenen und bis heute anhaltenden Erfolg von Georg Simmels Denkweise aufzudecken.
Wer hat es nun in diesen illustren Personenkreis geschafft? Da ist zunächst Simmels Familie im intellektuellen Sinne, also seine Freundinnen Gertrud Kantorowicz und Margarete Susman,[1] sein Sohn Hans und seine Tochter Angela, aber interessanterweise nicht seine Ehefrau Gertrud Simmel, die unter dem Pseudonym Marie Luise Enckendorff ja ebenfalls philosophisch publiziert hat. Dazu gehören des Weiteren ehemalige Studenten wie Bernhard Groethuysen oder Edith Kalischer und ihr Sohn Michael Landmann, aber nicht das befreundete Malerehepaar Sabine und Reinhold Lepsius, in deren Salon Simmel neben anderen Stefan George begegnete. Prominent figurieren natürlich Ernst Bloch, Georg Lukács, Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, über deren Rivalitäten gleich eingangs Gerard Raulet gekonnt informiert. Georg Simmels Bedeutung für die Kritische Theorie bildet ja ohnehin ein spannendes Kapitel für sich. Daneben kommen aber auch Kritiker wie Ernst Cassirer, Martin Heidegger und Max Scheler ausführlich zur Sprache, denn schließlich ist auch Kritik eine Form der weiterführenden Rezeption. Und natürlich werden Simmels zahlreiche internationale Kontakte und Verbindungen beleuchtet, die schon frühzeitig für eine weitverzweigte, grenzüberschreitende Rezeption seiner Schriften sorgten. Zweifellos dürfte er vor dem Ersten Weltkrieg im Ausland als wichtigster zeitgenössischer deutscher Philosoph und Soziologe gegolten haben. Nur in seiner Heimat spielte bekanntlich der Prophet keine große Rolle, denn ein Ordinariat wollte man Simmel partout nicht geben, weder in Berlin noch in Heidelberg.
Für Frankreich bildete um die Jahrhundertwende Céléstin Bouglé die Brücke zwischen Émile Durkheim und Simmel, auch wenn Durkheims Interesse an dem deutschen Soziologen rasch wieder erlahmte. Etliche Jahre später sollte Vladimir Jankélévitch Georg Simmels Lebensphilosophie ein eindrucksvolles Porträt widmen,[2] das mit zum Besten gehört, was dazu publiziert wurde. In Italien unternahmen Antonio Banfi, Antonia Pozzi und Romano Guardini die ersten Schritte, um Simmel bekannt zu machen. In Russland war es der Philosoph Semion Frank, der Simmel zusammen mit Wilhelm Dilthey dem heimischen Publikum vorstellte. In den formalistischen Kreisen wurden Simmels lebensphilosophische Formeln auf Literatur und Sprache angewandt, mit dem Resultat, dass schon bald von Formeln wie „,plus-de-litterature‘“ und „,plus-de-langage‘“ (Serguei Tchougonnikov, S. 65) die Rede war. Im Kreis um Michail Bachtin hingegen wurde die Lebensphilosophie heftig kritisiert, auch wenn Pavel Medvedev und Valentin Volochinov Simmel als wichtigen Stichwortgeber zum Komplex von sozialer Dynamik und Formen der Kultur anerkannten. In den Vereinigten Staaten war es natürlich die Chicagoer Schule, die schon recht früh Simmels Soziologie für ihre empirischen Studien fruchtbar machte. Zunächst sorgte Albion Small in dem von ihm herausgegebenen American Journal of Sociology für die Übersetzung von Simmels einschlägigen soziologischen Texten, bevor Robert Ezra Park und Louis Wirth sich daran machten, Simmels Stadtsoziologie weiter auszuarbeiten. In Spanien sollte José Ortega y Gasset Simmels Erbe antreten, gab als „undankbares Kind“ jedoch dessen Ideen unter dem Stichwort „la Raison vitale“ (Camille Laclau Saint Guily, S. 181) als seine eigenen aus. Auf Simmels Schultern stehend, meinte er weiter zu sehen als sein ambivalenter geistiger Ziehvater, und glaubte, das von diesem begonnene lebensphilosophische Projekt unter dem eigenen Namen vollenden zu können. In der Schweiz avancierte Herman Schmalenbach gleichsam zum Statthalter Simmel’scher Soziologie und Philosophie. Er hatte bei Simmel in Berlin studiert, zusammen mit seinem Freund Willy Moog, für dessen Werk sich vor allem Simmels Überlegungen zur Geschichtsphilosophie als prägend erweisen sollten. In Ungarn spielte Karl Mannheim eine wichtige Rolle im berühmten Sonntagskreis um Georg Lukács, in dem sie – ausgehend von Simmels „Tragödie der modernen Kultur“ – nach Lösungen für die empfundene Kulturkrise suchten. Mannheim, der ebenfalls bei Simmel in Berlin studiert hatte, kritisierte dessen Skeptizismus und Relativismus als Fatalismus und entwickelte in der Folgezeit seine eigene Wissenssoziologie, die das Verhältnis von Kultur, Gesellschaft und Individuum näher zu bestimmen suchte. In Polen blieb Karol Irzykowski ein „kleines Kind“, weil er im Gegensatz zu den meisten der bisher Genannten nicht bei Simmel in Berlin studiert hatte, sondern nur von dessen Philosophie des Geldes stark beeinflusst wurde. Seine Beiträge legten die ersten Spuren Simmels in Polen, die dann von Florian Znaniecki weiterverfolgt wurden. In Deutschland glaubte Leopold von Wiese, in Simmels Fußstapfen treten zu können und die Arbeit an der formalen Soziologie durch eine umfassende Systematik zu vollenden. Simmels Essayismus und literarischen Stil kritisierend, widmete sich von Wiese ganz abstrakt dem Formenstudium. Am Ende, so Christian Papilloud (S. 229), sollte er es auf nicht weniger als 650 Formen bringen. Trotz dieser formalistischen Meisterleistung und seiner strategischen Stellung an der Spitze des 1919 gegründeten Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften an der Universität Köln und deren Zeitschrift sowie als Sekretär der Deutschen Gesellschaft für Soziologie ist von Wieses Beziehungslehre heute so gut wie vergessen.
Abgerundet wird das Mehrgenerationenfamilienbild durch die Gruppe der Künstler und Lebenskünstler. Die Beiträge über Heinz Tiessen und die Musik, über Wilhelm Worringer, Max Raphael, Carl Einstein und die Kunsttheorie sowie über Hugo von Hoffmannsthal, Rainer Maria Rilke und die Dichtung demonstrieren, wie weit Simmels Einfluss über Philosophie und Soziologie hinaus reichte. Aber auch die Lebenskünstler profitierten von Simmel, wie beispielsweise Rudolf Pannwitz, der zeitweise als Privatlehrer dessen Sohn Hans unterrichtete, Leopold Ziegler oder der Weltmann Hermann Graf Keyserling, von dem sich Simmel kurz vor seinem Tod noch herzlich verabschiedete und ihm für die langjährige Freundschaft dankte.
Tatsächlich versammelt Thouard für sein Gruppenporträt eine große, weitverzweigte Familie von geistig Wahlverwandten, wie sie nach Simmels Geschmack gewesen wäre. Bekanntlich legte Simmel keinen großen Wert auf seine leibliche Herkunftsfamilie, die er als gewöhnlich und geistlos empfand. Eine eng gestrickte, weniger auf Bluts- denn auf geistigen Banden beruhende Gruppe hätte ihm wohl weit besser gefallen. Und eben so eine Gruppe haben Thouard und sein Autorenteam zusammengebracht, indem sie das Umfeld ausleuchteten, in dem und für das Simmel gewirkt hat. Herausgekommen ist dabei „[e]in Familienfoto, das bei einer imaginären Versammlung aufgenommen wurde, bei der sich alle Mitglieder untereinander nicht kennen, aber diesen fernen intellektuellen Vorfahren gemeinsam haben“ (S. 20).
In gewisser Weise kann der informative Band als gelungene Fortsetzung vom Buch des Dankes an Georg Simmel gelten, das Kurt Gassen und Michael Landmann zu Simmels hundertstem Geburtstag 1958 in dessen Hausverlag Duncker & Humblot in Berlin herausgegeben haben. Nur dass die jüngere Publikation auf einer viel gesicherteren Quellengrundlage steht, welche die Forschung seither zur Verfügung gestellt hat. Es wäre nicht nur wünschens-, sondern auch lohnenswert, wenn diese reichhaltige und ergiebige Arbeit einen deutschen Verlag fände, der sich ihrer annimmt. Tatsächlich heben die klugen Beiträge des Buches unser Verständnis von Simmel und seinem weitgespannten intellektuellen Netzwerk in Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte noch einmal auf eine neue, höhere Stufe, was der zukünftigen Forschung nur zugutekommen kann. Denn nach der Lektüre des Bandes wissen wir nicht nur deutlich mehr als vorher, wir haben auch ein besseres Verständnis von dem, was sich unserer Kenntnis immer noch entzieht. Überall dort, wo Thouard et al. gegraben haben, tun sich neue Baustellen auf, die der philosophischen, ideengeschichtlichen und soziologischen Bearbeitung harren. Die Frage nach dem geistigen Impakt und dem intellektuellen Erbe Georg Simmels hat sich noch lange nicht erledigt.
Fußnoten
- Die Dichterin und Intellektuelle Margarete Susman erfährt im Zuge der unlängst erfolgten Herausgabe ihrer Werke gerade eine Renaissance. Vgl. Margarete Susman, Gesammelte Schriften, 5 Bde., mit einem Nachwort hrsg. v. Anke Gilleir und Barbara Hahn, Göttingen 2022. Siehe hierzu auch meinen Review-Essay, Susmania. Die gesammelten Schriften von Margarete Susman, in: Scientia Poetica 28 (2024), S. 309–326.
- Dieses Porträt liegt mittlerweile auch auf Deutsch vor: Siehe Vladimir Jankélévitch, Der Lebensphilosoph Georg Simmel [Georg Simmel, Philosophe de la Vie (1925)], in: ders., Das Verzeihen. Essays zur Moral und Kulturphilosophie, hrsg. von Ralf Konersmann, übersetzt von Claudia Brede-Konersmann und mit einem Vorwort von Jürg Altwegg, Frankfurt am Main 2004, S. 23–69.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Geschichte Geschichte der Sozialwissenschaften Gesellschaftstheorie Gruppen / Organisationen / Netzwerke Kommunikation Kritische Theorie Kultur Kunst / Ästhetik Methoden / Forschung Öffentlichkeit Philosophie Universität Wissenschaft
Empfehlungen
Übersetzung als Medium, Technik, Praxis
Rezension zu „Die Politik der Buchübersetzung. Entwicklungslinien in den Geistes- und Sozialwissenschaften nach 1945“ von Rafael Y. Schögler
Habermas’ ursprüngliche Einsicht
Rezension zu „,Es musste etwas besser werden …‘. Gespräche mit Stefan Müller-Doohm und Roman Yos“ von Jürgen Habermas
Adorno in Lüneburg
Rezension zu „Sprache, Literatur und Kunst“, „Kultur, Ausdruck und Bild“ und „Philosophie und Gesellschaft I“ von Hermann Schweppenhäuser
