Marc Buggeln | Rezension | 18.02.2025
(No) Taxes for the Rich
Rezension zu „Counterrevolution. Extravagance and Austerity in Public Finance“ von Melinda Cooper
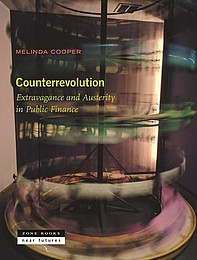
Die Zahl der Bücher, die in den letzten Jahren zum Aufstieg und zur Durchsetzung des Neoliberalismus erschienen sind, lässt sich kaum noch überschauen. Auch über die Verbindung von Neoliberalismus und Austerität[1] sowie zu den Steuerreformen unter Ronald Reagan und Margaret Thatcher wurde einiges publiziert.[2] Melinda Cooper, Soziologin an der Australian National University in Canberra, betritt mit ihrem Buch über die „Counterrrevolution“ in den Öffentlichen Finanzen, mit der sie unter anderem neoliberale Steuerreduktionen für Konzerne und Wohlhabende sowie Kürzungen in den Sozialetats bezeichnet, also ein nicht wenig beackertes Feld. Der Fokus des Buches liegt dabei eindeutig auf den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten seit den 1970er-Jahren. Der Erkenntnisgewinn liegt vor allem darin, dass erstens das enge Verhältnis von Steuern und Immobilienboom herausgearbeitet wird und zweitens die Steuertheorien der Virginia-Schule des Neoliberalismus stärker in den Fokus gerückt werden.
Das Buch besteht aus fünf Kapiteln, von denen einige bereits zuvor in kürzeren Fassungen als Aufsätze publiziert worden waren. Kapitel 1 dreht sich um das Verhältnis von Steuerreform und Immobilienboom. Kapitel 2 behandelt das neoliberale Dauerdrohszenario von einer lohngetriebenen Inflation und wie dieses zur beständigen Bekämpfung gesellschaftlicher Lohnforderungen genutzt wurde. Kapitel 3 und 4 untersuchen die Wirkung der Virginia-Schule des Neoliberalismus, die insbesondere von James M. Buchanan und Gordon Tullock gebildet wurde, wobei Kapitel 3 vor allem auf die Steuerpolitik und Kapitel 4 auf die Staatsausgaben ausgerichtet ist. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Obsession, mit der die Republikaner und christliche Fundamentalisten jede Form von staatlicher Finanzierung von Abtreibungen zu unterbinden suchen. Da ich das erste Kapitel für das innovativste – und zudem durch die erneute Wahl von Donald Trump auch für das aktuellste – halte, konzentriere ich meine Darstellung im Folgenden auf dieses.
Cooper steigt damit ein, dass die 2017 durchgeführte Steuersenkung unter Präsident Donald Trump von fünf namhaften Vertretern der Angebotstheorie orchestriert wurde, die bereits Reagan bei seiner Steuersenkungspolitik in den 1980er-Jahren beraten hatten. Trumps Anti-Establishment-Rhetorik erweist sich gerade in seiner Finanzpolitik als völlig haltlos. Vielmehr setzte er eine fest etablierte Politik fort, die das republikanische Partei-Establishment seit fast vierzig Jahren betreibt. Cooper zeigt zudem, dass es gerade diese Politik war, die Trumps Wohlstand überhaupt erst ermöglichte.
Der große Einschnitt, den der Neoliberalismus gegenüber dem vorherigen Keynesianismus bildet, liegt für Cooper in der kompletten Ablehnung einer progressiven Besteuerung. Für sie steht die politische Durchsetzung dieser Ablehnung im Zentrum des Neoliberalismus, weil sie die Ungleichheit verschärft und staatliche Handlungsmöglichkeiten zur Reduktion von Ungleichheit einschränkt. Das zweite zentrale Credo des Neoliberalismus ist für sie die beständige Ausrufung der Gefahr einer lohngetriebenen Inflation, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt.
Eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung der theoretischen Ideen in praktische Politik spielte die New Yorker Finanzpolitik. Die Stadt stand Mitte der 1970er-Jahre fast vor dem Bankrott. Nach einem umfassenden Sozialkürzungsprogramm entwickelte der Bürgermeister schließlich ein Steuerkürzungspaket, ergänzt durch eine Vielzahl von Abschreibungsmöglichkeiten, welches die privaten Investitionen ankurbeln sollte. Es waren dabei nicht industrielle Investitionen, die von Steuersenkung und Abschreibungsmöglichkeiten schließlich am stärksten gefördert wurden, sondern Bauinvestitionen. Der größte Gewinner der Maßnahmen war Donald Trump. Nach der Aushandlung weiterer Zugeständnisse der Stadt erwarb er das alte Commodore Hotel und baute es zum Grand Hyatt um. Die Höhe der gewährten Steuervergünstigungen für Trump betrugen 1983 6,3 Millionen Dollar und stiegen bis 2016 auf 17,8 Millionen Dollar (S. 51).
Die New Yorker Reform übertrugen Wirtschaftsexperten dann nach der Wahl von Ronald Reagan auf das ganze Land. Reagans Steuerreformen entlasteten das oberste Prozent der Einkommens- und Vermögensskala mit Abstand am stärksten. Zentral waren daneben die Veränderungen in der Unternehmensbesteuerung. Wie in New York wurde ein umfassendes System von Abschreibungsmöglichkeiten geschaffen. Auch auf nationaler Ebene profitierten Industrieunternehmen davon nur bedingt; vielmehr schritt die Deindustrialisierung der USA in den 1980er-Jahren durch die Hochzinspolitik der Federal Reserve weiter voran. Die größten Gewinner waren stattdessen die Immobilien- sowie die Bankbranche. Steuersenkungen und Abschreibungsmöglichkeiten führten zu Beginn der 1980er-Jahre zu einer rapiden Wertsteigerung der Vermögenswerte.
In New York stiegen die Grundstückspreise zu Beginn der 1980er-Jahre jährlich um 23,5 Prozent. Dies war der Fall, weil die Reformen dazu führten, dass Immobilienentwickler mit geliehenem Geld hohe Kapitalgewinne erzielen konnten, von denen die meisten von der Besteuerung zum Zeitpunkt des Verkaufs befreit wurden. Die Besteuerung konnte sogar vollständig aufgehoben werden, wenn der Investor den Gewinn für den Kauf einer neuen Immobilie verwendete. Dabei war die Abschreibung, die den Wertverlust eines Vermögensgegenstandes ausgleichen sollte, groß genug, um den Anleger von der Zahlung von Steuern auf alle seine anderen Einkommensquellen zu befreien. Das perfekte Beispiel für diese Variante der Gewinnerzielung war Donald Trump, dessen Geschäftsgebaren der Finanztheoretiker Hyman Minsky als Ponzi-Finanz bezeichnete.[3] Trump konnte rein auf der Grundlage der prognostizierten Wertsteigerung von Immobilien bei gleichzeitiger Steuerbefreiung investieren. Er begann ein Immobilienprojekt nach dem anderen, wobei er häufig mehr Verluste als Gewinne einfuhr. Geschäftsbanken waren aber bereit, weiterhin Kredite an Immobilienentwickler wie Trump zu vergeben, weil sie erwarteten, dass der Wert der New Yorker Immobilien schneller steigen würde als die Schuldendienstzahlungen, die sie für ihre Kredite schuldeten. Bei einer jährlichen Immobilienwertsteigerung von über 20 Prozent war dies kein Problem. Minsky ging davon aus, dass die Preise auf Dauer nicht höher als die Zinsen liegen konnten und Trumps Geschäftsmodell langfristig nicht tragbar wäre.
Zudem war Trumps Modell abhängig von der Steuerbefreiung. Doch Reagans zweite Steuerreform 1986 sollte aufkommensneutral sein, weil die Staatsverschuldung inzwischen so hoch war, dass sie von seinen Beratern als gefährlich eingestuft wurde. Darum wurden die Senkungen bei der Einkommensteuer begleitet von Steuererhöhungen und der Reduktion von Abschreibungsmöglichkeiten. So erhöhte man den Steuerhöchstsatz für langfristige Kapitalgewinne von 20 auf 28 Prozent. Noch schlimmer für die Investoren war aber, dass der gesetzliche Abschreibungszeitraum für Immobilien von 15–19 Jahren auf 27,5 Jahre verlängert wurde. Hinzu kam, dass der Sektor von den lukrativen Verlustabzugsregeln ausgeschlossen wurde, weil Immobilien nun als „passive“ Investitionen eingestuft wurden. Die Folge war ein dramatischer Rückgang der Gewerbeimmobilienwerte und eine Pleitewelle bei Spar- und Darlehenskassen, die nur durch das bis dahin größte steuerfinanzierte Rettungspaket der US-Geschichte im Zaum gehalten werden konnte. Auch Trump war eigentlich pleite, doch der Privatbankier, der Trump am meisten geliehen hatte, überzeugte seine Kollegen, dass Trump „too big to fail“ sei. Nichtsdestotrotz musste Trump in den folgenden Jahren zweimal Konkurs anmelden. Doch die Konkursbestimmungen waren für Großvermögende so vorteilhaft, dass die Privatvermögen außen vor blieben und für das Geschäftsvermögen eine Reorganisation anstelle einer Abwicklung stattfand. In der Reagan-Ära hatte sich das Wesen des Konkurses ebenfalls verändert. Vom New Deal bis in die 1970er-Jahre gelang es nur wenigen, nach einem Konkurs wieder zu Großverdienern zu werden, ab den 1980er-Jahren war dies für Großkonkurse immer häufiger der Fall.
Nach dem Steuergesetz 1986 war der Immobilien-Boom vorerst vorbei. Erst 1993 gelang es der Branche, die Clinton-Demokraten davon zu überzeugen, dass Baukredite wieder vom Einkommen abgezogen werden durften und dadurch steuerbefreiend wirkten. Als das Gesetz 1995 in Kraft trat, meldete Trump sofort eine Milliarde an Verlusten an, was ihn auf lange Zeit von der Einkommensteuer befreite. Eine neue Periode von Immobilienpreissteigerungen konnte beginnen.
Auch in den anderen Beiträgen sind die Debatten um Steuern und Staatsausgaben für Cooper solche, in denen gesellschaftliche Teilhabe sowie rassistische und genderbasierte Ausschlüsse verhandelt werden. Die neoliberale Politik verschärfte in den USA für sie eindeutig die Kluft zwischen oben und unten. Da aber die Wertsteigerung des Vermögens der Besitzenden von staatlichen Voraussetzungen abhängt und von Spekulation getrieben ist, gilt dieses immer als bedroht. Die ökonomische Elite ist für Cooper deswegen nicht mehr zum Teilen bereit, sondern im Gegenteil dauernd darum bemüht, gegen eine Vielzahl verschwenderischer Feinde vorzugehen, die angeblich ihre harte Arbeit ausnutzen und sich über staatliche Sozialleistungen nehmen, was sie nicht verdient haben. Insgesamt vermag Melinda Cooper dies in ihren Fallstudien überzeugend herzuleiten und aufzuzeigen. Der einzige Vorwurf, der man der Autorin machen kann, ist, dass – wie in vielen Büchern zum Neoliberalismus – der Siegeszug der neuen Ideologie häufig sehr reibungslos vonstattenzugehen scheint und Konflikte sowie Bruchpunkte zu wenig in den Blick genommen werden.
Fußnoten
- Mark Blyth, Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford 2013; Florian Schui, Austerity. The Great Failure, New Haven, CT 2014; Michael Burton, The Politics of Austerity. A Recent History, London 2016. Für eine längere Linie der Geschichte der Austerität bis zurück zum Faschismus: Clara E. Mattei, The Capital Order. How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism, Chicago, IL 2022.
- Monica Prasad, Starving the Beast. Ronald Reagan and the Tax Cut Revolution, New York 2018; W. Elliot Brownlee, Federal Taxation in America. A History, New York 2016, S. 182–209; Martin Daunton, Creating a Dynamic Society. The Tax Reform of the Thatcher Government, in: Marc Buggeln / Martin Daunton / Alexander Nützenadel (Hg.), The Political Economy of Public Finance. Taxation, State Spending and Debt since the 1970s, Cambridge 2017, S. 32–56.
- Hyman P. Minsky, The Bubble in the Price of Baseball Cards, in: Hyman P. Minsky Archive 94 (1990). Siehe auch Kevin M. Capeheart, Hyman Minsky‘s Interpretation of Donald Trump, in: Journal of Post-Keynesian Economics 58 (2015) 3, S. 477–492.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Matthias Ruoss. Zuerst erschienen in H-Soz-Kult.
Kategorien: Geld / Finanzen Geschichte Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Politik Politische Ökonomie Recht Soziale Ungleichheit Staat / Nation Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Made in Germany
Rezension zu „Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG“ von Konstantin Richter
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
Aaron Sahr, Eva Weiler, Sebastian Huhnholz
Nachgefragt bei Aaron Sahr, Eva Weiler und Sebastian Huhnholz
Fünf Fragen an die Herausgeber:innen des Leviathan-Sonderbandes „Politische Theorien öffentlicher Finanzen. Zur (De-)Politisierung von Geld, Eigentum und Steuern“
