Tristan Wißgott | Rezension | 01.07.2025
Die gute Policey des Hauptstadtmilieus
Rezension zu „Bürokratopia. Wie Verwaltung die Demokratie retten kann“ von Julia Borggräfe
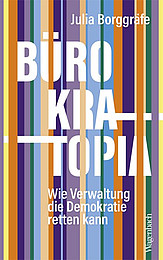
Man kann füglich bestreiten, dass das gegenwärtige Arrangement von Politik und Verwaltung in der Bundesrepublik für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen einen plausiblen Rahmen bietet. Vermutlich ist das bestehende Arrangement nur die verfassungsrechtliche Form jener politischen Epoche, die gegenwärtig im Rekordtempo abgewickelt wird.[1] Sentimentalitäten sind daher fehl am Platz und Versuche einer Neubestimmung des bundesrepublikanischen administrative state, die sich nicht in einer ebenso pauschalen wie folgenlosen Bürokratiekritik erschöpfen,[2] durchaus willkommen. Das unlängst im Verlag Klaus Wagenbach erschienene Buch von Julia Borggräfe ist ein solcher Versuch, und ein ambitionierter obendrein. Bürokratopia geheißen, lässt das Buch im Titel merkwürdig offen, ob es eine Utopie oder eine Dystopie entwirft. Der Anspruch wird freilich schon im Untertitel klar; er könnte ehrgeiziger kaum sein: Es geht der Autorin um nicht weniger als die Rettung der Demokratie durch die Verwaltung.
Borggräfe, vormalige Abteilungsleiterin in Hubertus Heils Bundesministerium für Arbeit und Soziales, expliziert ihr Vorhaben auf rund 140 Seiten mit ebenso vielen Fußnoten. In zehn Kapiteln, denen ein roter Faden nicht geschadet hätte, erklärt sie, woran die Verwaltung in der Bundesrepublik krankt und was ihrer Meinung nach zu tun ist, um der Misere abzuhelfen. Die von Borggräfe vorgetragenen Monita sind wohlbekannt: Die Verwaltung sei zu hierarchisch, zu wenig digital, zu unflexibel, kurz: die Verwaltung sei zu bürokratisch. Sehr viel interessanter als diese reichlich unspezifische Diagnose der Autorin ist die von ihr skizzierte Idee einer funktionierenden Verwaltung. Lässt man die eher harmlosen Empfehlungen nach einer Abschaffung oder wenigstens Flexibilisierung des Beamtenstatus oder der Etablierung eines „zeitgemäßen Personalmanagements“ (S. 112) beiseite, zielt Borggräfes Ansatz auf eine grundlegende Neuausrichtung des Verhältnisses von Politik und Verwaltung, konkret: auf die Entkopplung der Verwaltung von politischer Steuerung. Als institutionelle Umsetzung ihrer Vision entwirft Borggräfe eine „unabhängige Verwaltungsbehörde“, die „Projekte“ – beispielhaft: die Digitalisierung der Ministerialbürokratie – in Eigenregie umsetzen soll. Auf diesem Wege, so ihre Überzeugung, werde der „Fachlichkeit“ der „Vorzug vor politischen Partikularinteressen“ eingeräumt (S. 96 f.). Die Radikalität dieses Vorhabens ist nicht zu unterschätzen: Ohne sich länger mit verfassungsrechtlichen oder demokratietheoretischen Fragen aufzuhalten, dafür aber gut ausstaffiert mit Jargon, Verve und gutem Willen will Borggräfe die Parlamentarisierung der Bürokratie abwickeln. Gelingt das ambitionierte Vorhaben?
Probleme mit der Problembeschreibung
Borggräfe zufolge führen Klimawandel, Migration, demografischer Wandel und Digitalisierung zu einer immer „komplexeren“ Gesellschaft (S. 21 ff.). Bewusst sucht sie hier Anschluss an Niklas Luhmanns Begriff der „Komplexität“. Nur eignet sich Luhmann nicht als Gewährsmann für eine Theorie, die gesellschaftliche Komplexität über eine Entdifferenzierung des politischen Systems adressieren will. Die Verwaltung benötigt Entscheidungsprämissen, lehrt Luhmann, und so repetiert es auch Borggräfe. Bei Luhmann liefert diese die Politik; darin besteht die Pointe der internen Ausdifferenzierung des politischen Systems in Politik einerseits, Verwaltung andererseits.[3] Bei Borggräfe hingegen wird die Verwaltung dazu aufgerufen, ihre Entscheidungsprämissen selbst zu reflektieren (S. 101 ff.). Das hat unfreiwillig komische Konsequenzen: Die Bildung einer Arbeitsgruppe ist die Pointe zahlreicher Bürokratenwitze; dessen ungeachtet empfiehlt Borggräfe zur regelmäßigen Neuverhandlung der eigenen Entscheidungsprämissen nun aber gerade „Reflexionsrunden“, „Workshops“ und „Experimentierräume“ nebst veränderter „Feedbackkultur“ (S. 104 f.).
Komplementär dazu bricht Borggräfe mit dem Konzept der Routine. Hatte Luhmann noch explizit ein „Lob der Routine“ formuliert, weil die Arbeit mit Konditionalprogrammen, die im Verwaltungsrecht „Tatbestand“ und „Rechtsfolge“ heißen und in Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften niedergeschrieben sind, die Reduktion von Komplexität bis auf ein entscheidungsreifes Maß erlaubt,[4] braucht es für Borggräfe gerade eine Entlastung der Verwaltung von Routineaufgaben; nur dann könne sie sich „auf strategische und komplexere Aufgaben konzentrieren“ (S. 38 f.). Man mag das Vorhaben begrüßen und Luhmanns Ideen für überholt halten, müsste es allerdings begründen. Borggräfe jedoch, die sich affirmativ auf Luhmann beruft, während sie jede seiner Einsichten systematisch unterläuft, bleibt nicht nur eine Begründung schuldig, sondern – schlimmer – simuliert eine theoretische Grundierung, die beim ersten Nachfragen in sich zusammenbricht.
Bürokratiekritik im Geiste des Steuerzahlerbundes
Dieser Verabsolutierung der Verwaltung korrespondiert eine auffällige Geringschätzung der Politik. Borggräfe will über Sinn und Unsinn der Politik von der Warte eines kritisch reflektierten, aber in seinen Grundstrukturen nicht überholten Rationalitätsverständnisses der Verwaltung entscheiden.[5] In diesem Sinne erscheinen politische Institutionen und Prozesse bei Borggräfe häufig als defizitär: exemplarisch seien hier genannt die Parteien, die „Partikularinteressen“ vertreten (S. 12); der (nach § 54 BBG politisch besetzte) Staatssekretär, dem die Aufmerksamkeit für administrative Probleme fehlt (S. 124 f.); oder Regierungswechsel, denen Langzeitprojekte zum Opfer fallen (S. 89 ff.). Diese Beispiele mögen genügen, um zu verdeutlichen, dass Borggräfe keineswegs auf eine Überwindung falscher Vorstellungen über das Verhältnis von Politik und Verwaltung hinarbeitet, sondern diese vielmehr fortschreibt. Das zeigt sich besonders deutlich anhand ihrer stetig wiederkehrenden Hinweise darauf, wieviel „den Steuerzahler“ diese oder jene politische Entscheidung gekostet hat. Scheuers gescheiterte Maut: 243 Millionen Euro (S. 28); die Rücksetzung der PINs für den elektronischen Personalausweis auf dem Postweg: 29 Millionen Euro (S. 45); die Berliner Bankenkrise 2001: potenziell 21 Milliarden Euro (S. 48); die staatliche Verwaltung überhaupt: pro Jahr wahlweise 900 oder 915 Milliarden Euro (S. 9 bzw. S. 108). Damit ist der intellektuelle Horizont des Bundes der Steuerzahler, der übrigens auch einmal affirmativ zitiert wird (S. 50), recht präzise abgesteckt. Immerhin ist Borggräfe konsequent: Ausgerechnet Rechnungshöfe adelt sie als demokratische Institutionen (S. 19).
Politische Partizipation zwischen Wahlakt und Normenkontrollrat
Die Kehrseite dieser Rhetorik ist die Imagination des Staates als Dienstleister. Dysfunktionale Strukturen werden nicht als politisches Versagen gewertet, auf das politisch – zuvörderst: in Wahlen – zu reagieren wäre, sondern als eine Form von Pflichtverletzung des nur treuhänderisch im Interesse des „Steuerzahlers“ agierenden Fiskus. An die Stelle der politischen Partizipationsmechanismen setzt Borggräfe darum ein Verfahren, das die „Qualität politischer Entscheidungen“ sichern soll (S. 52). Demokratische Entscheidungen externen Kontrollmechanismen zu unterwerfen, ist demokratietheoretisch allerdings gewagt. Worin sollte ein solcher Maßstab für eine von einer parlamentarischen Mehrheit getragene und obendrein (schon das ist ja, siehe England, keine Selbstverständlichkeit) verfassungskonforme Entscheidung auch bestehen? Borggräfe erkennt ihn in der Qualität der Begründung eines Gesetzes und hält es darum für ein ausgesprochenes Manko, dass die Pflicht zur Gesetzesbegründung nur in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung (§§ 42 f. GGO) niedergelegt ist, weil deren Einhaltung niemand einklagen könne. Auch mahnt sie größere Barrierefreiheit in Form von „größere[r] und gut lesbare[r] Schrift“ und „kontrastreiche[n] Farben“ der in den online abrufbaren Bundestagsdrucksachen enthaltenen Gesetzesbegründungen an (S. 55). Hintergrund dieser Forderungen ist die Vorstellung, politische Partizipation solle sich auch auf die Bewertung der Gesetzesbegründungen erstrecken. Dass Politik sich nicht in der Suche nach guten Gründen erschöpft und man auch plausibel begründete Gesetze ablehnen darf, scheint außerhalb von Borggräfes Vorstellungen zu liegen. Den Bürgerinnen und Bürgern verbleibt in ihrem Modell nur, das ungeliebte Gesetz nach gründlichem Studium der Bundestagsdrucksachen als Wirklichkeit ihrer Freiheit anzuerkennen.
Um die Überzeugungskraft der Gesetzesbegründungen sicherzustellen, schlägt Borggräfe eine Aufwertung des Nationalen Normenkontrollrates vor. Die Empfehlungen dieses unabhängigen Beratungsgremiums, das vor allem für die Prüfung der Folgekosten von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen zuständig ist, seien leider nicht verbindlich, könnten aber durch eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit mehr Gewicht erlangen:
Dies könnte gelingen, indem der NKR beispielsweise regelmäßig öffentliche Konsultationen durchführt und digitale Plattformen bereitstellt, auf denen Bürger:innen Feedback zu Gesetzesentwürfen geben können. Eine transparentere Kommunikation seiner Arbeitsergebnisse über leicht zugängliche Podcasts oder Videos könnte zudem das Interesse der Öffentlichkeit überhaupt erstmal wecken und die Mitwirkung fördern. So würde der NKR nicht nur als beratendes Gremium agieren, sondern könnte als Brücke zwischen Verwaltung und Gesellschaft fungieren. (S. 54)
Einerseits ist der Normenkontrollrat die institutionalisierte Bürokratiekritik; daher kann man dem Gedanken die Folgerichtigkeit nicht absprechen. Andererseits ist ein Reformvorhaben, dessen Pointe in der Apologie ausgerechnet dieses Normenkontrollrates mündet, in ihrem spezifisch deutschen Verlangen nach sachlicher und rationaler, letztlich also: nach unpolitischer Herrschaft nicht mehr parodierbar.
Demokratietheoretische Probleme einer autonomen Verwaltung
Wo die Politik nur hindere, müsse die Verwaltung „politische Entscheidungen […] proaktiv mitgestalte[n]“ (S. 131); und sollte dies scheitern, empfiehlt Borggräfe den Beamten, sie mögen „den Mut aufbringen, unbequem zu sein und politische Entscheidungen zu hinterfragen, wenn diese der Funktionalität und Stabilität ihres Systems entgegenstehen“ (S. 129). Demokratietheorietisch problematisch ist dieser Ansatz aufgrund der fehlenden demokratischen Legitimation einer Verwaltung, die vom angeblichen Störfaktor Politik möglichst abgeschirmt werden soll. Dabei irritiert zum einen die ausgesprochen naive, um nicht zu sagen: unterkomplexe Art, in der Borggräfe die verfassungsrechtlichen Probleme – die sie keineswegs verleugnet – zu lösen sucht. Aber auch wenn man das Buch nicht am Maßstab einer verfassungsrechtlichen Abhandlung misst, muss zum anderen verwundern, mit welcher Nonchalance sie grundlegende Strukturen der parlamentarischen Demokratie beiseite wischt. Exemplarisch ist ihr Umgang mit dem parlamentarischen Budgetrecht: Borggräfe empfiehlt die Einrichtung eines projektbezogenen Sondervermögens, das besagter zu installierender Verwaltungsbehörde eine langfristige Finanzierung sichern und ihre Arbeit so gegen Budgetkürzungen durch den Bundestag abschirmen soll (S. 98 f.). Nun haben Sondervermögen neuerdings Konjunktur. Demokratietheoretisch akzeptabel sind sie aber nur, sofern sie dazu dienen, den finanzverfassungsrechtlichen Sündenfall der Schuldenbremse zu umgehen und dem Staat so andernfalls nicht vorhandene Gestaltungsspielräume zu eröffnen.[6] Als Normalfall demokratischer Verwaltungsfinanzierung sollte man sie allerdings nicht verkaufen.[7] Borggräfe tut aber nicht nur das, sondern schlägt obendrein eine Reform der Finanzverfassung vor, um „innovative Wege zur Finanzierung und Umsetzung von Projekten zu erschließen, ohne den Haushaltsprozess unnötig zu belasten“ (S. 99). Hier wird die parlamentarische Budgethoheit als bürokratisches Hindernis dargestellt, um einen Verwaltungsstaat zu inthronisieren, der politischer Steuerung vollständig entzogen ist.
Politische Kosten des Verwaltungsstaates
Hinter all diesen Überlegungen steht eine sehr kompakte Demokratietheorie, die vielleicht über manchen Hiatus in der Begründung hinweghelfen soll. Borggräfes Vision ist eine Verwaltung, die an „ethische Prinzipien“ und „demokratische Werte“ gekoppelt ist, anstatt lediglich „technokratisch“ zu handeln und auf „Formalität“ zu achten (S. 16). Letzteres geißelt Borggräfe als Ausdruck eines unkritischen Amtsverständnisses, das in der Verwaltung ein beliebig handhabbares Instrument im Dienst der Regierung sieht, das – wie etwa während des Nationalsozialismus – auch zur Unterdrückung genutzt werden kann. Damit sich Derartiges nicht wiederhole, dürfe die Verwaltung „nicht nur Regeln befolgen“, sondern müsse „aktiv dafür Sorge tragen, dass diese Regeln gerecht sind und der gesamten Gesellschaft dienen“ (S. 15 f.). Das soll wohl heißen: Die Verwaltung der Zukunft möge sich von der Bindung an Recht und Gesetz lösen und stattdessen als Vollstreckerin demokratischer Werte positionieren.
Eine solche Position scheint auf den ersten Blick zustimmungsfähig, wirft bei näherem Hinsehen aber Fragen auf: zum Beispiel die, ob der Wertbegriff im Verwaltungsrecht überhaupt eine sinnvolle Kategorie ist. Eine axiologisch fundierte Bürokratietheorie geht mit konkreten Kosten einher. Legalistische Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formvorschriften, Verhältnismäßigkeitsgebot, die Trennung von Verfügung und Vollzug, auch Rechtsschutzmöglichkeiten dürften einer Verwaltung, die sich durch demokratische Werte legitimiert sieht, nur als lästige Hindernisse erscheinen; tatsächlich kommen sie bei Borggräfe auch lediglich als Negativbeispiele vor.
An zwei Stellen deutet sie die illiberalen Konsequenzen einer werteorientierten Verwaltung wenigstens an. Da ist zum einen der Verweis auf das Vorbild Dänemark, das als eines der „Top 3 der glücklichsten Länder der Welt“ gelobt wird (S. 126), ohne die Rückseite des dänischen Wohlfahrtsstaates, also: die äußerst restriktive dänische Migrationspolitik,[8] auch nur zu erwähnen. Ob Borggräfe diesen Zusammenhang verleugnet oder übersieht, bleibt offen. Zum anderen irritiert, dass sie für ihre Kritik an hierarchischen Strukturen und routinierten Abläufen auch auf das Buch eines hochrangigen US-amerikanischen Militärs verweist[9] und sich dessen Schlussfolgerungen aus dem Kampf gegen al-Qaida umstandslos zu eigen macht. Ausgerechnet die Methoden des war on terror als Vorbild für Polizeiarbeit zu benennen, um „Cyberkriminalität, organisiertem Verbrechen und terroristischen Netzwerken“ beizukommen (S. 104), ist ein denkbar radikaler Vorschlag. Wie polizeiliches Vorgehen, das nicht durch Hierarchien und Ermächtigungsgrundlagen gesteuert ist, sondern sich durch „Anpassungsfähigkeit, Vernetzung und dezentrale Entscheidungsprozesse“ auszeichnet, im Einzelnen aussähe, bleibt leider der Imagination der Leser überlassen. Effektivität hin oder her, vielleicht ist die Programmierung von Polizeiarbeit über Tatbestand und Rechtsfolge doch keine so schlechte Idee? Oder in Luhmanns Worten: Der liberale Rechtsstaat zeichnet sich im Gegensatz zum Polizeistaat dadurch aus, dass der Schluss vom Zweck auf die Mittel nicht zulässig ist.[10] Borggräfes Vorschlag fällt hinter diese Einsicht zurück.
Verwaltungsreform im abgesicherten Modus
Der systematische Ertrag des Buches fällt, so lässt sich resümieren, bescheiden aus. Wieder und wieder wird Borggräfe von der unfreiwilligen Ironie ihres ambigen Titels eingeholt: Ihre Bürokratietheorie mündet in der Dystopie eines Verwaltungsstaates, in dem eine politisch nicht adressierbare, dafür auf diffuse Werte verpflichtete Verwaltung gesellschaftlichen Wandel nicht nur begleitet, sondern „strategisch“ und „proaktiv“ vorantreibt (S. 59 u. ö.). Damit endet Borggräfes ambitioniertes Vorhaben in der Theorie einer guten Policey des Hauptstadtmilieus, das sich mit dem politischen Status quo arrangiert hat und nur mehr auf Feintuning durch eine gegen politische Einflüsse weitgehend abgesicherte Verwaltung drängt. Dass sich damit die Demokratie retten lässt, darf man bezweifeln.
Nicht über jeden Zweifel erhaben ist schließlich auch der Zweck der Publikation. So scheint Borggräfe mit dem Buch nicht nur der Verwaltung, sondern auch dem eigenen Geschäft Auftrieb verleihen zu wollen. Seit ihrem Ausscheiden aus der Ministerialbürokratie arbeitet die Autorin bei der Unternehmensberatung Metaplan; dort ist sie Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft „Metaplan Gesellschaft für Verwaltungsinnovation“, die sich zum Ziel gesetzt hat, „den besonderen Bedürfnissen von Verwaltung in Veränderungsprozessen Rechnung tragen und besonders gut passende Konzepte dafür anbieten zu können“.[11] Und siehe da: kaum zufällig nimmt Borggräfe ausgerechnet die Kosten für externe Berater nicht in die Liste unnötiger Staatsausgaben auf; stattdessen weiß sie zu berichten, wie sich Ministerien künftig deren Dienste zunutze machen sollten (S. 66 f.) und kann ihre organisationssoziologischen Überlegungen zur Digitalisierung der Verwaltung und zur Neuausrichtung der Personalführung durch Verweis auf zwei Metaplan-Studien „belegen“ (S. 124 mit Fn. 131 f.). Die Autorin Borggräfe weist den Bedarf nach, die Unternehmensberaterin Borggräfe kann ihn befriedigen: praktisch, wenn sich Brotberuf und wissenschaftliche Nebentätigkeit so harmonisch fügen. Nach der unerfreulichen Lektüre dieses Buches kann man nur hoffen, dass die Bundesregierung auf Borggräfes Rat verzichten wird.
Fußnoten
- Das ist die These von Florian Meinel, Verwaltung und politische Gestaltung, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 84 (2025), S. 143–195; vgl. auch Jannis Lennartz, Fasten für den Überfluss? Die Abundance-Agenda in den Vereinigten Staaten, in: Verfassungsblog, 22.5.2025.
- Vgl. dazu nur Pascale Cancik, „Bürokratie“ als negative Markierung. Zur Semantik von Staats- und EU-Kritik, in: Leviathan 48 (2020), 4, S. 612–636 sowie Hans Peter Bull, Bürokratieabbau, in: Merkur 76 (2022), 873, S. 33–42.
- Knapp dazu: Niklas Luhmann, Soziologie des politischen Systems (1968), in: ders., Soziologische Aufklärung I, Opladen 1970, S. 154–177; für eine ausführliche Darstellung vgl. ders., Politische Soziologie, hrsg. von André Kieserling, Berlin 2010.
- Niklas Luhmann, Lob der Routine (1963), in: Politische Planung. Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, Opladen 1971, S. 66–89; wiederabgedruckt in: ders., Schriften zur Organisation I, hrsg. von Ernst Lukas und Veronika Tacke, Wiesbaden 2018, S. 293–332.
- Von Luhmann hätte Borggräfe lernen können, dass das nur die Folge einer verstellten Perspektive auf das politische System ist: „Um über das Verhältnis von Politik und Verwaltung sprechen zu können, genügt es […] nicht, die Ordnungsvorstellungen der Verwaltung einfach in den politischen Raum zu verlängern. Das würde notwendige Enttäuschungen verursachen. […] [D]amit gelangt man allenfalls an die politische Grenze der Verwaltung, wo jene letzten Prämissen aus den Händen der Politik übernommen werden, nicht aber zu einem adäquaten Verständnis der politischen Prozesse selbst. Auf diese Weise wird die Politik nur als Grenze der Verwaltung, nicht als sie selbst begriffen.“ Als ein Beispiel für die erwähnten „notwendigen Enttäuschungen“ nennt Luhmann „das unentwegte Klagen über ‚unsachliche‘, ‚politisch motivierte‘ Eingriffe in die Verwaltung. Solche Klagen werden von Juristen und von Rationalitätsfachleuten formuliert und sind aus ihrer Perspektive verständlich. Über ihre Berechtigung kann jedoch nicht in dieser Perspektive entschieden werden.“ Luhmann, Politische Soziologie, S. 124 f.
- Vgl. Oliver Weber, Der gefesselte Staat. Über das demokratietheoretische Verhängnis der Schuldenbremse, in: Leviathan 52 (2024), 4, S. 555–582.
- Anschaulich hierzu: Christian Waldhoff, Was ist eigentlich … ein Sondervermögen?, in: Juristische Schulung 62 (2022), 4, S. 319–320: „Sondervermögen klinken sich aus dieser rechtlichen und politischen Logik aus: Eine – meist beachtliche – Vermögensmasse wird neben dem zentralen Staatshaushalt errichtet und an ihm vorbei verwaltet. Meistens ist für diese Ausgaben nicht das Parlament, sondern die Exekutive zuständig. Von der politischen Gesamtentscheidung eines Ausgleichs zwischen staatlichem Nehmen und Geben sind solche Sondervermögen weitgehend ausgenommen. Durch ihre Randständigkeit und Unübersichtlichkeit wird die parlamentarische Finanzkontrolle bei Sondervermögen erschwert. Genau darin liegt der politische Anreiz, sich dieser Ausnahmeformen zu bedienen.“
- Zu diesem Zusammenhang vgl. Philip Manow, Die politische Ökonomie des Populismus, Berlin 2018; zur restriktiven dänischen Migrationspolitik vgl. etwa Silvia Steininger, They Not Like Us. Why the Danish ,Ghetto Law’ Violates EU Law, in: Verfassungsblog, 10.3.2025.
- Siehe Stanley McChrystal, Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World, New York 2015.
- Niklas Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, Frankfurt am Main 1973, S. 88 ff.
- Siehe hier. – Als „Quickborner Team“ hatte sich Metaplan nach dem Regierungswechsel 1969 einen Namen gemacht. Mehr Demokratie zu wagen, hieß für Willy Brandt, vor allem aber für seinen Kanzleramtschef Horst Ehmke, die Organisation der Bundesregierung auf neue Füße zu stellen. Dem Geist der Kybernetik verpflichtet, krempelte das „Quickborner Team“ erst die Arbeitsabläufe um und lieferte dann gar Vorgaben für den Neubau des Bundeskanzleramtes. Vgl. dazu Merle Ziegler, Kybernetisch regieren. Architektur des Bonner Bundeskanzleramtes 1969–1976, Berlin 2017.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Demokratie Digitalisierung Gesellschaft Gruppen / Organisationen / Netzwerke Kommunikation Macht Normen / Regeln / Konventionen Politik Recht Staat / Nation Systemtheorie / Soziale Systeme
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Vom Umgang mit Gegensinn
Rezension zu „Niklas Luhmann am OVG Lüneburg. Zur Entstehung der Systemtheorie“ von Timon Beyes, Wolfgang Hagen, Claus Pias und Martin Warnke (Hg.)
Das Kind als eindimensionales Subjekt
Rezension zu „Das Problem Kind. Ein Beitrag zur Genealogie moderner Subjektivierung“ von Christoph T. Burmeister
Wohnungslosigkeit als staatliches Versagen
Rezension zu „Homelessness. A Critical Introduction“ von Cameron Parsell
